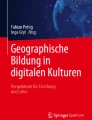Zusammenfassung
Digitalisierungsprojekte müssen für alle Beteiligten nutzbar sein. Vorgaben der Behindertenrechtskonvention oder der Hochschulgesetze führen dazu, dass sich Hochschulen bei Digitalisierungsstrategien auch mit Inklusionsstrategien auseinandersetzen müssen. Die Hochschulrektorenkonferenz stellte hier in einer großen Umfrage Verbesserungsbedarf bei den Hochschulen fest. Der Beitrag behandelt die Rechtssituation und zeigt am Vorschlag des universellen Designs für das Lernen, wie digitale Barrieren zu reduzieren sind, damit Hochschulen alle zugangsberechtigten Talente bestmöglich mit und durch digitalisierte Angebote ausbilden können.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- Inklusion
- Diversität
- Mediendidaktik
- Doing Disability
- Behinderungsbegriff
- Diversity Management
- Digitalisierung
- Change
- Universal Design
1 Digitalisierung an Hochschulen: Rechtliche Vorgaben zu Inklusion
Hätte der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking an Ihrer Hochschule studieren können? Empirische Studien beschreiben große Schwierigkeiten von behinderten Studierenden an deutschsprachigen Hochschulen (Poskowsky et al. 2018; Powell et al. 2008). In einer Expert*innenbefragung an Schweizer Hochschulen können sogar zwei Drittel der befragten Behindertenbeauftragten hörbehinderten Studieninteressent*innen nicht das Studium an ihrer Hochschule empfehlen (Hollenweger et al. 2005).
Der vorliegende Beitrag geht daher der Frage nach, wie digitale Barrieren zu reduzieren sind, damit Hochschulen alle zugangsberechtigten Talente bestmöglich mit und durch digitalisierte Angebote ausbilden können. Er fokussiert hochschulorganisatorisch und hochschuldidaktisch relevante Fragen nach der barrierearmen und inklusionsfördernden Gestaltung von Lehren und Lernen als eine der Kernaufgabe von Hochschulen. Digitalisierungsstrategien für Hochschulen sollen Lehr- und Lernprozesse unterstützen, davon zeugen die Beiträge in diesem Band. Werden sie barrierearm und inklusiv gedacht? Unterstützen sie die zunehmende Diversität unter Lernenden, Lehrenden und Mitarbeitenden einer „Hochschule für alle“ (Hochschulrektorenkonferenz 2013) oder riskieren Digitalisierungsstrategien neue Exklusionen?
Gesetzliche Vorgaben basierend auf dem Diskriminierungsverbot in Art. 3 des Grundgesetzes führen dazu, dass sich Hochschulen bei Digitalisierungsstrategien auch mit Inklusionsstrategien auseinandersetzen. Die Hochschulrektorenkonferenz (Hochschulrektorenkonferenz 2013) stellte hier in einer großen Umfrage Verbesserungsbedarf bei den Hochschulen fest. So verfügte beispielsweise nur die Hälfte der antwortenden Hochschulen (135 von 268 Mitgliedshochschulen) über einen barrierefreien Webauftritt, wohingegen Formulare für elektronische Anmelde-, Zulassungs- und Rückmeldeverfahren nur an weniger als der Hälfte der teilnehmenden Hochschulen barrierefrei ausgestaltet waren. Versteht man Digitalisierung als Element von Change-Prozessen an Hochschulen, um auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren, so muss sie dazu beitragen, insbesondere gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Inklusion und Diversität werden zunehmend ebenfalls als Werte für Hochschulentwicklung und Change-Prozesse verstanden (Klammer und Ganseuer 2015).
Den Bedarf nach Sensibilisierung für digitale Inklusionspraktiken zeigen auch die Diskurse um Digitalisierungsentscheidungen im Zuge der COVID-19-Präventionsmaßnahmen 2020: Bei den Überlegungen, wie den Studierenden die Fortsetzung des Studiums durch innovative digitale Angebote ermöglicht werden könnte, werden Barrierefreiheit und Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Zugänglichkeit von Informationstechnologien kaum diskutiert.
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und der Umsetzung in die deutsche Gesetzgebung wird der Zugang von Studierenden mit Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu Studiengängen gesetzlich geregelt, Rechtsansprüche können geltend gemacht werden. Gesetzliche Regelungen betreffen das Recht auf Bildung (Artikel 24), die Reduzierung von Diskriminierungen (Artikel 5) und die Gewährung von gleichberechtigten Zugängen, darunter auch der Zugang zu Informationen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) (Artikel 9 und 21). In den Hochschulgesetzen der Länder wurde die diskriminierungsfreie Förderung des Studiums behinderter Studierender aufgenommen. Die „Barrierefreie Informationstechnik Verordnung“ (BITV 2.0) formuliert zudem Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um barrierefreie Webinhalte zu erstellen.
Nach dem Hochschulrahmengesetz tragen Hochschulen „dafür Sorge, dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können“ (§ 2 Abs. 4 HRG); hierbei wird jedoch weiterhin Verbesserungsbedarf bei den Hochschulen festgestellt (Hochschulrektorenkonferenz 2013). Gesetzlich geregelt ist aber, dass Hochschulen niemanden diskriminieren dürfen und die besonderen Bedürfnisse behinderter Beschäftigter und Studierender berücksichtigen müssen (§§ 2 HRG, 3 Abs. 5 HG NRW) und dass der gleichberechtigte Zugang zu „Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen … zu gewährleisten“ (UN-BRK Art. 9) ist, dies gilt auch für Zugänge zu Bildung (UN-BRK Art. 21 und 24).
Etwa 11 % der Studierenden haben eine studienrelevante gesundheitliche Beeinträchtigung (Poskowsky et al. 2018). Dazu zählen unter anderem motorische oder sensorische Einschränkungen, aber auch psychische Einschränkungen wie Autismus, Depression, Angststörungen, Konzentrationsstörungen. Aus Studien zu Diversität ist bekannt, dass Studierende zunehmend divers sind. Dies betrifft unter anderem die zur Verfügung stehende Zeit für das Studium, die Vorbildung, Alter, finanzielle Ressourcen (Klein und Heitzmann 2012). All diese Unterschiede erfordern eine Berücksichtigung bei der Hochschulorganisation und der Planung von Lehrangeboten und Lernmaterialien (Klein 2016).
Konzepte und Ideen, die Inklusion durch Digitalisierung unterstützen, sind notwendig und betreffen weit mehr als nur die Erstellung barrierearmer Dokumente. Inklusion muss bereits bei der Entscheidung für den Einsatz und Kauf einer (barrierearmen oder adaptierbaren) Software mitgedacht werden, bei der Entscheidung für eine Campus-Management-Software, bei der Erstellung von E-Learning-Seminaren oder Blended-Learning-Szenarien, bei der Unterstützung von Kommunikation zwischen Studierenden, aber ebenfalls bei der didaktischen Erstellung (barrierereduzierender) Bildbeschreibungen, Annotationen von Lernvideos, barrierearmer Dokumente, barrierearmer Diskussionsmöglichkeiten, barrierearmer Foliensätze, partizipationsfördernder Kommunikationstechnologien, inklusionsfördernder Präsentationspraktiken und vieles mehr. Die Freiheit der Wahl jeglicher digitaler Lehrmethoden kann also durch das Recht auf diskriminierungsfreie Bildung von Studierenden begrenzt werden (Welti 2016).
2 Diversity Management und inklusive Hochschuldidaktik
Zwar wird mit Inklusion oft die Rechtssituation adressiert, der Ansatz fügt sich aber gut in bestehende umfassendere Diskurse zum Umgang mit Verschiedenheit an Hochschulen ein (vgl. Schuppener et al. 2014); Diversitätsmanagement (Klein und Heitzmann 2012) an Hochschulen versteht auch Behinderung als eine relevante Diversitätsdimension. Mit der Benennung der Dimension Behinderung geht das Risiko einher, Behinderung zu essenzialisieren und damit erst die Zuschreibung der körperlichen Verfasstheit dominieren zu lassen. Im Vordergrund steht dann das medizinisch definierte Defizit, das ausgeglichen werden muss. Der interdisziplinäre Wissenschaftszweig der Disability Studies geht stattdessen von dem sozialen Modell eines Behinderungsbegriffs aus: Es steht nicht die individuelle Verfasstheit im Fokus, sondern das Behindertwerden durch die Einschränkungen, Barrieren, Handlungen aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, im Hochschulkontext also aufgrund organisatorischer Verhältnisse. Behinderung wird dann hergestellt durch „Praktiken des Ausschließens und der Besonderung“ (Gugutzer und Schneider 2007, S. 34, zitiert nach Dobusch 2012, S. 74).
Im vorliegenden Beitrag soll stattdessen die Perspektive auf die Rolle und Verantwortung der Lehrenden sowie ihrer hochschuldidaktischen Unterstützungsstrukturen eingenommen werden. Er geht der Frage nach, wie geeignete inklusive Lehrmaterialien gewählt und gestaltet werden können, die nach dem Universal Design Prinzip (Story et al. 1998) Zugänge und Teilhabe für alle ermöglichen. Hochschule, so das Argument des vorliegenden Beitrags, kann ihr Inklusionspotenzial erhöhen, wenn sie ihre Praktiken des Ausschließens und der Besonderung Einzelner reduziert, indem sie Lernenden barrierearme Materialien und Lernkontexte anbietet und nicht den einzelnen diversen Lernenden die Mehrarbeit der Anpassung zumutet. Der Beitrag legt die Verwendung eines weiten Inklusionsbegriffs zugrunde: Nicht Einzelne (Behinderte) sollen in etwas (Hochschule) inkludiert werden, sondern durch inklusive Lernsettings, die systematisch individuellen Bedarf berücksichtigen, sollen alle von gut durchdachten Angeboten profitieren. Der Beitrag nutzt weitgehend den Begriff der Barrierearmut anstelle der Barrierefreiheit. Da Barrieren so vielfältig sein können wie Menschen, ist Barrierefreiheit eine Utopie. Die Verwendung des Begriffs barrierearm impliziert, dass die Lehre durch bestimmte Maßnahmen zwar weniger Barrieren aufweisen kann, aber doch nur selten ganz frei von jeglichen Barrieren ist und so immer darauf zu achten ist, ob sie für die aktuellen Lernenden noch adaptiert werden kann oder muss.
Eine Berücksichtigung der Diversität unter Studierenden stellt hohe Anforderungen an eine inklusive Hochschuldidaktik: Zeiten und Anwesenheit können nicht von allen Studierendentypen gleichermaßen erfüllt werden. Didaktische Methoden (Sprechen, Schreiben, Lesen, Tafelbilder, Diskussionen, synchrone digitale Vorträge, Whiteboard-Notizen und anderes) sowie Studienaufgaben können nicht von allen Studierendentypen gleichermaßen wahrgenommen werden.
Die Berücksichtigung höherer Mobilität von Lernenden und Lehrenden, eine qualitativ bessere Lehre, vereinfachte Verwaltungsabläufe, tieferes Verstehen von Lehr-Lern-Prozessen sind eine Auswahl wünschenswerter Ziele von Digitalisierung an der Hochschule. Vermieden werden sollten zum Beispiel:
-
Erschwerungen von Arbeitsabläufen,
-
Ausgrenzung von Beteiligten aufgrund erschwerter Zugänge und Nutzung von Technologie,
-
technische Fehler und Unzulänglichkeiten,
-
unangemessene automatisierte Auswertung von Daten im Rahmen der Lehre.
Die Zugangsvoraussetzungen für ein Hochschulstudium sind gesetzlich geregelt. Unbewusste Vorstellungen von Studierenden wie beispielsweise jene, dass Architekturstudierende händisch Modelle bauen können müssten und wer dazu körperlich nicht in der Lage sei – zum Beispiel wegen fehlender Arme –, eben nicht Architekt*in werden könne, oder dass Chemiestudierende Flüssigkeiten in Experimenten mischen müssten und wer die Beschriftungen von Flaschen nicht lesen könne, eben nicht Chemiker*in werden könne, verwechseln Verantwortlichkeiten und vermischen Studienziele und (digitale) didaktische Methoden: Die Herausforderungen in einer inklusiven Gesellschaft liegen nicht darin, Menschen auszuschließen, sondern geeignete didaktische Methoden zu entwickeln, um Architekturmodellbau beispielsweise auch digital zu ermöglichen oder Chemieflaschen mit digital auslesbaren QR-Codes zu versehen. Entsprechend dem Constructive Alignment (Biggs 1996) lassen sich Prüfungsleistungen so gestalten, dass die zu erwerbenden Fähigkeiten und Kenntnisse erworben und geprüft werden können, was nicht zwangsläufig durch eine vorgegebene Form der Prüfungsleistung erfolgen muss (zum Beispiel nicht zwingend der manuelle Bau eines Architekturmodells). Inklusiv durchdachter Einsatz digitaler Tools kann dazu beitragen. Klammer/Ganseuer verstehen daher „E-Learning als ‚Tool‘ (…), um Diversity-Management-Aufgaben unterstützend zu realisieren“ (Klammer und Ganseuer 2015, S. 82). Insbesondere die sogenannten nichttraditionellen Studierenden haben auch entsprechend höhere Erwartungen an das Angebot von digitalen Lehr-Lern-Formen (Zawacki-Richter 2015). Sie nutzten signifikant und deutlich mehr verschiedene Medien, Tools und Services (ebenda). Insofern ist gerade für diesen dringenden Bedarf der nichttraditionellen Studierendentypen die Barrierearmut sicherzustellen. Anleitungen dafür existieren bislang wenige, sie fokussieren meist die barrierearme Gestaltung von Text- und Präsentationsdokumenten (Digital informiert – im Job integriert, o. J.; Sohn 2018), Videos (BIK für alle 2018), Lernplattformen (Zentrale Studienberatung der Justus-Liebig-Universität 2015) oder bieten Prüfkriterien für die Bestimmung der Barrierearmut von Software an (beispielhaft: Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, o. J.). Thematische Überblicke zu Barrierefreiheit finden sich für den Kontext E-Learning (Fisseler 2020; e-teaching.org 2018) und E-Teaching (Weber und Voegler 2014).
Barrierearmut muss mit Datenschutz verknüpft werden: Ein Einsatz von praktischer Software durch engagierte Lehrende ohne Beteiligung der Rechenzentren und Datenschutzbeauftragten riskiert, dass Lehre mittels ungeprüfter, aber verbreiteter Software (zum Beispiel Skype, WhatsApp, GoogleDocs, GoogleHangouts, Discord) unterstützt wird, die sensible personenbezogene Lerner*innendaten an Firmen zur weiteren Nutzung und Verarbeitung weitergeben. Zu einer solchen Nutzung und Einwilligung dürfen Studierende nicht genötigt werden. Dies ist Hochschulen gesetzlich untersagt (zum Beispiel in NRW durch § 8 Abs. 7 HG). Studierende, denen ihr Datenschutz wichtig ist, können also an solchen Angeboten nicht teilnehmen und werden exkludiert. Diese Fragen stellen sich beispielsweise bei Videokonferenzsoftware, bei Youtube-Vorlesungen, bei Seminaraufzeichnungen, bei Übersetzungssoftware.
3 Digitales universelles Design für die Lehre
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Software muss nach Gesetzeslage für alle Beteiligten ermöglicht werden. Wie sind die Berücksichtigung von Diversität von Studierenden und die inklusive Nutzung von Software methodisch umzusetzen?
Hier sollte mit einem weiten Inklusionsbegriff, der sich nicht nur auf Behinderung reduziert, geplant werden. Es ist davon auszugehen, dass viele Studierende heutzutage unzufrieden sind, wenn ihre Lehrenden zu selten digitale Lösungen einsetzen, um Lehre zugänglicher zu machen. Auch für hörende Studierende wäre es von Vorteil, wenn Lehrende Mikrofone in Hörsälen einsetzen und erfahrungsgemäß sind nicht alle Flipchart-Zeichnungen oder Tafelbeschriftungen von Lehrenden gut erkennbar – selbst ohne Sehbehinderung. Inklusive digitale Lösungen für behindernde Praktiken zu finden kann demnach – das wird an diesen Beispielen sichtbar – Mehrwerte für alle bieten, nicht nur für Menschen mit Behinderungen, mit Sprach- oder Schreibschwierigkeiten, mit Abwesenheiten wegen Pflege- oder Erziehungszeiten et cetera.
Es kann also ein Ansatz des Universal Design für das Lernen (UDL) sinnvoll sein. Danach wird Lehre so gestaltet, dass sie von allen Menschen gleichermaßen in Anspruch genommen werden kann.
Universal Design scheint auch für US-amerikanische Universitäten ein Mittel, um Klageverfahren zu vermeiden, wenn didaktisches Lernmaterial nicht barrierefrei gestaltet ist und so Studierenden Chancengleichheit in der Bildung verwehrt bleibt (Zentrales eLearning-Büro der Universität Hamburg 2014). Durch die Orientierung an Grundsätzen des Universal Designs, also durch die zugängliche und nutzbare Gestaltung von Praktiken und Geräten (vgl. Claus und Züllich 2008), kann Hochschullehre vielfältiger und besser auf den Bedarf diverser Studierender abgestimmt werden.
Universal Design ist ursprünglich ein Konzept aus dem Produktdesign: Produkte sollen so designt werden, dass sie von möglichst vielen Menschen genutzt werden können. Statt Produkte speziell für bestimmte Gruppen oder den Durchschnitt von Menschen zu designen, sollte dieses universelle Design allen Menschen entgegenkommen. Dazu wurden sieben Prinzipien universellen Designs entwickelt (Story et al. 1998). Auf dieser Grundlage wurden in der Pädagogik universelle Designs für Instruktion (Scott et al. 2016) und Lernen (Fisseler 2015; vgl. Meyer et al. 2016; Scott et al. 2016) gestaltet. Die neun Prinzipien des Universal Design of Instruction (Scott et al. 2016) beschreiben für Lehrkontexte genauer, was solche Produkte als Lehrmaterialien und auch für Lehrsituationen auszeichnet (vgl. Fisseler 2015). Anhand dieser neun Prinzipien soll die Lehre universell gestaltet werden, sodass alle an ihr teilhaben können. Bezieht man diese Prinzipien auf Digitalisierungsstrategien an Hochschulen, so lassen sich daraus Fragen an Digitalisierungsprozesse entwickeln (Zorn und Weiser 2018). Tab. 1 fasst diese Prinzipien als Vorlage für Entscheidungsträger*innen zusammen.
Wie Digitalisierung zum universellen Design von Lernsituationen und -materialien beitragen kann, haben Zorn und Weiser (2018) in ihrer Handreichung für Lehrende für die einzelnen Prinzipien detailliert und mit vielen Beispielen ausgeführt. Sie zeigen auch, wie bei Digitalisierungsmaßnahmen auf die Auswahl und Gestaltung barrierearmer Tools geachtet werden kann.
Ein Beispiel für das erste Prinzip des UDL, die breite Nutzbarkeit, wird für Speech-to-Text-Technologie illustriert:
Kommunikation und Interaktion als zentrale Elemente des Lernens sind herausfordernd für Studierende mit Sinneseinschränkungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Anwesenheits- oder Sprachschwierigkeiten. Wer nicht versteht, kann nur schlecht teilhaben. Dies ist nicht nur für hörgeschädigte Studierende problematisch; auch gut hörende Studierende können in Vorlesungen aufgrund schlechter Akustik und der nur seltenen Verwendung von Mikrofonen durch Lehrende unter Verständnis- und Aufmerksamkeitsproblemen leiden. Wer für eine Weile abgelenkt war und dem Diskussionsverlauf nicht folgen konnte, wird ebenfalls Schwierigkeiten bei der Beteiligung an der Kommunikation haben. Auch des Deutschen nicht mächtige Erasmus-Studierende können sich nicht an der Kommunikation in Lehrveranstaltungen beteiligen. Neben der Integration von Gebärdendolmetscher*innen für gehörlose Studierende wären auch die Entwicklung von Speech-to-Text-Technologien, welche automatisiert Gesprochenes in Schrift umwandeln und auf einem Monitor live abbilden, denkbare Lösungen, um mehr Studierenden Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten. Die in Text umgewandelte Sprache kann dann auch durch ein Übersetzungsprogramm in andere Sprachen übersetzt werden. Am Karlsruhe Institute of Technology wird derzeit mit einem Lecture TranslatorFootnote 1 experimentiert, dieser funktioniert allerdings noch nicht live. Das Beispiel verdeutlicht, dass von Lösungen für Individuen bei einer UD-Perspektive viele Lernende profitieren können.
Die Frage zum zweiten Prinzip, ob digitale Medien die Lehre flexibler machen können, lässt sich bei digitalem Medieneinsatz so beantworten: Aufgrund ihrer Digitalität bieten digitale Medien dafür gute Möglichkeiten: Während ein deutschsprachiger Textausdruck auf Papier unveränderbar immer ein deutscher Text bleibt, kann derselbe Text als digitales Medium wahlweise in größerer Schrift, mit anderen Farben, als gesprochenes Audio oder gar in übersetzter Sprache ausgegeben werden. Bei vernetztem Arbeiten wird auch eine gemeinsame Annotation möglich, die eine andere Form des (asynchronen) Diskutierens ermöglicht. Digitalität ist numerische Repräsentation statt fixer Darstellung und ermöglicht Modularität, Variabilität, Transkodierung (Manovich 2002).
Prinzip drei: Diese Formen versetzen seh- oder hörbehinderte Studierende in die Lage, Inhalte von Vorlesungen oder Texten in benötigter Form zu erhalten. Als Chance anzusehen ist es daher, wenn derzeit Digitalisierungen vorgenommen werden, die diese Möglichkeiten beachten: Wenn beispielsweise zunehmend Vorlesungen als Videos bereitgestellt werden, müssen sie hör- oder sehbehinderten Studierenden Untertitel oder ein digitales Skript anbieten (BIK für alle 2018) und auf Formaten bereitgestellt werden, die durch Screenreader für blinde Menschen gesteuert werden könnenFootnote 2. Der Greenfish Subtitle Player ist ein Programm, das auf dem Bildschirm ein kleines halbtransparentes Fenster erscheinen lässt, auf dem Untertitel abgespielt werden können. Dieses Tool kann verwendet werden, um Untertitel einzublenden, die nicht synchronisiert wurden. Mit der Tastatur kann manuell der nächste Untertitel eingeblendet werden. Mithilfe einer Untertitelungssoftware wie „Subtitle Edit“Footnote 3 könnte das Transkript eines Videos an beliebigen Stellen in kleine Absätze unterteilt werden und in einer Untertiteldatei gespeichert werden.
Barrierefreie Dokumente sind generell nützlicher als schlecht formatierte – sie sind screenreaderfähig und außerdem strukturierter und übersichtlicher. Für die Erstellung barrierefreier Textdokumente und Folien existieren gute Anleitungen. Um die eigene Erstellung zu testen, können Tests im Dokument oder mit zusätzlicher Software vorgenommen werden.Footnote 4
Das Prinzip vier der sensorischen Wahrnehmbarkeit zeigt sich in der Notwendigkeit von Untertiteln für Lernvideos. Rechtlich notwendig für hörbehinderte Studierende bieten Untertitel als universelles Design auch Vorteile, wenn hörende Studierende in einer lauten Umgebung (U-Bahn) die Vorlesung hören oder lieber als Transkript lesen (oder übersetzen lassen) möchten (BIK für alle 2018). Neue digitale Möglichkeiten für die Frage, wie Unabhängigkeit von sensorischen Fähigkeiten erreicht werden kann, sind beispielsweise die Anbringung von QR-Codes an Gegenständen oder Behältern, deren Inhalt vorgelesen wird.
Für die Fragen zum Prinzip fünf der Fehlertoleranz und der Möglichkeit nachzuarbeiten zeigen sich Potenziale bei PDF-Nutzung: Die meisten PDF-Reader (auch der verbreitete kostenlose Adobe Acrobat Reader) haben übrigens die Möglichkeit, in der Datei selbst Notizen, Kommentare, Unterstreichungen, Hervorhebungen et cetera zu erstellen. So könnten Besprechungen (in der Lehrveranstaltung) von Texten direkt im Text dokumentiert werden. Screencasts (untertitelt) können angeboten werden als einleitende, wiederkehrende Themenüberblicke für Studierende, die nacharbeiten möchten (Herstellung beispielsweise mit datensicherem Open Source Tool).Footnote 5 Inklusive Lehre weist Lernende auf die lernfördernde Nutzung solcher Tools hin.
Zur Frage des Prinzips sechs nach geringem körperlichen Aufwand ist zu überlegen, wodurch digitale Tools diesen reduzieren helfen: beispielsweise durch virtuelle Veranstaltungen, die weniger Mobilität erfordern oder durch digitale sprechende Etiketten oder NFC-Aufkleber, die mit Stiften oder Smartphones vorgelesen werden können (Zorn 2020)Footnote 6. Auch ist zu überlegen, ob Architekturmodelle zwangsläufig händisch gebaut werden müssen oder ob bei Körperbehinderung auch der Bau mittels digitaler Tools denkbar ist, die mit Assistenztechnologie gesteuert werden.
Die Fragen zum Prinzip sieben der Lernräume lassen Ideen darüber entstehen, wie Räume digital zugänglich gemacht werden können: Digitale Türschilder, digitale Gebäudeleitsysteme könnten vielen Menschen bessere Orientierung bieten bei der Suche nach Räumen oder ihren Lehrveranstaltungen. Die Fragen verweisen auch darauf, dass bei virtueller Lehre zu beachten ist, dass die virtuellen Lernräume im übertragenen Sinn zugänglich und angenehm sind. Dies betrifft auch Prinzip acht der Lerngemeinschaft. Darauf sollte auch bereits bei der grundlegenden Auswahl des Lernmanagementsystems einer Hochschule geachtet werden: Lernplattformen wie ILIAS, moodle, OPAL, gelten als barrierearm, haben jedoch unterschiedlich gelungene Ausprägungen für die Steuerung mit Assistenztools. Bei Open-Source-Systemen sind eher Anpassungen für Barrierefreiheit machbar. Dafür sind geeignete digitale Kommunikationstools, eventuell auch (sichere) Messengersysteme bereitzustellen, um Studierende damit nicht alleine zu lassen. Hier sollte die Hochschule vor einer Entscheidung von großer Tragweite Prüfungen vornehmen.
Prinzip neun wird unterstützt durch die Signalisierung einer Bereitschaft von Lehrenden und Hochschulverwaltung zur Unterstützung und Teilhabe aller Lernenden. Da die Lernenden oft selbst Expert*innen darin sind, was sie wie (digital und analog) benötigen, kann es nicht nur effektiv, sondern auch förderlich für das Lernklima sein, die Lernenden an der Gestaltung des Lernprozesses und der Auswahl der Tools zu beteiligen.
4 Fazit: Umsetzungsstrategien mit Beteiligung diverser Expert*innen
Aufgrund der Rechtslage kann davon ausgegangen werden, dass dem Ziel der Vermeidung von Benachteiligung sowie der Herstellung von Barrierearmut mit Digitalisierung eine grundsätzliche Zustimmung widerfährt. Die Beispiele zu den Fragen der Prinzipien des Universal Designs zeigen Optionen auf, wie Lehrangebote durch die Integration digitaler Werkzeuge an die Diversität von Studierenden angepasst werden können und wie Digitalisierungsprozesse (virtuelle Lernräume) von Beginn an inklusiv geplant werden müssen. Das Potenzial scheint hoch. Wenn dies also bei vielen Prinzipien heute schon möglich ist, so darf auf das Angebot nicht aus Bequemlichkeit und Routine verzichtet werden, um alle Studierenden zu integrieren. So sollte beispielsweise in die Produktion von Lehrvideos ohne Untertitel und Audiodeskription nicht mehr investiert werden.
Zudem schreitet die technologische Entwicklung voran, sodass sich in kurzen Abständen neue Möglichkeiten für universal zugängliche Lehr- und Lernmaterialien und -methoden auftun. Dies wird aber mit Kosten verbunden sein. Allerdings fehlen oft gute Informationen, was an Technologie erhältlich ist und wie sie für barrierearme Lehre eingesetzt werden kann. Es ist schlicht bislang häufig noch ungeprüft, welche Software als barrierearm gelten kann. Es finden sich zwar Prüfkriterien, jedoch kaum Listen mit Aufzählung barrierearmer Software zur Auswahl. So zeigt sich ein Desiderat zur Erstellung von Recherchen und Prüfungen, um kriteriengestützte Erkenntnisse über barrierearme und datenschützende Software zu erhalten, die als pragmatische Entscheidungsgrundlage dienen könnten. Dies kann nicht durch einzelne Lehrende, sondern muss durch IT-Abteilungen erfolgen.
Bei der Verwirklichung der vorgestellten Beispiele sind unter anderem Fragen der Ressourceneffizienz verbunden mit der Finanzierung zu klären, um den eindeutigen Rechtsanspruch der Studierenden seitens der Hochschulen einzulösen. Zu klären ist, welche Verantwortung hier einzelne Lehrende haben und wo die Hochschule zentral ihrer Verantwortung gerecht werden muss. Bislang können also wenige der in Tab. 1 dargestellten Fragen so klar beantwortet werden, dass sie unkompliziert und simpel in konkrete Umsetzungsmöglichkeiten münden können. Für die Fragen nach Kompetenzerweiterung bei Lehrenden und den Ressourcen zum Beispiel für die Erstellung barrierearmer Dokumente müssen auch auf Hochschulebene systematische Lösungen gefunden werden. Die Finanzierung von studiengangsübergreifenden Unterstützungsstrukturen (Tutor*innen, Beauftragte) scheint sinnvoll. Zudem wird die Bereitstellung geeigneter barrierearmer und datenschützender Technologien sowie geeigneter Rahmenbedingungen, beispielsweise Lernplattformen, benötigt. Dies erfordert die Einbindung der IT-Abteilungen, die mehr und mehr von schlichten Bereitstellern von Technologie aufgrund der Bedeutung von IT für Lern-, Lehr- und Forschungsprozesse zu Mitgestaltern von Change-Prozessen bei Hochschulentwicklung und Hochschuldidaktik werden. Die eingangs dargestellte Rechtslage zur Vermeidung von Barrieren sowie zur Bereitstellung gleichberechtigter Zugänge zu Informationstechnologie muss auch mit den IT-Abteilungen diskutiert und zur Grundlage von Entscheidungsprozessen gemacht werden.
Hier wird deutlich, dass Digitalisierungsstrategien an Hochschulen mit diversen Akteur*innen entwickelt werden müssen: mit der IT-Abteilung, mit Datenschutzbeauftragten, mit Studierenden als Expert*innen ihrer selbst, mit Stabsstellen für Diversity Management, mit Behindertenbeauftragten.
Durch die Orientierung an Grundsätzen des Universal Designs kann dann Digitalisierung zur Gestaltung und Umsetzung von Werten in der Hochschulentwicklung beitragen und Hochschulen auf dem Weg zu einer inklusiven, diskriminierungsfreien und Diversität willkommen heißenden Hochschule unterstützen.
Notes
- 1.
Siehe: https://lecture-translator.kit.edu. Zugegriffen: 27.10.2020.
- 2.
Eine geeignete screenreaderkompatible Darstellungsform für mathematische Formeln ist zum Beispiel die Auszeichnungssprache MathML.
- 3.
Siehe: https://www.nikse.dk/subtitleedit/. Zugegriffen: 27.10.2020.
- 4.
PACS: https://access-for-all.ch/ch/pdf-werkstatt/pdf-accessibility-checker-pac.html. Zugegriffen: 27.10.2020.
- 5.
Open Broadcaster Software https://obsproject.com/. Zugegriffen: 27.10.2020.
- 6.
Z.B. Penfriend https://www.bhvd.de/produkte/pm/index.html#sub0_lnk oder NFC-Aufkleber mit vorgelesener Raumnummer https://www.nfc-tag-shop.de/info/nfc-anwendungsfaelle/nfc-alltagsanwendungen.html. Zugegriffen: 27.10.2020.
Literatur
Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32(3), 347–364. https://doi.org/10.1007/BF00138871.
BIK für alle. (2018). Leitfaden barrierefreie Online-Videos. https://www.bik-fuer-alle.de/leitfaden-barrierefreie-online-videos.html. Zugegriffen: 27. Okt. 2020
Claus, S., & Züllich, P. (Hg.). (2008). Universal Design: Unsere Zukunft gestalten = Design our future. Berlin: Internationales Design Zentrum. https://www.idz.de/dokumente/Universal_Design_Publikation.pdf. Zugegriffen: 27. Okt. 2020.
Digital informiert – im Job integriert. (o.J.). Barrierefreie Dokumente. https://di-ji.de/index.php?option=com_content&view=article&id=34%3Aleitfaden-word-2010&catid=28%3Abf-doks&Itemid=29&lang=de. Zugegriffen: 27. Okt. 2020.
Dobusch, L., Hofbauer, J., & Kreissl, K. (2012). Behinderung und Hochschule: Ungleichs- und interdependenztheoretische Ansätze zur Erklärung von Exklusionspraxis. In U. Klein & D. Heitzmann (Hrsg.), Hochschule und Diversity. Theoretische Zugänge und empirische Bestandsaufnahme (S. 69–85). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
e-teaching.org. (2018). Barrierefreiheit: Inklusives E-Learning. e-teaching.org. https://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/barrierefreiheit. Zugegriffen: 03. Juli 2020.
Fisseler, B. (2020). Grundlagen digitaler Barrierefreiheit. HFD-Blog https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/grundlagen-digitaler-Barrierefreiheit. Zugegriffen: 23. Okt. 2020.
Fisseler, B. (2015). Universal Design im Kontext von Inklusion und Teilhabe – Internationale Eindrücke und Perspektiven. Recht & Praxis der Rehabilitation, 2, 45–51.
Hochschulrektorenkonferenz. (2013). „Eine Hochschule für Alle“: Empfehlung der 6. Mitgliederversammlung der HRK am 21. April 2009 zum Studium mit Behinderung/chronischer Krankheit. Ergebnisse der Evaluation. https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/Auswertung_Evaluation_Eine_Hochschule_fuer_Alle.pdf. Zugegriffen: 20. März 2020.
Hollenweger, J., Gürber, S., & Keck, A. (2005). Menschen mit Behinderungen an Schweizer Hochschulen: Befunde und Empfehlungen. Nationales Forschungsprogramm, Probleme des Sozialstaats, 45. Zürich: Rüegger.
Klammer, U., & Ganseuer, C. (2015). Diversity Management: Kernaufgabe der künftigen Hochschulentwicklung. Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement, 16. Münster: Waxmann.
Klein, U. (Hrsg.). (2016). Diversity und Hochschule. Inklusive Hochschule: Neue Perspektiven für Praxis und Forschung (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
Klein, U., & Heitzmann, D. (Hrsg.). (2012). Hochschule und Diversity: Theoretische Zugänge und empirische Bestandsaufnahme (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
Manovich, L. (2002). The Language of New Media, (1st MIT Press pbk). Cambridge: MIT Press.
Meyer, A., Rose, D. H., & Gordon, D. (2016). Universal design for learning: Theory and practice. Wakefield: CAST Professional Publishing.
Poskowsky, J., Heißenberg, S., Zaussinger, S., & Brenner, J. (2018). beeinträchtigt studieren – best2: Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/17. Berlin: Deutsches Studentenwerk.
Powell, J. J., Felkendorff, K., & Hollenweger, J. (2008). Disability in the German, Swiss, and Austrian Higher Education Systems. In S. L. Gable & S. Danforth (Hrsg.), Disability & the politics of education (S. 517–540). Frankfurt: Lang.
Schuppener, S., Bernhardt, N., Hauser, M., & Poppe, F. (Hrsg.). (2014). Inklusion und Chancengleichheit: Diversity im Spiegel von Bildung und Didaktik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Scott, S. S., Mcguire, J. M., & Shaw, S. F. (2016). Universal design for instruction. Remedial and Special Education, 24(6), 369–379. https://doi.org/10.1177/07419325030240060801.
Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin. (o. J.). Berliner Standards für barrierefreie clientbasierte Software. https://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/digitale-barrierefreiheit/berliner-standards/artikel.807680.php. Zugegriffen: 29. Juni. 2020.
Sohn, N. (2018). Leitfaden barrierefreie Dokumente. Köln: TH Köln. https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/profil/lehre/leitfaden_barrierefreie_dokumente.pdf. Zugegriffen: 07. Mai 2020.
Story, M. F., Mueller, J., & Mace, R. L. (1998). The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities (Rev. ed.). Raleigh, NC: The Center for Universal Design. https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/pudfiletoc.htm. Zugegriffen: 27. Okt. 2020.
Weber, G., & Voegler, J. (2014). Inklusives E-Teaching. https://www.e-teaching.org/etresources/media/pdf/langtext_2014_weber_voegler_inklusives-eteaching.pdf. Zugegriffen: 07. Mai 2020
Welti, F. (2016). Die UN-BRK – Welche Bedeutung hat sie für die Hochschulen? In U. Klein (Hrsg.), Diversity und Hochschule. Inklusive Hochschule: Neue Perspektiven für Praxis und Forschung, (1. Aufl., S. 60–79). Weinheim: Beltz Juventa.
Zawacki-Richter, O. (2015). Zur Mediennutzung im Studium – Unter besonderer Berücksichtigung heterogener Studierender. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 18(3), 527–549. https://doi.org/10.1007/s11618-015-0618-6.
Zentrale Studienberatung der Justus-Liebig-Universität. (2015). Barrierefreie Lehre: Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ein Studium ermöglichen: Leitfaden für Dozentinnen und Dozenten an der Justus-Liebig-Universität. Gießen: Universität Gießen. https://www.uni-giessen.de/cms/studium/dateien/informationberatung/dozentenleitfaden. Zugegriffen: 22. Okt. 2018
Zentrales eLearning-Büro der Universität Hamburg (Hrsg.). (2014). Barrierefreies eLearning – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit [Sonderheft]. Hamburger eLearning-Magazin, 13, (S. 13). Hamburg: Universität Hamburg. https://www.uni-hamburg.de/elearning/hamburger-elearning-magazin-13.pdf . Zugegriffen: 21. Aug. 2016.
Zorn, C. (2020). NFC-Handy liest Türschild vor. Video. https://vimeo.com/473435570. Zugegriffen 29. Okt. 2020.
Zorn, I., & Weiser, Y. (2018). Inklusive Digitalisierung in der Hochschulbildung. Eine Handreichung für Lehrende an Hochschulen. Köln: TH Köln. https://epb.bibl.th-koeln.de/frontdoor/index/index/docId/1547. Zugegriffen: 27. Okt. 2020.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2021 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Zorn, I. (2021). Inklusion und Digitalisierung: Rechtliche Vorgaben und Potenziale für Hochschulen. In: Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_16
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_16
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-32848-1
Online ISBN: 978-3-658-32849-8
eBook Packages: Education and Social Work (German Language)