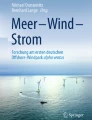Zusammenfassung
Der Ausbau der Windenergie findet zunehmend im Wald statt, da hier häufig windhöffige und damit ökonomisch attraktive Standorte zu finden sind. Allerdings ist hier der Konflikt mit dem Artenschutz im Allgemeinen und dem Fledermausschutz im Speziellen besonders hoch. In diesem Beitrag beleuchten wir vor dem Hintergrund des gesetzlich vorgegebenen normativen Rahmens den artenschutzrechtlichen Teil der Windkraftplanung im Wald mit Bezug auf Fledermäuse – von der Untersuchungsplanung über die eingesetzten Methoden bis zur Bewertung. Bezogen auf Fledermäuse stehen hier insbesondere die Vermeidung der direkten Tötung sowie die Verminderung der Beeinträchtigung ihres Lebensraums im Fokus der Betrachtung. Bundesland-spezifische Arbeitshilfen stecken den Untersuchungsumfang, die einzusetzenden Erfassungsmethoden und den räumlichen und zeitlichen Untersuchungsrahmen ab. Sie empfehlen zudem Maßnahmen zur Kompensation potenziell negativer Auswirkungen eines Eingriffs. Ihr Effekt auf die methodische Qualität der Fachbeiträge zu Fledermäusen ist jedoch gering. Meist kommen im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu Fledermäusen die Quartierbaumsuche, Netzfang, unterschiedliche Varianten des akustischen Monitorings (aktiv und passiv) sowie die Radiotelemetrie zum Einsatz. Insbesondere bei der bevorzugt empfohlenen akustischen Erfassung mindern zahlreiche methodische Probleme auf der technischen und der analytischen Ebene die Aussagekraft. Auch der Erfolg des Fangs von Fledermäusen mit Netzen hängt von zahlreichen Parametern ab. Die Quartierbaumerfassung lässt sich in ihrem Erfolg deutlich durch die Radiotelemetrie verbessern. Zur sinnvollen Quantifizierung des Lebensraumanspruchs einer Fledermauspopulation jedoch werden mittels Radiotelemetrie in der Regel zu wenige Tiere zu kurz untersucht. Die Bewertung der erhobenen Daten, hier gezeigt anhand akustisch ermittelter Aktivitätsdichten, erfolgt subjektiv, da Bewertungskriterien fehlen. Die am häufigsten empfohlenen und somit umgesetzten Methoden der Konfliktvermeidung und -minimierung sind CEF- (= Continued Ecological Function) und FCS-Maßnahmen (= Favourable Conservation Status) sowie das Gondelmonitoring und die selektive Abschaltung der WEA. Auch diese Maßnahmen entfalten z. T. Schwächen; die Bewahrung und Entwicklung von Waldstandorten als/zu ökologisch wertvollen Lebensräumen sowie die Verminderung der Schlagopferzahl durch spezielle Algorithmen (ProBat-Tool) sehen wir jedoch als sinnvoll an. Abschließend formulieren wir Anregungen zur Verbesserung und Objektivierung der Eingriffsplanung von WEA im Wald.
Summary
The development of wind energy is concentrating in forests, as windy and thus economically favourable sites can often be found here. However, the conflict with species conservation in general and bat conservation in particular is especially high in forests. We here examine the impact assessment on bats in the context of the legally prescribed normative framework in wind farm planning in the forest – from the study design to the methods used and the assessment itself. With regard to bats, the focus here is on avoiding direct killing and reducing the impairment of their habitat. Guidance documents for the German federal states define the extent of the surveys, the survey methods, and the spatial and temporal scope of a survey. They also recommend measures to compensate for potential negative impacts of wind energy plants (WEP). However, their effect on the quality of the expert reports on bats is low. In most cases, the search for roost trees, mist netting, different types of acoustic monitoring (active and passive) and radio tracking are used. In particular, numerous methodological problems at the technical and analytical levels reduce the validity of acoustic surveys. The success of mist netting bats also depends on numerous parameters. The success of roost tree surveys can be significantly improved by radio tracking. However, for a meaningful quantification of the habitat requirements of a bat population, radio tracking is usually used on too few animals for too short a time. The evaluation of the collected data, shown here on the basis of acoustically determined activity densities, is subjective because evaluation criteria are lacking. The most frequently recommended and thus implemented methods of conflict mitigation are CEF (= Continued Ecological Function and FCS (= Favourable Conservation Status) measures as well as nacelle monitoring and selective shut-down of wind turbines. These measures also show some weaknesses, but we consider the maintenance and development of forest sites as or into ecologically valuable habitats, as well as the reduction of the number of bat fatalities by means of specific algorithms (ProBat tool), to be sensible. Finally, we make suggestions for improving and objectifying the impact assessment of wind-energy facilities in forests.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
7.1 Einleitung
Der Klimawandel stellt die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts vor große Herausforderungen. Die Geschwindigkeit, mit der auf die Veränderungen des Klimas reagiert werden muss, ist beispiellos (IPCC 2021). Zur Verringerung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes muss insbesondere die Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern zugunsten erneuerbarer Energien verringert werden. Eine tragende Säule der Energiewende der Bundesrepublik Deutschland ist die Nutzung der Windenergie an Land (BMWi 2021). Zur Erreichung der Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland soll die an Land installierte Leistung der Windenergieanlagen (WEA) in den kommenden zehn Jahren von 54,4 GW auf 71 GW anwachsen (BMWi 2021). Dabei werden nicht nur ältere WEA durch neuere, effizientere WEA ersetzt (Repowering), auch die Anzahl der WEA in Deutschland muss zum Erreichen der Ziele erhöht werden (BMWi 2021).
7.1.1 Fledermäuse – eine durch WEA besonders gefährdete Tiergruppe
Die Fledertiere (Ordnung Chiroptera) sind mit weltweit über 1400 Arten (darunter 1200 Arten der Fledermäuse, früher als Unterordnung Microchiroptera bezeichnet) eine sehr diverse Säugetiergruppe (Burgin et al. 2018; Wilson und Mittermeier 2019), die in der Europäischen Union (EU) einen umfassenden Schutz genießt (FFH-RL; Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen). Dabei sind Fledermäuse unterschiedlichen Stressoren und Gefährdungen ausgesetzt, die den Erhaltungszustand der Populationen (Conservation Status) gefährden können (Frick et al. 2019). Neben dem Habitatverlust und indirekten Gefährdungen wie der Abnahme der Nahrungsgrundlage dieser insektenfressenden Arten (Hallmann et al. 2017; Seibold et al. 2019) ist in den vergangenen zwei Dekaden der Ausbau der Windenergie als eine zusätzliche Gefährdungsursache für mehrere mitteleuropäische Fledermausarten in den Fokus der Forschung gerückt (O’Shea et al. 2016; Voigt 2020).
Besonders betroffen sind wandernde Fledermausarten, die teilweise Zugstrecken von > 2000 km zurücklegen (Voigt et al. 2015; Frick et al. 2017; Richardson et al. 2021). Verhaltensstudien legen nahe, dass wandernde Tiere Windenergieanlagen aktiv anfliegen und nicht lediglich zufällig mit diesen kollidieren (Horn et al. 2008; Jameson und Willis 2014). Zugzeit und Paarungszeit der wandernden Fledermausarten fallen im Spätsommer und Herbst (August–Oktober) zusammen. Cryan et al. (2012) stellten fest, dass die in Nordamerika am häufigsten an WEA aufgefundenen Fledermausarten (Lasiurus cinereus, Lasiurus borealis, Lasionycteris noctivagans) zur Zeit der Kollision paarungsbereit waren. Während bei der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) außerhalb bekannter Reproduktionsgebiete das Geschlechterverhältnis der Schlagopfer ausgeglichen ist, ist im Reproduktionsgebiet der Anteil weiblicher Tiere und der von Jungtieren erhöht (Kruszynski et al. 2022). Zudem werden Effekte der potenziell durch Licht oder andere Effekte an WEA gelockten Insekten (z. B. Long et al. 2011, Cryan et al. 2014, Voigt 2021; siehe jedoch auch Trusch et al. 2020) sowie des Lichts selbst (unterschiedliche Wellenlängen; z. B. Voigt et al. 2017, 2018) diskutiert.
In Deutschland wird die Anzahl der je WEA zu Schaden kommenden Fledermäuse auf 2 bis 20 Tiere (Rydell et al. 2010) bzw. 10 bis 12 Tiere (Brinkmann et al. 2011) geschätzt. Diese Schätzungen beziehen sich auf WEA, die noch ohne einen kollisionsreduzierenden Betriebsalgorithmus betrieben werden. Die Anzahl der Kollisionsverluste, die sich aus dem aktuellen Ausbaustand von etwas über 28.200 WEA an Land in Deutschland ergibt (Deutsche Windguard 2021), verteilen sich vorwiegend auf den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula), die Rauhautfledermaus, die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), den Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) sowie die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) (Dürr 2021a). Da Fledermausarten außerhalb der Tropen niedrige Reproduktionsraten aufweisen (Barclay et al. 2004), müssen die durch WEA verursachten absoluten Verluste als ein populationsrelevanter Mortalitätsfaktor in Betracht gezogen werden. Die Populationsentwicklung der betroffenen Arten ist jedoch weitgehend unbekannt, insofern lassen sich die Auswirkungen solcher Individuenverluste auf die Überlebensfähigkeit der Populationen nicht abschließend bestimmen.
In Deutschland besteht ein Nord-Süd-Gefälle in der Dichte der WEA (Anzahl der WEA je Flächeneinheit) (IWES 2018). In den nördlichen Bundesländern ist der Ausbaustand im Vergleich höher und das Zubaupotenzial niedriger als in den zentralen und südlichen Bundesländern (IWES 2018). In diesen Teilen Deutschlands befinden sich Standorte mit hoher Windhöffigkeit in den Hochlagen der überwiegend bewaldeten Mittelgebirge. Somit liegen viele der wirtschaftlich interessantesten WEA-Standorte im Wald.
Der Lebensraum Wald erfüllt für Fledermäuse jedoch wichtige Funktionen. Zum einen bietet er Jagdhabitate für zahlreiche Fledermausarten, zum anderen stellen Bäume wichtige Quartierstrukturen dar, die als Tagesruheplatz, zur Aufzucht der Jungen oder zur Überwinterung aufgesucht werden. Die in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind, abhängig von der jeweiligen Lokalität und in unterschiedlicher Stärke, auf den Wald angewiesen.
7.2 Rechtlicher Rahmen
Die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) stellt nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 14 Satz 1 einen Eingriff in die Natur und Landschaft dar, da sie eine „… Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundfläche …“ darstellt sowie die „… Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes …“ beeinträchtigen kann. Insbesondere im Wald stellt die Errichtung einer WEA eine Umnutzung der Grundfläche dar (Forstwirtschaft → Windenergienutzung), weshalb weitere Vorschriften des Bundeswaldgesetzes und jeweiliger Landeswaldgesetze zu berücksichtigen sind. Dies schließt z. B. die Aufforstungspflicht für im Zuge des Eingriffs notwendige Rodungen ein.
Neben den allgemeinen Grundsätzen des Natur- und Landschaftsschutzes bildet das Artenschutzrecht eine wichtige Säule des BNatSchG. Da nahezu alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten den Wald als Quartier- und/oder Jagdhabitat nutzen (Hurst et al. 2016), ergibt sich an dieser Stelle ein Konfliktpotenzial zwischen WEA-Planungen im Wald und den Vorschriften des Artenschutzes. Die Artenschutzgesetze (§ 44 ff) setzen die Richtlinien zum Schutz der Natur der Europäischen Union in nationales Recht um. Kern des Artenschutzes sind die sogenannten Zugriffsverbote (§ 44 Satz (1)). Sie verbieten es, Handlungen vorzunehmen (z. B. Errichten und Betreiben einer WEA), die 1.) Tiere der besonders geschützten Arten töten, 2.), die Tiere der streng geschützten Arten erheblich stören, sodass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, und 3.) Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Arten beschädigen oder zerstören. Welche Arten in Deutschland besonders bzw. streng geschützt sind, wird wiederum durch europäische Richtlinien bestimmt, in denen die Arten auf den entsprechenden Anhängen der Vogelschutzrichtlinie bzw. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL ) aufgeführt sind. Im Anhang IV der FFH-RL sind alle europäischen Arten der Chiroptera genannt. Damit gehören alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sowohl zu der Kategorie besonders geschützter Arten als auch zu den streng geschützten Arten.
Auch wenn sich das Tötungsverbot im BNatSchG auf das Individuum bezieht, regelt das Gesetz im § 44 Abs. 5 Satz 1, dass ein Tötungsverbot nicht vorliegt, wenn der Eingriff das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Individuen nicht signifikant erhöht. Die Frage nach der Signifikanz beantwortet das Gesetz nicht, diese muss eingriffsspezifisch abgewogen werden. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Beschluss vom 23.10.2018 festgestellt:
„In grundrechtsrelevanten Bereichen darf der Gesetzgeber Verwaltung und Gerichten nicht ohne weitere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen „Erkenntnisvakuum“ übertragen, sondern muss jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung sorgen.“ (BVerfG 2018)
Damit wurde dem Gesetzgeber indirekt auferlegt, zumindest mit einer untergesetzlichen Maßstabsbildung Klarheit über den Signifikanzbegriff zu schaffen. Dennoch drehen sich aktuelle Debatten zur Definition des Signifikanzkriteriums überwiegend um Vögel (UMK 2020). Diese Klärung muss für Fledermäuse also zunächst noch offenbleiben, muss letztlich gemäß BVerfG aber ebenfalls erfolgen.
Das Störungsverbot bezieht sich explizit auf lokale Populationen, wobei diese Abgrenzung eine Besonderheit im deutschen Recht darstellt, da es die Formulierung der lokalen Population im Europarecht nicht gibt. Im Falle von Fledermäusen wird von der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA 2009) beispielhaft die Wochenstubenkolonie als lokale Population abgegrenzt (zur weiteren Definition des Begriffs „lokale Population“ vgl. Abschn. 2.2). Eingriffe dürfen eine Wochenstubenkolonie also nicht in dem Maße stören, dass diese hierdurch geschädigt wird.
Das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegt des Weiteren nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff betreffenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. Damit stehen dem Projektträger, der einen Eingriff realisieren will, Instrumente zur Verfügung, die das Eintreten von Verbotstatbeständen verhindern können. Das BNatSchG verlangt von einem Eingriff, dass negative Auswirkungen zu vermeiden sind. Können die Auswirkungen nicht vermieden werden, sind diese zu minimieren. Für die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann zunächst über CEF-Maßnahmen ein Ausgleich geschaffen werden, um die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang zu erhalten. Nur wenn dies nicht gelingt, kann der Weg über die artenschutzrechtliche Ausnahme erwogen werden (Lukas 2016).
Grundsätzlich sehen die FFH-Richtlinie, sowie das deutsche Artenschutzrecht im Falle von Fledermäusen, die Möglichkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme von den Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG vor. Für die Nutzung der Ausnahme muss aber ein zugelassener Grund vorliegen und es müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. So ist das überwiegende öffentliche Interesse, auch wirtschaftlicher Art, ein zugelassener Ausnahmegrund, der letztlich auch auf den Bau von WEA anwendbar ist. Dieser Ausnahmegrund in § 45 Abs. 7 BNatSchG ist der FFH-Richtlinie entnommen. Demnach gilt er (europarechtskonform) für Fledermäuse, da deren Schutz in der FFH-Richtlinie geregelt ist. Mit Blick auf Vögel ist die Anwendung des Ausnahmegrunds „öffentliches Interesse (auch wirtschaftlicher Art)“ allerdings nicht europarechtskonform anwendbar, da es eine entsprechende Regelung in der Vogelschutzrichtlinie nicht gibt (Wagner 2021).
Weitere Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahme sind in jedem Einzelfall die Alternativlosigkeit und die Gewährleistung, dass sich der Zustand der Populationen nicht verschlechtert und auch die Erreichung des guten Erhaltungszustands nicht gefährdet wird. Die Beweislast liegt hier beim Eingreifenden. Die Alternativlosigkeit muss im immissionsrechtlichen Verfahren dargelegt werden; hierbei geht es nicht darum, dass jedwede Alternative ausgeschlossen sein muss, es muss aber hinreichend dargelegt werden, dass keine zumutbaren Alternativen vorhanden sind. Im Falle von WEA scheint die Nutzung der Ausnahme also zwingend an eine restriktive Flächenplanung (z. B. Regionalplanung mit 2 %-Vorrangfläche und Ausschlusswirkung für den Rest) gekoppelt zu sein. In jeden Fall muss der Antragsteller darlegen, dass keine zumutbaren Alternativflächen mit geringerem Konfliktpotenzial zur Verfügung stehen.
Das Naturschutzrecht lässt offen, auf welche Population sich die Ausnahme bezieht. Da die Debatte um die Abgrenzung von Populationen nicht abschließend geklärt ist, muss dies hier offenbleiben; es wird aber an anderer Stelle diskutiert (Lindemann et al. o. J.). Einen Hinweis kann aber der Erhaltungszustand gemäß der FFH-Richtlinie geben. Urteile zum Wolf zeigen, dass im Rahmen der Rechtsprechung regelmäßig auf diesen abgezielt wird.
Da der Erhaltungszustand vieler in Deutschland vorkommender Fledermausarten als ungünstig beurteilt werden muss (BfN 2020) und die Bestandstrends häufig stagnierend oder sogar abnehmend sind, ist es fraglich, ob eine Ausnahmegenehmigung vom individuenbezogenen Tötungsverbot für viele Arten anwendbar sein kann. Dazu kommt die Problematik, dass Fledermauspopulationen, insbesondere von wandernden Arten, nicht abgrenzbar sind und so die Bewertung der Auswirkungen einer Ausnahme nicht vorgenommen werden kann (Lindemann et al. o. J.).
7.3 Ablauf und Durchführung eines Planungs- und Zulassungsverfahrens
Vor dem voranstehend skizzierten normativen Hintergrund muss die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), die Teil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bei der Planung von WEA ist, klären, welche Bestimmungen im Einzelfall zu berücksichtigen sind, und verschiedene Prüffragen abarbeiten (Trautner 2020). Zunächst muss die Frage beantwortet werden, ob der Eingriff Beeinträchtigungen hervorrufen kann, die in der Lage sind, einen Verbotstatbestand zu erfüllen:
-
Wenn ja, ist zu bestimmen, welche Arten betroffen sein könnten.
-
Bezogen auf diese Arten muss beantwortet werden, ob die Beeinträchtigung entscheidungserheblich sein könnte.
-
Ist eine Beeinträchtigung möglicherweise entscheidungserheblich, muss diese, nach der Kaskade „Vermeiden-Mindern-Ausgleichen“ so stark reduziert werden, dass sie nicht mehr verbotsrelevant ist.
-
Erst wenn auch dies nicht möglich ist, muss beantwortet werden, ob eine Ausnahme von den einschlägigen Vorschriften möglich ist.
Da die saP Teil der Antragsunterlagen ist, die ein:e Projektierer:in der Genehmigungsbehörde vorlegen muss, hat diese:r die Freiheit, selbst den/die Gutachter zu bestimmen. Diese:r wird wiederum vom Projektierenden direkt bezahlt.
Um den Sachverhalt einzelfallbezogen zu klären, muss der/die Gutachter:in gegebenenfalls Untersuchungen durchführen und zunächst das etwaige Vorkommen von relevanten Arten erheben. Dazu stellen die Bundesländer Arbeitshilfen (aus Gründen der Praktikabilität reduzieren wir hier die unterschiedlichen Benennungen auf diesen einen Begriff) zur Verfügung, die ein Prüfschema mit Erfassungsmethoden und -zeiträumen vorgeben (Hurst et al. 2015). Das Ergebnis dieser Erfassungen bildet die Grundlage für die Bewertung artenschutzrelevanter Beeinträchtigungen des Eingriffs.
7.4 Ziele dieses Beitrags
Der erwartete Erfolg des gesetzlich vorgegebenen Ablaufs des Zulassungsverfahrens gründet auf der Prämisse, dass sämtliche, im Wesentlichen konsekutiven Teilaspekte des Verfahrens nach dem jeweils aktuellen Stand des Wissens und der Technik in eine ergebnisoffene und objektive Eingriffsbewertung münden. Durch dieses Vorsorgeprinzip soll den durch gesetzliche Vorgaben definierten Belangen des Natur- und Artenschutzes Rechnung getragen werden, unter gleichzeitiger Wahrung der Planungssicherheit für Projektierer.
Im vorliegenden Beitrag beleuchten wir den Planungs- und Bewertungsprozess in Bezug auf die Errichtung von WEA im Wald und ihre potenziellen Auswirkungen auf Fledermäuse. Dieser Prozess, der durch den im Rahmen der saP zu erstellenden Fachbeitrag zu Fledermäusen dokumentiert wird, versucht i. d. R. aus vor dem Bau und der Inbetriebnahme der jeweiligen WEA erhobenen Daten die Beeinträchtigung lokaler Fledermauspopulationen nach Bau und Inbetriebnahme abzuschätzen. Inwieweit jedoch die Fledermausaktivitäten an der jeweiligen Anlage noch den vorher gemessenen Aktivitäten entsprechen, bleibt offen. Daher besteht für die genehmigende Behörde die Option, ein nach dem Bau und der Inbetriebnahme durchzuführendes Monitoring zu verlangen, das ein Nachsteuern bei den i. d. R. empfohlenen Maßnahmen zur Verminderung oder gar Vermeidung von Schäden an Fledermäusen und ihren Populationen ermöglicht.
In diesem Beitrag hinterfragen wir die Schritte des Prozesses der Eingriffsplanung bei der Planung von WEA im Wald im Hinblick auf Fledermäuse – von der Untersuchungsplanung bis hin zur Konfliktbewertung und -vermeidung (siehe auch Hurst et al. 2020). Wir beleuchten die Möglichkeiten und Grenzen der verwendeten Methoden, sowohl im Hinblick auf die anvisierte Bewertung als auch den Bewertungsprozess selbst. Kompensatorische Maßnahmen, die der Konfliktminderung und damit der Genehmigungsfähigkeit eines Eingriffes dienen, werden ebenso betrachtet wie länderspezifische Arbeitshilfen, welche zum Ziel haben, den gesamten Bearbeitungsprozess zu standardisieren und damit – im Idealfall – zu objektivieren. Wir berufen uns im Wesentlichen auf publizierte Quellen, um dem Ziel einer „evidenzbasierten“ Betrachtung zu entsprechen. Gleichwohl beziehen wir uns in einigen wenigen Fällen auch auf noch nicht publizierte Erkenntnisse, die wir selbst im Zuge aktueller Forschungsprojekte erbracht haben, die im Rahmen von nicht publizierten universitären Abschlussarbeiten erarbeitet wurden oder die in Form von in Fachjournalen eingereichten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch nicht final akzeptierten Beiträgen präsentiert werden. Hiermit stellen wir eine größtmögliche Transparenz bei der Bewertung des gesamten Planungsverfahrens her. Abschließend unterbreiten wir Vorschläge, wie der Planungsprozess für WEA im Wald in Bezug auf Fledermäuse optimiert werden kann.
7.5 Planung der Untersuchung
7.5.1 Der Relevanzcheck – welche Arten sind betroffen?
In Deutschland reproduzieren aktuell 24 Fledermausarten (Meinig et al. 2020). Je nach Ökologie, Verhalten und Raumnutzung sind sie unterschiedlich vom Bau und Betrieb einer WEA im Wald betroffen. Dabei sind direkte und indirekte Beeinträchtigungen zu unterscheiden.
Fledermäuse können durch Kollision mit einem Rotor oder ohne direkten Kontakt durch ein Barotrauma getötet werden (Baerwald et al. 2008). Die unmittelbare Tötung betrifft vor allem hochfliegende Arten, insbesondere während der Migrationsphase (Dürr 2021a, b, Lehnert et al. 2014). 60 % der in Deutschland registrierten Schlagopfer verteilen sich auf lediglich zwei Arten: den Großen Abendsegler (32,0 %) und die Rauhautfledermaus (28,5 %). Andere im freien Luftraum jagende Arten wie der Kleinabendsegler und die Zweifarbfledermaus machen 5,0 % bzw. 3,8 % der gefundenen Schlagopfer aus (Dürr 2021a). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Populationsgrößen der Arten weitestgehend unbekannt sind und sich der Anteil verunglückter Tiere proportional zur Populationsgröße verhalten könnte (Lindemann et al. 2018). Die mit Abstand häufigste Fledermausart Deutschlands ist die Zwergfledermaus (Meinig et al. 2020). Ihr Anteil an der Gesamtzahl aufgefundener Schlagopfer beträgt 19,4 % (Dürr 2021a). Damit wird der größte Teil der Schlagopfer von Arten gestellt, die wenig strukturgebunden und vegetationsnah im freien Luftraum Insekten jagen (Dietz und Kiefer 2020). Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den meisten veröffentlichten Schlagopfern um Zufallsfunde handelt. Die bundesweite Schlagopferkartei (Dürr 2021a) ist auf die Meldung von Schlagopfern angewiesen. Da jedoch Schlagopfersuchen bundesweit sehr unterschiedlich gehandhabt werden und zudem die Arbeitshilfen dies äußerst unterschiedlich handhaben bzw. einige die Schlagopfersuche gar ablehnen (Tab. 7.1), könnten auch regionale Unterschiede bei den Nachsuchen und der Meldung zum Tragen kommen.
 = empfohlen;
= empfohlen;  = eingeschränkt empfohlen;
= eingeschränkt empfohlen;  = nicht empfohlen, k.A. = keine Angaben
= nicht empfohlen, k.A. = keine AngabenInsbesondere im Wald kann sich zudem eine indirekte Beeinträchtigung durch den Bau einer WEA ergeben. Zu den baubedingten Auswirkungen gehören die Baufeldfreimachung mit der Einrichtung des Anlagenstandortes, der Kranstellflächen sowie den Zuwegungen. Je Anlage können dabei 0,2 bis 1 ha Wald gerodet werden. Auch kurzfristige Auswirkungen wie das Ausleuchten von Baustellen und Kollision mit Baustellenverkehr zählen zu den baubedingten Effekten.
Zwar machen Baumquartier-bewohnende Fledermausarten aus den Gattungen Myotis, Barbastella und Plecotus nur einen kleinen Teil der aufgefundenen Schlagopfer aus, aber sämtliche europäische Arten dieser Gattungen (Ausnahme: Nymphenfledermaus, Myotis alcathoe; diese Art wird erst seit 2001 als eigenständig anerkannt (Helversen et al. 2001) und ist anhand äußerlicher Merkmale nur schwer von der Kleinen Bartfledermaus, Myotis mystacinus, zu unterscheiden) konnten bereits als Schlagopfer gefunden werden (Dürr 2021b). Bei diesen Arten stellt der Verlust von Habitatstrukturen wie Baumquartieren und waldtypischen Teilhabitaten (Kleingewässer, Altholzinseln etc.) in der Planung zu berücksichtigende Beeinträchtigungen dar. Der Verlust von strukturgebenden Landschaftselementen und geeigneten Nahrungshabitaten betrifft prinzipiell sämtliche Fledermausarten, die den Wald im Jahresverlauf frequentieren. Dabei können nicht-wandernde Arten, die während der gesamten Fledermaussaison den Raum nutzen, durch den Verlust von Nahrungshabitaten und die Fragmentierung der Landschaft besonders betroffen sein (Barré et al. 2018).
7.5.2 Flächenabgrenzung und Verwendung des Populationsbegriffs
In der Eingriffsplanung stellt sich darüber hinaus die Flächenabgrenzung des Untersuchungsraumes im Falle von Fledermäusen als schwierig dar. Während das Tötungsverbot einen eindeutigen Individuenbezug hat, werden das Störungsverbot populationsbezogen und das Verbot der Zerstörung von Nist- und Ruhestätten objektbezogen angewandt. Im letzteren Fall kommt das Verbot nicht zum Tragen, wenn die ökologische Funktion im Umkreis erhalten bleibt (Lukas 2016).
Bezugsgröße für die lokale Population ist laut LANA (2009) und Bundesamt für Naturschutz (BfN; https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeugetiere-fledermaeuse.html; zuletzt aufgerufen am 24.01.2022) im Sommer die Wochenstubenkolonie, da diese bei Fledermäusen i. d. R. klar abgrenzbar ist. Untersuchungen müssen also so konzipiert sein, dass sie den Lebensraum aller betroffenen Wochenstubenkolonien untersuchen. Da gerade Waldarten oftmals in sogenannten Fission-Fusion-Gesellschaften leben (s. u.), bedeutet dies, dass die Lebensräume der gesamten Kolonie zu betrachten sind. Die Einbeziehung aller Quartierbäume der Kolonie ist also nötig, wie auch das BfN festhält. Dies kann mit teils großem Aufwand verbunden sein (s. u.). Auch im Falle der Quartiere muss das System aller Quartierbäume betrachtet werden, um zu prüfen, ob die ökologische Funktion im Falle des Wegfalls einzelner Bäume erhalten bleibt.
Darüber hinaus wird seitens des BfN deutlich gemacht, dass die Männchen während des Sommers ebenfalls eine lokale Population bilden. Da diese aber entgegen der Weibchen schwer abgrenzbar ist, wird die Abgrenzung über Lebensräume empfohlen. Weitere Abgrenzungen von lokalen Populationen sind Männchen und Weibchen in einem Paarungsquartier sowie überwinternde Tiere im Winterquartier (ebenfalls BfN; s. o.). Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die lokale Population als die kleinstmögliche im Rahmen einer Untersuchung noch abgrenzbare funktionale Populationseinheit anzusehen ist (Lindemann et al. o. J.).
Bei Individuen auf der Wanderung fällt aufgrund der fehlenden Möglichkeiten einer Populationsabgrenzung in dieser Zeit (Lindemann et al. o. J.) die Betrachtung des Störungsverbots, z. B. etwaiger Ruhestätten, weg. Die Betrachtung konzentriert sich somit zwangsläufig auf das Tötungsverbot (Lindemann et al. o. J.). Eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG erscheint vor diesem Hintergrund für Individuen auf der Wanderung unmöglich, da die Ausnahme stets auf die Auswirkung auf die Population Bezug nimmt, diese aber im Zuge der faunistischen Erhebungen im Planungsverfahren nicht abgrenzbar ist (Lindemann et al. o. J.).
7.5.3 Arbeitshilfen
Um die Durchführung der Fledermauserfassung im Zuge der Eingriffsplanung bei WEA zu vereinheitlichen und eine hohe Qualität der diesbezüglichen Fachbeiträge sicherzustellen, haben mittlerweile fast alle Bundesländer landesspezifische Arbeitshilfen veröffentlicht (sie fehlen lediglich in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie im Flächenstaat Sachsen). In diesen werden Inhalte und Umfang der fledermausspezifischen Fachbeiträge festgelegt (Tab. 7.1). Eine bundesweite Arbeitshilfe, welche die fachlichen Anforderungen überregional nach den anerkannten Regeln der Technik festlegt, existiert derzeit nicht (siehe auch Hurst et al. 2015), gleichwohl finden sich gelegentlich Hinweise auf jeweils andere Arbeitshilfen. Nicht alle Arbeitshilfen sind rechtsverbindlich (Hurst et al. 2015), gleichwohl entfalten sie verwaltungsinterne Bindungswirkungen. Die Arbeitshilfen der Bundesländer (im Folgenden nur noch als „AH-“ mit dem jeweiligen Länderkürzel zitiert) unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Aktualität (von 2008 der AH-SH bis 2020 der AH-HE). Auch bei den vorgeschlagenen Erfassungsmethoden gibt es große Unterschiede, die jedoch nur z. T. dem jeweiligen Erscheinungsdatum und damit dem zu diesem Zeitpunkt jeweils vorliegenden Stand der Technik geschuldet sein dürften. So basieren die AH-RP und AH-SL auf der gleichen von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland erarbeiteten Vorlage (die sich methodisch weitgehend auf Doerpinghaus et al. 2005 bezieht), inhaltlich jedoch weichen sie in einer Reihe von Punkten voneinander ab. Zudem wird in zwei Bundesländern die Installation von WEA im Wald derzeit explizit ausgeschlossen (Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt), insofern ist das dort empfohlene Methodenspektrum nur auf die Erfassung im Offenland ausgelegt. (Letzteres gilt auch für die Arbeitshilfen von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, obwohl dort der Bau von WEA im Wald grundsätzlich möglich ist).
Akustisches Monitoring am Boden wird durchgängig von allen Arbeitshilfen gefordert, während eine akustische Aktivitätserfassung zumindest in Höhe der Baumkronen bereits vor der Inbetriebnahme einer WEA deutlich seltener empfohlen wird. Netzfänge zur erweiterten Erfassung des Artenspektrums sowie radiotelemetrische Quartiersuche werden ebenfalls deutlich seltener empfohlen. Explizit ausgeschlossen wird von einigen Arbeitshilfen lediglich die Schlagopfersuche (Tab. 7.1). Das Gondelmonitoring sowie temporäre Abschaltungen können als empfohlene Standardmaßnahmen zur Minimierung des Eingriffs durch WEA angesehen werden. Hierbei geben acht Arbeitshilfen konkrete Schwellenwerte vor, während vier Arbeitshilfen diese art- und/oder standortspezifisch definieren. Die Empfehlungen zu CEF-/FCS-Maßnahmen fallen sehr heterogen aus.
7.6 Umsetzung der Untersuchung
7.6.1 Effekte der Arbeitshilfen
Inwieweit Arbeitshilfen die Qualität von Fachgutachten beeinflussen, wurde bislang kaum untersucht. Kurtze (2013) setzte sich auf Basis weniger (N=13) Fachgutachten kritisch mit deren methodischer und inhaltlicher Qualität auseinander. Er stufte sie trotz des Vorliegens geeigneter Arbeitshilfen als „mehrfach unklar, unzulänglich oder lückenhaft“ ein, den Effekt der Arbeitshilfen auf diese Gutachten konnte er jedoch nicht beleuchten. Basierend auf 156 zu Windkraft und Fledermäusen erstellten Gutachten bewerteten Gebhard et al. (2016) deren Defizite in Bezug auf einen von ihnen selbst definierten „Mindeststandard“ (gewissermaßen als kleinster gemeinsamer Nenner des „Stand der Technik“ aus den zu diesem Zeitpunkt existierenden bundesdeutschen Arbeitshilfen abgeleitet). Sie wiesen auf erhebliche und statistisch signifikante Unterschiede im Gesamterfüllungsgrad der Mindeststandards zwischen den Bundesländern hin. Berücksichtigt man zudem, dass die in den Bundesländern geltenden Arbeitshilfen z. T. umfangreichere Untersuchungen fordern als der von Gebhard et al. (2016) extrahierte „Mindeststandard“, so liegen die jeweiligen Erfüllungsgrade sogar niedriger. Ebenso gab es z. T. deutliche Unterschiede in Einzelaspekten, wie z. B. der Definition des Untersuchungsrahmens, der Konfliktbewertung sowie der Betrachtung der Verbotstatbestände. Eine durchschnittliche generelle Verbesserung der Fachgutachten im Laufe der Zeit (2005–2013), die potenziell mit der vermehrten Einführung von Arbeitshilfen hätte erklärt werden können, wiesen sie nicht nach. Allerdings konnten sie zeigen, dass Fachgutachten aus Bundesländern mit Arbeitshilfe einen geringen, aber signifikant höheren Erfüllungsgrad bezogen auf die von Gebhard et al. (2016) extrahierten Mindeststandards hinsichtlich des Gesamtergebnisses sowie der Bewertungsebene „Untersuchungsrahmen“ erreichen als solche aus Bundesländern ohne Arbeitshilfe.
Die Analyse von Gebhard et al. (2016) offenbarte erstmals umfängliche Defizite bei der methodischen Durchführung von Fachgutachten zur Verminderung des Konfliktes zwischen WEAs und Fledermäusen. Nicht untersucht wurden in ihrer Arbeit jedoch die aus den jeweils erfassten Daten abgeleitete Bewertung der Schwere eines Eingriffs sowie die daraus abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen.
7.6.2 Bewertung der Erfassungsmethoden
Allen verfügbaren Methoden ist gemeinsam, dass sie selektiv für Arten sind und sich meist nur für eingeschränkte Fragestellungen eignen (Runkel et al. 2018). Insofern empfiehlt sich stets die Anwendung unterschiedlicher Methoden (Hurst et al. 2015; Runkel et al. 2018).
7.6.2.1 Quartierbaumerfassung
Insbesondere im Wald kommt dem potenziellen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten eine wichtige Bedeutung zu, da den Fledermäusen an Bäumen zahlreiche Strukturen als Quartiere zur Verfügung stehen (Übersicht bei Regnery et al. 2013a). Fortpflanzungsstätten können in diesem Zusammenhang sowohl Wochenstubenquartiere als auch Balzquartiere mit Paarungsgemeinschaften sein. Ebenso finden sich im Wald Zwischenquartiere, Tagesruheplätze von Männchen sowie in Baumhöhlen auch Winterschlafgemeinschaften, z. B. des Großen Abendseglers.
Eine erste Abschätzung des Quartierpotenzials eines Waldgebietes kann auch ohne direkte Untersuchung der Fledermäuse (Telemetrie, akustische Erfassung der Balzgesänge) vorgenommen werden. Indikatoren zum Vorkommen von Mikrohabitaten an Bäumen sind der Stammdurchmesser, das Vorkommen von stehendem Totholz und das Vorhandensein von Laubbaumarten (Regnery et al. 2013b). Lokal können jedoch auch Nadelbäume geeignete Quartiere für verschiedene Fledermausarten bieten (z. B. Mortimer (2006); Graf und Frede 2013; Hillen und Veith 2013; Hillen und Veith 2013).
Absolute Schwellenwerte für Stammdurchmesser erweisen sich als weniger geeignet, da z. B. Spechte als Höhlenbauer jeweils die relativ mächtigsten Bäume auswählen, um Höhlen anzulegen (Basile et al. 2020). Auch wenn nicht alle baumbewohnenden Fledermausarten Baumhöhlen bevorzugen (so nutzt z. B. die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) gerne Spaltenquartiere unter abstehender Rinde; Hillen et al. 2010), so ist dennoch insbesondere das Angebot an Spechthöhlen für das Vorkommen von Fledermäusen im Wald von Bedeutung (Kotowska et al. 2020; Singer et al. 2021). Diese werden von Fledermäusen überwiegend unterhalb des Kronenansatzes als Quartier ausgewählt (Vonhof und Barclay 1996), daher können diese Strukturen vom Boden aus erfasst und zur Einschätzung des Quartierpotenzials eines Baumbestandes herangezogen werden. Arten, die bevorzugt unter abstehender Rinde oder Rissen im Holz Quartier beziehen, sind besonders zu berücksichtigen. Der Umkehrschluss, dass das Fehlen von vom Boden aus sichtbaren potenziellen Quartierstrukturen das Vorkommen von Fledermausquartieren ausschließt, ist jedoch nicht zulässig. Auch augenscheinlich ungeeignete Bäume können Quartierstrukturen aufweisen. Eine Quartierbaumerfassung erlaubt daher zwar die Identifizierung von Flächen mit gesteigertem Konfliktpotenzial, sie ersetzt aber keine Fledermaus-zentrierte Erfassung.
7.6.2.2 Netzfang
Zur spezifischen Einschätzung der Bedeutung eines Waldgebietes als Lebensraum für Fledermäuse ist je nach Fragestellung der Fang der Tiere notwendig. Während die akustische Erfassung von Fledermäusen umfangreiche quantitative Daten liefert, können Fledermausfänge qualitative Daten ergänzen. In komplex strukturierten Habitaten wie dem Wald können Fledermausarten kryptisch (d. h. nicht arttypisch) rufen (Hiryua et al. 2010; Stidsholt et al. 2021) und damit eine Artbestimmung mit zusätzlichen Unsicherheiten behaften. Sehr leise rufende Arten können bei einer akustischen Erfassung unterrepräsentiert sein. Damit führt der Fang der Tiere, ergänzend zur akustischen Erfassung, meist zu einer höheren Zahl nachgewiesener Arten (MacSwiney et al. 2008) und akustisch nicht unterscheidbare Arten können sicher identifiziert werden (siehe auch Zahn et al. 2021a). Insofern sprachen die von Voigt et al. (2020) befragten Expert:innen dem Netzfang im Wald (im Gegensatz zum Offenland) eine hohe Wertigkeit zu, insbesondere zur besonders kritischen Wochenstubenzeit. Da Netzfangdaten jedoch i. d. R. keine belastbaren Aussagen über die absolute Häufigkeit von Arten liefern, ist ein abschließender Rückschluss auf eine Gefährdung von Arten nicht möglich.
Durch den Fang können das Geschlecht und der Reproduktionsstatus der in einem Gebiet vorkommenden Fledermäuse festgestellt werden (s. a. Voigt et al. 2020). Diese Daten komplettieren die Informationen, die für eine Folgenabschätzung eines Eingriffs auf die Fledermausfauna notwendig sind. Zudem ist der Fang von Fledermäusen mit Netzen zur Untersuchung ihrer Raumnutzung oder zum Auffinden von Quartieren mittels Radiotelemetrie zwingend notwendig. Nur so können i. d. R. Fledermausquartiere innerhalb oder außerhalb einer Eingriffsfläche nachgewiesen und im Rahmen der Eingriffsplanung adäquat berücksichtigt werden.
Bei Netzfängen muss berücksichtigt werden, dass sie je nach verwendetem Netzmaterial und verwendeter Netzhöhe unterschiedlich effizient sind. Fledermäuse besitzen die Fähigkeit, feine Strukturen zu orten und zu vermeiden (Vanderelst et al. 2015; Sändig et al. 2014). Feinere Fäden erhöhen daher den Fangerfolg, und die Verwendung von stärkeren Fäden kann somit zu einer systematischen Unterschätzung der Artenvielfalt an einem Standort führen (Chaves-Ramierez et al. 2022; Marques et al. 2013; siehe jedoch Ferreira et al. 2021, die zeigten, dass bei Fledermausfängen in westafrikanischen Kakaoplantagen die ultrafeinen Netze den geringsten Fangerfolg erbrachten).
Die Wahl des Standortes der Netze ist der Erfahrung des Gutachters/der Gutachterin überlassen, sie hat allerdings einen wesentlichen Einfluss auf den Fangerfolg; diesbezügliche Empfehlung, auch zu den Netzmaterialien, sollten in die Arbeitshilfen aufgenommen werden (s. a. auch KNE 2019). Insbesondere der Fang an Wasserflächen und Grenzflächen zwischen Biotopen im Wald können den Erfolg eines Netzfangs erhöhen (Gukasova und Vlaschenko 2011; Francis 1989; Kunz und Parsons 2009; Kingston et al. 2003). Netze werden in der Regel bodennah aufgebaut und decken eine Höhe bis zu 10 Metern ab. Zwar gibt es auch spezielle Netzkonstruktionen, die höher aufgebaut werden können (Holbech 2020), deren Einsatz ist allerdings mit einem hohen Aufwand verbunden und je nach Waldstruktur nicht immer möglich. Da die Höhe der Netze einen signifikanten Einfluss auf den Fangerfolg (Angetter 2014) und damit die Datenqualität in der Eingriffsplanung hat, ist eine an den Standort angepasste Netzkonfiguration zu empfehlen (so hoch wie möglich) und an für Fledermäusen attraktiven Mikrohabitaten wie Gewässern und Grenzflächen vorzunehmen.
Um den Fangerfolg zusätzlich zu erhöhen, lassen sich Lockgeräte verwenden. Dabei werden Sozialrufe sowie Stresslaute und Beutefang-Rufsequenzen (sgn. „Feedingbuzzes“) abgespielt und Fledermäuse damit in die Netze gelockt. Für einige Arten wurde ein hierdurch erhöhter Fangerfolg bereits nachgewiesen (Hill und Greenway 2005; Lintott et al. 2013; Hill et al. 2015; Samoray et al. 2019). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wirkraum solcher Lockgeräte beschränkt ist, da die Ultraschallanteile der abgespielten Rufe in der Atmosphäre stark gedämpft werden. Es werden keine Fledermäuse von außerhalb des Untersuchungsraums über weite Strecken angelockt. Lockgeräte sind aber in der Lage, hochfliegende Arten, die bei der Eingriffsplanung zum Bau einer WEA besonders im Fokus stehen, in die Netze zu locken (Braun De Torrez et al. 2017). In den Arbeitshilfen wird hierauf leider kaum hingewiesen.
7.6.2.3 Akustische Erfassung
Die akustische Erfassung von Fledermäusen hat sich als unverzichtbares Instrument der Eingriffsplanung bei WEA etabliert. Sie wird von allen Arbeitshilfen empfohlen bzw. vorgeschrieben (Tab. 7.1) und macht häufig einen Großteil des Erfassungsumfangs aus. Darüber hinaus liefert sie umfangreiche quantitative Daten, was einerseits eine vermeintliche Objektivität und andererseits eine statistische Absicherung der Ergebnisse suggerieren könnte. Die unterschiedlichen Methoden der akustischen Datenerfassung und -auswertung werden von Experten jedoch teils kritisch gesehen.
Akustisch erfasste Daten beschreiben grundsätzlich nur Aktivitätsdichten. Deren Bezug zur Größe der jeweiligen artspezifischen Population wird zwar implizit angenommen, dies ist jedoch im Einzelfall weder prüfbar noch zweifelsfrei ableitbar. Ohnehin ist die Größe von Fledermauspopulationen nur unter wenigen Umständen messbar; in der Regel beschränkt sich dies auf die Zählung von in Quartieren auffindbarer bzw. von aus diesen ausfliegenden Tieren (z. B. O’Shea et al. 2003). In Wäldern sind solche Quartiere ohnehin weitgehend auf Bäume beschränkt. Diese sind potenziell mittels Radiotelemetrie auffindbar (s. u.), allerdings ist der Aufwand hierfür hoch. Aus diesem Grund wird versucht, mittels Fledermausdetektoren die Anwesenheit und Aktivität jagender Fledermäuse, Letzteres als Surrogat für die Häufigkeit der jeweiligen Art, festzustellen. Umfangreiche methodische Probleme schränken jedoch die Interpretierbarkeit akustischer Daten ein (siehe auch die Übersicht von Voigt et al. 2021).
Akustische Daten werden auf Basis zweier Grundverfahren ermittelt: aktives Monitoring in Form von Begehungen mittels tragbarer Ultraschalldetektoren (oftmals entlang vordefinierter Transekte; gelegentlich auch als „Punkt-Stopp-Begehung“ durchgeführt, um durch die Bewegung selbst erzeugte potenzielle Störgeräusche zeitweise zu minimieren; Runkel et al. 2018) sowie passives Monitoring in Form einer Dauererfassung mittels automatischer Ultraschall-Erfassungsgeräte (im Folgenden als „Hochboxen“ bezeichnet) (s. a. Runkel et al. 2018). Hurst et al. (2015) extrahierten aus den ihnen damals vorliegenden Arbeitshilfen mehrere dort empfohlene akustische Methoden der Fledermauserfassung:
-
regelmäßige Detektorbegehungen zur Wochenstuben-, zur Paarungs- und zur Zugzeit;
-
akustische Dauererfassungen durch fest installierte Detektoren, z. T. in Ergänzung zu Detektorerfassungen oder als deren Ersatz;
-
akustische Erfassungen in der Höhe an Messmasten, benachbarten WEA oder durch Ballooning;
-
Detektorbegehungen zur Ermittlung der Balzaktivität (falls Quartierpotenzial vorhanden; nur in einem Leitfaden vorgegeben).
Grundproblem all dieser Methoden ist die potenzielle Diskrepanz zwischen den vor und nach der Errichtung und Inbetriebnahme einer WEA ermittelten Aktivitätsdaten. Diesbezüglich vergleichende Daten sind selten. So fanden Hein et al. (2013) an zwölf WEA in den USA eine nur schwach positive Beziehung zwischen der vor dem WEA-Bau am Boden akustisch gemessenen Aktivität von Fledermäusen und der nach der Inbetriebnahme gefundenen Zahl von Schlagopfern. Aus dem nur knapp 22 % betragenden Erklärungsgehalt der akustischen Aktivitätsmessungen für die Schlagopferzahl schließen sie, dass aus den vor dem Bau gesammelten akustischen Daten keine genaue Vorhersage über die Gefährdung von Fledermäusen getroffen werden können. Auch Lintott et al. (2016) zeigten für europäische Fledermausarten und Ferrer et al. (2012) für Vogelarten, dass Voruntersuchungen vor dem Bau der WEA nicht in der Lage sind, das Aufkommen von Schlagopfern zu prognostizieren. Dennoch halten Hurst et al. (2015) auch bodennahe akustische Untersuchungen an Fledermäusen grundsätzlich zur Identifikation von Konfliktpotenzialen für sinnvoll; aus unserer Sicht ist hier jedoch die diesbezügliche Beschränkung auf lebensraumspezifische Konflikte hervorzuheben.
Dies mag auch bei der Betrachtung des Verlustes essenzieller Jagdhabitate sinnvoll sein. Das wesentliche Problem bei der Nutzung bodennaher Fledermausaktivitäten zur Bewertung des Schlagrisikos von Fledermäusen im Wirkbereich der WEA-Rotoren liegt aber in der Tatsache begründet, dass Fledermausaktivitäten im oder gar oberhalb des Kronenbereichs vom Boden aus kaum und schon gar nicht zuverlässig messbar sind (z. B. Bach et al. 2012; Müller et al. 2013). Dies liegt an zahlreichen Faktoren. Einerseits steigt die atmosphärische Abschwächung von Ortungslauten mit steigender Ruffrequenz (z. B. Evans et al. 1971; Bass et al. 1972) und liegt bei lediglich ≤ 30 m für Fledermausrufe ab 40 kHz (Behr et al. 2015). Andererseits bestimmt die unterschiedliche Biologie der Fledermausarten deren relative akustische Nachweisbarkeit. Fledermäuse werden in Gilden unterschiedlicher Jagdstrategien eingeteilt. Arten, die an die Jagd in strukturreichen Habitaten wie dem Wald angepasst sind (z. B. Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Plecotus auritus), verwenden andere Ortungslauttypen und -intensitäten als Arten, die im freien Luftraum jagen (z. B. Schnitzler und Kalko 2001). Zudem variieren Schalldruck und Frequenzmodulation der Ortungslaute jagender Fledermäuse auch in Abhängigkeit von der Jagdsituation (z. B. Kalko und Schnitzler 1993; Russ 2021; Voigt et al. 2021), ein Phänomen, das laut Russo et al. (2018) nach wie vor nicht hinreichend erforscht ist.
Die Unzulänglichkeit bodennaher Aktivitätserfassungen für die Beurteilung der Aktivität einer Fledermausart sogar im untersten Rotorbereich von WEAs im Wald wurde eindrucksvoll von Budenz et al. (2017) an der Mopsfledermaus demonstriert. Je nach Standort variierte zwar die Relation zwischen bodennaher und im Kronenbereich aufgezeichneter Aktivität. An beiden untersuchten Standorten war jedoch ab 50 m über dem Boden, und damit deutlich über dem Kronendach, quasi keine Aktivität mehr nachweisbar. Dies belegt die spezielle Situation der Erfassung selbst relativer Aktivitätsdichten von Fledermäusen im Wald. Insofern liefern auch Hinweise auf Studien im Freiland (Hurst et al. 2015), in denen alle in der Höhe aufgezeichneten Arten auch am Boden detektiert wurden (z. B. Behr et al. 2011), bestenfalls Argumente für den Einsatz von bodennahen akustischen Untersuchungen im Rahmen einer „presence-absence“-Erfassung, nicht aber eine hinreichende Rechtfertigung zu deren Verwendung für eine konfliktrelevante Bewertung des Schlagrisikos von Fledermausvorkommen im Rahmen einer Eingriffsplanung (siehe hierzu auch die von Voigt et al. (2020) befragten Expert:innen). Die AH-MV zu Fledermäusen führt hierzu aus, dass akustische Erfassungen im Vorfeld einer Planung (Detektorkartierungen, Horchboxen, Ballon- oder Dracheneinsatz usw.) zwar einer ersten Vorab-Einschätzung der zu erwartenden Höhenaktivität (insbes. während der Migrationsphase) dienen können, sie macht aber mit Verweis auf Brinkmann et al. (2011) auch deutlich, dass selbst bei großer Stichprobe (20–30 Begehungen/Jahr) nur eine unzureichende Prognosegenauigkeit zum Ausschluss des Eintretens von Verbotstatbeständen erreicht wird.
Die akustische Aktivitätsmessung über Kronenhöhe, z. B. mittels Windmasten oder in der Gondel bereits bestehender WEA, ist die einzig sinnvolle Methode, um solide Aktivitätsdaten im späteren Wirkbereich von dann in Betrieb befindlichen WEAs zu ermitteln. Dies ist sehr aufwendig und nur in wenigen Ausnahmefällen umsetzbar (siehe z. B. die der Publikation von Budenz et al. 2017 zugrunde liegende Eingriffsplanung). Der Einsatz von Heliumballons zur Aktivitätsmessung im Luftraum über dem Kronendach (Albrecht und Grünfelder 2011) erscheint zwar technisch attraktiv, ist aber im Wald schwer umsetzbar (Hurst et al. 2015). In keinem der von Gebhard et al. (2016) untersuchten 156 Fachbeiträge zu Fledermäusen wurden derartige Verfahren angewendet (eigene unveröffentlichte Daten). Dies unterstreicht den eher theoretischen Charakter solcher Methoden für die Eingriffsplanung.
Unabhängig von der diskutierten Sinnhaftigkeit einer bodennahen akustischen Erfassung, sei es durch eine Detektorbegehung oder durch Horchboxen, steht und fällt ihr Erfolg mit der Auswahl der jeweiligen Transekte bzw. Standorte. Diese werden bei der Eingriffsplanung a priori festgelegt, d. h. i. d. R. ohne Vorkenntnisse des betroffenen Gebiets. Intuition und Erfahrung seitens der Begutachtenden sind daher essenziell. Bei der personalintensiven Methode der Transektbegehung kommt erschwerend hinzu, dass hier meist nur eine geringe Zahl an Begehungen vorgeschrieben wird. Angesichts der Tatsache, dass sich insbesondere das Zuggeschehen migrierender Arten kurzzeitig abspielen kann (siehe Übersichten in Hutterer et al. 2005 und Meschede et al. 2017), ist die Wahrscheinlichkeit, dieses zufällig mit den wenigen Begehungstagen zu erfassen, gering.
Dieses Problem besteht auch bei der automatisierten akustischen Erfassung. Runkel et al. (2018) beschreiben eindrucksvoll den Informationszuwachs bezüglich der nachgewiesenen Arten an sechs akustisch untersuchten Standorten. Zum Nachweis von 90 % der insgesamt nachgewiesenen Arten wurden zwischen 20 und 137 (!) Tage benötigt. An einem der Standorte wurde erst nach > 170 Erfassungstagen die letzte Art gefunden; es handelte sich um die nach Anhang II der FFH-Richtlinie besonders geschützte Art M. bechsteinii.
Die bei der akustischen Dauererfassung in Deutschland bevorzugt eingesetzte Hardware unterscheidet sich hinsichtlich mehrerer physikalischer Parameter (für eine weiterführende Beschreibung der verfügbaren Technik verweisen wir hier auf Runkel et al. 2018, Runkel 2020 und Russ 2021). Im Rahmen des RENEBAT II-Forschungsvorhabens verglichen Simon et al. (2015) drei häufig verwendete Horchboxen (Batcorder (ecoObs GmbH), Anabat SD1 (Titley) und UltraSoundGate (USG; Avisot Bioacoustics). Zwar fanden sie z. T. deutliche Unterschiede in der Erfassungsreichweite, der Anzahl von Störungsaufnahmen, der Dauer von Ausfallzeiten und der Anzahl von Aufnahmen mit Fledermausrufen. Insgesamt bewerteten sie jedoch alle drei Detektoren als geeignet für ein Gondelmonitoring (Simon et al. 2015).
Ein bekanntes Problem bei der Analyse akustischer Daten von Fledermäusen ist die Unsicherheit bei deren Auswertung. Die Artidentifikation von Detektordaten erfolgt bei der Begehung meist direkt vor Ort durch die begehende Person anhand des Rufeindrucks sowie der von den Geräten angezeigten Parameter (i. d. R. die lauteste Ruffrequenz). Die Option der Rufaufzeichnung für eine spätere Analyse am PC besteht, wird aber in der Regel nur vorgenommen, um im Freiland schwer bestimmbare Laute zu überprüfen. Zudem wird in den Gutachten meist nur angegeben, ob eine Überprüfung grundsätzlich vorgenommen wurde, nicht aber wie hoch der Anteil der überprüften Datensätze ist (eigene unveröffentlichte Beobachtung).
Auch die automatisierte Analyse von aufgezeichneten Ortungslauten, die mit Horchboxen aufgezeichnet wurden, birgt Probleme; mehrere Publikationen haben in jüngster Zeit hierauf hingewiesen (z. B. Russo and Voigt 2016; Rydell et al. 2017; Brabant et al. 2018; Runkel 2020; Russ 2021). Die Gründe hierfür sind vielfältig. Es ist schon lange bekannt, dass die Rufe einer Art je nach Jagdsituation (in der Regel der Fall bei WEAs im Wald) hoch variabel sind (Obrist et al. 2007; Berger-Tal et al. 2008; Russ 2021). Zwar extrahiert die automatisierte Bestimmung physikalische Rufparameter, welche mit einer Referenzdatenbank abgeglichen werden (die meisten Rufanalyse-Programme basieren auf dem Prinzip des Programmtrainings anhand vorgegebener Rufbibliotheken; Russ 2021), die Vielfalt der möglichen Rufsituationen kann hierbei jedoch kaum realistisch abgebildet werden. Zum Beispiel quantifizierten eine Reihe von Studien die Auswirkung geografischer Variation, lokaler Lebensräume und Fledermausverhalten auf Echoortungsmerkmale und damit indirekt die Auswirkung, die diese Faktoren auf die Artbestimmung haben können (z. B. Thomas et al. 1987; Murray et al. 2001; Law et al. 2002; Berger-Tal et al. 2008). Ein Test eines Programms, das mit einer bestimmten regionalen Rufbibliothek trainiert wurde, auf die Performance mit einem anderen Rufdatensatz, wurde selten durchgeführt. Clement et al. (2014) konnten bei einem solchen Vergleich zeigen, dass die Raten korrekter Rufklassifizierung signifikant niedriger waren, wenn eine externe anstelle einer internen Kreuzvalidierung der Klassifizierungsperfomance der Software vorgenommen wurde. Hieraus schließen sie, dass die Genauigkeit rein akustischer Erhebungen geringer sein kann als allgemein angenommen, was das ökologische Verständnis oder Managemententscheidungen auf der Grundlage akustischer Erhebungen beeinträchtigen könnte (Clement et al. 2014).
Die Fehlerquote bei der automatisierten Artidentifikation europäischer Arten untersuchten Rydell et al. (2017) für drei Programme (SonoChiro, Kaleidoscope Pro, BatClassify; das in Deutschland häufig verwendete Programmpaket bcAdmin/BatIdent testeten sie leider nicht) (siehe auch Lemen et al. 2015 für nordamerikanische Arten). Im Allgemeinen gelang es den Programmen, die Fledermausrufe in große Gruppen (Gattungen oder in einem Fall eine Gruppe von Gattungen) einzuordnen oder die Arten mit den charakteristischsten Echoortungsrufen zu identifizieren, wie z. B. P. pygmaeus und B. barbastellus. Bedenkt man zudem, dass die Autoren es den Programmen „leicht“ machten, indem sie z. B. Aufzeichnungen mit den Rufen mehrerer Arten wegließen und den Programmen nur Rufe vorsetzten, die unter typischen Rufbedingungen emittiert worden waren, so kommt man zu dem Schluss, dass keines zufriedenstellen arbeitete. Ein von Brabant et al. (2018) durchgeführter Vergleich von vier Programmen zur automatischen Klassifikation von Fledermausrufen, diesmal unter Einbeziehung der in Deutschland oft verwendeten Software BatIdent, zeigte, dass Letztere den höchsten Grad korrekter Artidentifikation lieferte. Angesichts der dennoch hohen Rate an Fehlidentifikationen schlussfolgern sie, dass, wenn man automatische Artenidentifizierungen als selbstverständlich ansieht, dies zu falschen Schlussfolgerungen führen und sich dies auf den Entscheidungsprozess beim Naturschutzmanagement und/oder bei der Genehmigung neuer Projekte (z. B. Ansiedlung von WEA im Wald) auswirken kann (Brabant et al. 2018)
Auch Rydell et al. (2017) schließen aus ihren Ergebnissen, dass die erheblichen, wenn auch unterschiedlichen Mängel und die oft schlechte Diskriminierungsleistung Anlass zu ernsten Bedenken hinsichtlich der Verwendung automatischer Klassifikatoren für die Identifizierung auf Artniveau in der Forschung und in sonstigen akustischen Untersuchungen gibt. Ihr Vergleich automatischer und manueller (Expert:innenmeinung) Klassifikation zeigte zwar, dass erfahrene Fledermausexpert:innen die ihnen vorgelegten Rufe besser klassifizierten als die getesteten Programme, dennoch war der Erfolg bei einigen Arten/Artengruppen nach wie vor schlecht (siehe auch Fritsch und Bruckner 2017). Die AH-NI empfiehlt daher angesichts der oftmals „zu realitätsfernen Artdetermination“ der automatisierten Analyse- und Bestimmungssoftware, dass sämtliche Rufauswertungen und Artdeterminationen gleichfalls manuell auf ihre Validität geprüft werden sollten.
Die Eingriffsplanung bei WEA im Wald hat zur Aufgabe, auf Artniveau Bewertungen des potenziellen Konflikts vorzulegen. Wenn aber automatisierte akustische Methoden nur für wenige Arten überhaupt eine sichere Bestimmung zulassen, oder eine sichere Zuordnung von Rufen bestenfalls zu Artengruppen erlauben (z. B. als Nyctaloid (Gattungen Nyctalus, Vespertilio und Eptesicus) oder Pipistrelloid (Gattung Pipistrellus)), stößt diese Methode an ihre Grenzen (siehe auch Brinkmann et al. 2011; Behr et al. 2015). Insbesondere in der Gattung Myotis, deren Rufparameter weit überlappen (Russ 2021), scheidet eine sicher Artdiagnose weitgehend aus. Zudem rufen einige Arten biologisch bedingt sehr leise (Langohren, Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Hufeisennasen; Runkel et al. 2018), sodass sie in automatisierten akustischen Erfassungen ohnehin systematisch unterrepräsentiert sind. Da jedoch aus der über Rufe ermittelten Aktivitätsdichte auf die Häufigkeit und damit die Betroffenheit einer Art geschlossen wird, steht zu befürchten, dass zwangsläufig die entsprechenden Konflikte unzutreffend bewertet werden.
7.6.2.4 Radiotelemetrie
Die Radiotelemetrie stellt in der ökologischen Forschung eine Standardmethode für Raumnutzungsanalysen von Fledermäusen dar (z. B. O’Mara et al. 2014; Laforge et al. 2021). Die Zahl der je Studie untersuchten Individuen ist oftmals jedoch gering (Laforge et al. 2021 Appendix 4; eigene unveröffentlichte Daten) und der Erhebungsaufwand ist hoch, da sehr personalintensiv. Dies mag für wissenschaftliche Studien limitierend für deren Aussagekraft sein, in der Eingriffsplanung jedoch wird sie dennoch mit teils geringen Stichproben verwendet. Hier erfüllt die Radiotelemetrie zwei Ziele. Die Telemetrie reproduktiv aktiver Weibchen soll einerseits das Auffinden von Wochenstubenquartieren ermöglichen, um dort eine Koloniegrößenzählung vorzunehmen und diese Quartiere besonders zu schützen. Andererseits soll die sogenannte Raumnutzungstelemetrie die Bestimmung von Bereichen erhöhten Konfliktpotenzials durch WEA in den Jagdgebieten einer Kolonie erlauben.
Die Telemetrie-gestützte Quartiersuche gilt gerade bei Waldarten als die einzig sinnvolle Methode, um die lokal ansässigen Kolonien und deren Größe in den Fokus einer Konfliktbewertung zu rücken. Gerade jedoch bei Waldarten, deren Kolonien häufig nach dem Fission-Fusion-Modell leben (z. B. Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Mopsfledermaus, Fransenfledermaus; Kerth und König 1999; Fleischmann und Kerth 2014; Bartonička und Řehak 2007; Hillen et al. 2010; Zeus et al. 2018), kann die Zahl der tatsächlich genutzten Quartiere hoch sein. So zeigten Hillen et al. (2010), dass eine Kolonie der Mopsfledermaus im Hunsrück/Rheinland-Pfalz im Laufe von vier Jahren insgesamt 43 teils räumlich stark geclusterte Quartiere nutzten. Hierzu betrieben sie mit 13 meist laktierenden Weibchen, welche z. T. über vier Jahre untersucht wurden, einen weit höheren Aufwand, als dies im Rahmen einer Eingriffsplanung üblich ist (dort meist nur einzelne Tiere). Auch die für Bechsteinfledermäuse vorliegenden Daten zeigen, dass die Zahl der innerhalb einer Saison genutzten Quartiere deutlich über der liegt, die man mittels Kurzzeittelemetrie im Rahmen der Eingriffsplanung nachweisen kann (z. B. Dietz et al. 2013).
Die Raumnutzungstelemetrie (i. d. R. mittels very high frequency (VHF)-Sendern) von Fledermäusen wird, wenn im Rahmen der Eingriffsplanung überhaupt durchgeführt, oft nur auf wenige Arten und Individuen angewendet. Hierunter versteht man die Berechnung von Räumen vordefinierter Aufenthaltswahrscheinlichkeiten aus Fledermausortungsdaten, um in diesen das Konfliktpotenzial zur geplanten WEA anzuleiten. Im Zentrum steht meist die sogenannte „Homerange“, ein biologisches Konzept, mit dem Burt (1943) das Gebiet, das ein Lebewesen zur Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und Aufzucht seiner Nachkommen nutzt, beschrieb.
Die Güte von Telemetriedaten hängt von vielen Faktoren ab. Wir können diese im Rahmen der vorliegenden Arbeiten lediglich auflisten und verweisen daher für eine nähere Betrachtung auf die Monografien von White und Garrott (1990) und Kenward (2001). Neben Hardware-Spezifika sind dies insbesondere die Eigenschaften der Landschaft, in der telemetriert wird. Zudem bieten sich zahlreiche Verfahren zur Berechnung von Aufenthaltsräumen an, die sich grob in Polygon (Hull-)- und Kontouringverfahren einteilen lassen und durch Getz und Wilmers (2004) und Getz et al. (2007) um die „Local convex hull“-Methode ergänzt wurden. Die Parametrisierung der Berechnungen ist umfangreich, sodass es kaum zwei unabhängig voneinander veröffentlichte Studien gibt, die sich in allen Details methodisch entsprechen (eigene unveröffentlichte Daten). Wenn im Zuge der Eingriffsplanung Homeranges ermittelt werden, dann wird dies meist mittels Kontouringverfahren vorgenommen (Kernel Density Kontouring; Silverman 1986). Hierbei haben sich rein operational zwei Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume etabliert (z. B. Dietz et al. 2013), obwohl sie streng genommen nicht biologisch begründbar sind und artspezifisch unterschiedliche Bedeutung haben dürften: 95 % (meist Aktionsraum genannt) und 50 % (meist Kernjagdgebiet genannt).
Die mittels VHF-Telemetrie abgegrenzten Aufenthaltsräume werden im Zuge der Eingriffsplanung genutzt, um den Raumbezug der geplanten WEA zu den Aktionsräumen oder Kernjagdgebieten der telemetrierten Individuen herzustellen. Alleine schon die Wahl des beim Kernel Density Kontouring benötigten Glättungsfaktor h bietet hierbei Raum für Variation. In einer gesonderten Arbeitshilfe zur Mopsfledermaus wird in Rheinland-Pfalz die Verwendung der Raumnutzungstelemetrie für diese Art vorgeschrieben und detailliert beschrieben (LfU RLP 2018). Es wird empfohlen, geeignete Glättungsfaktoren zu wählen: href und hLSCV. Beide stellen gewissermaßen die Pole der Über- und Unterglättung dar, können zu biologisch wenig sinnvollen Kernels führen (z. B. Schuler et al. 2014) und bieten zumindest theoretisch das Potenzial für eine manipulative Verwendung von Kernels. Der als biologisch sinnvoller erachtete „Mittelweg“ (hadhoc; Berger und Gese 2007) wird nicht angeboten.
Wie viele andere aufwendige und individuenbasierte freilandökologische Untersuchungsmethoden zeichnet die Radiotelemetrie nur ein unvollständiges Bild der Lebensäußerung einer Fledermauskolonie im Jahresverlauf. Vielen Telemetriestudien an mitteleuropäischen Arten liegen nur wenige Individuen zugrunde (siehe Appendix S4 von Laforge et al. 2021). Der Trade-off zwischen Sendergewicht und -lebensdauer sowie die hohe Personalintensität dieser Methode führt zudem dazu, dass meist nur für sehr kurze Zeiträume im Jahr Daten gesammelt werden. Da unterschiedliche Individuen oft unterschiedliche Jagdgebiete nutzen (siehe z. B. Hillen et al. (2009) für die Mopsfledermaus und Dietz et al. (2013) für die Bechsteinfledermaus), decken einzelne Individuen nur unzureichend den Lebensraum der Kolonie ab. Eine mehrjährige Telemetrie jeweils unterschiedlicher Individuen böte aufgrund der hohen traditionellen Bindung an individuelle Jagdgebiete (z. B. Hillen et al. 2009) zwar die Option einer besseren Abschätzung eines potenziellen Konflikts, die meist kurzen Planungszeiträume erlauben dies in der Realität jedoch nicht.
Bei der Reduktion der Raumnutzungstelemetrie auf bestimmte Arten wird in den Arbeitshilfen meist deren kleinräumige Aktivität als Kriterium angeführt. Insbesondere die typische Waldart Bechsteinfledermaus wird hier genannt (z. B. AH-BW, -RP und -SL).
7.7 Bewertung der Erfassungsdaten
7.7.1 Einschätzung des Konfliktpotenzials
Besondere Bedeutung kommt im Rahmen einer Eingriffsplanung der Bewertung der erhobenen Daten zu. Hierbei wird die Auswirkung möglicher verbotsrelevanter Wirkfaktoren/Vorhabenswirkungen auf die betroffenen Arten beleuchtet. Unter anderem wird den Fragen nachgegangen (nach Trautner 2020):
-
Welche planungsrelevanten Arten kommen im Wirkbereich der Planung vor?
-
Welche Bedeutung/welches objektive naturschutzrelevante Gewicht kommt den nachgewiesenen Beständen artenschutzrechtlich geschützter Arten (und damit aller Fledermausarten) zu?
-
Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen der Vorhabenrealisierung berührt?
-
Sind bestimmte Minderungs- oder Vermeidungsmaßnahmen möglich?
-
Wird die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt, oder sind funktionserhaltende Maßnahmen nötig und möglich?
-
Welche Maßnahmen sind zur Vermeidung einer erheblichen Störung erforderlich?
Insofern entfaltet sich hier eine Argumentationskaskade, die aus den tatsächlich für die betroffenen Arten erhobenen Daten über eine Vorkommens- und Eingriffsbewertung bis hin zu eingriffsspezifischen Schlussfolgerungen führt.
Die Frage, ob im Rahmen der Eingriffsplanung bei WEA im Wald Fledermäuse zu betrachten sind, beantwortet sich alleine schon aus der Omnipräsenz dieser Tiergruppe im Lebensraum Wald (u. a. Hurst et al. 2015, s. o.). Spezifiziert werden muss lediglich das Arteninventar. Hierzu werden die voranstehend beleuchteten Erfassungsmethoden herangezogen; bestenfalls reichen sie aus, um alle im Wirkbereich eines Eingriffs vorkommenden Arten in der Tat nachzuweisen. Die Beantwortung der nachgeordneten Fragen jedoch birgt inhärent eine subjektive, dem jeweiligen Fachgutachter überlassene Komponente. Bewertungskriterien hierfür gibt es nur wenige, zudem entsprechen sich diese nicht immer.
Eines der Hauptprobleme bei der Konfliktbewertung stellt die Tatsache dar, dass die erhobenen Daten nur selten belastbar quantitativ sind (s. o.). Aus diesem Grund wird, ungeachtet der oben beschriebenen methodischen Probleme, gern auf die Daten der automatisierten akustischen Erfassung zurückgegriffen, da sie alleine schon aufgrund ihrer Quantität eine methodisch saubere Belastbarkeit suggerieren. Die basale Maßeinheit ist hierbei der Kontakt, was an sich schon fraglich erscheint (siehe z. B. Runkel 2020). Versuche, eine objektivierte Bewertung solcher quantifizierter „Kontaktdaten“ mittels eines Online-Tools vorzunehmen (Lintott et al. 2017), müssen erst beweisen, dass sie die mannigfachen, schon bei der Generierung der Daten bestehenden Probleme wirklich objektiv auf eine Bewertungsebene herunterbrechen können.
7.7.2 Von der Konfliktbewertung zur Maßnahmenempfehlung
Hilfestellung bei der Bewertung von akustisch ermittelten Aktivitätsdaten bieten nur wenige Arbeitshilfen. Die in Tab. 7.2 dargestellten quantifizierten und zur Bewertung herangezogenen Aktivitätskategorien suggerieren jede für sich eine objektive Bewertung. Jedoch sind sie weder vergleichbar, noch werden die dargestellten Kategorien biologisch begründet.
Dieses weitgehende Fehlen von Kriterien zur Bewertung von quantitativen Aktivitätsdaten führt dazu, dass im Rahmen der Fachgutachten vermutlich intuitiv und damit nicht objektiv begründbare Bewertungen vorherrschen. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit untersuchte Trenz (2015) 30 Fledermaus-Fachbeiträge zu WEAs aus Rheinland-Pfalz. Im Fokus stand die Frage nach Umfang und Art der Konfliktbewertung basierend auf quantitativen akustischen Monitoringdaten. Beispielhaft sei hier der Bewertungsablauf für die Zwergfledermaus dargestellt. Sie wurde bei den meisten der 157 WEA, die im Rahmen dieser 30 Fachbeiträge untersucht wurden, nachgewiesen.
Die in den jeweiligen Gutachten dargestellten WEA-spezifischen Aktivitätsdaten wurden zur Herstellung der Vergleichbarkeit auf Kontakte pro Stunde und Horchbox umgerechnet (für 18 der 30 Gutachten war dies möglich). Aus den an den Anlagen aufgezeichneten Aktivitätsdichten wurden in den Fachgutachten insgesamt vier Konfliktkategorien (kein – geringes – mittleres – hohes Konfliktpotenzial) abgeleitet (Abb. 7.1). Die den ersten drei Konfliktkategorien zugrunde liegenden Aktivitätsmessungen unterscheiden sich offenbar nicht. Lediglich die Stufe „hohes Konfliktpotenzial“ wurde scheinbar auf Basis höherer Aktivitätsdichten der Zwergfledermaus zugewiesen. Ein steigendes Konfliktpotenzial mit steigender Aktivitätsdichte ist demnach nicht durchgängig erkennbar und zudem statistisch nicht signifikant.
Konfliktbewertung der akustisch gemessenen Aktivität von Zwergfledermäusen an WEAs in Rheinland-Pfalz (18 von 30 Gutachten; nach Trenz 2015). Die dem jeweils gleichen Konfliktpotenzial (K) zugrunde liegenden Aktivitätsdichten wurden je Konfliktpotenzialstufe zusammengefasst; die Zahl der Gutachten ist unter den Boxplots angegeben. Ein Kruskal-Wallis-Test für nicht normalverteilte unabhängige Stichproben konnte die Nullhypothese gleicher Stichproben nicht ablehnen (p > 0,05; asymptotische zweiseitige Signifikanz)
Fig. 7.1 Conflict assessment of acoustically measured activity of common pipistrelles at wind turbines in Rhineland-Palatinate (18 out of 30 expert reports; after Trenz 2015). The activity densities underlying the same conflict potential (K) were summarised for each conflict level; the number of ecological impact assessments is given below the boxplots. A Kruskal-Wallis test for non-normally distributed independent samples could not reject the null hypothesis of equal samples (p > 0.05; asymptotic two-sided significance)
Die Bewertungskaskade bei der Zwergfledermaus (Abb. 7.2) zeigt, dass sich die anhand der akustisch gemessenen Aktivitätsdichten abgeleiteten Konfliktpotenziale nicht in der Bewertung derselben widerspiegeln. Während in nahezu dreiviertel aller Gutachten das Konfliktpotenzial in Bezug auf die Zwergfledermaus als mittel bis hoch klassifiziert wurde, wurden diese Konflikte in nur 6 % aller Gutachten als „nicht erhebliche Beeinträchtigung“ oder gar „bedenkenswert“ bewertet; eine „erhebliche Beeinträchtigung“ wurde nie konstatiert (Abb. 7.2). Insbesondere die Überführung der Konfliktpotenziale in Bewertungsstufen macht deutlich, dass es kein stringentes Schema der Bewertung gibt. Die elf Fachbeiträge, die ein hohes Konfliktpotenzial für die Zwergfledermaus konstatierten, bewerteten dies in nur einem Fall als „bedenkenswert“. Die hieraus abgeleiteten Maßnahmen wurden in Abb. 7.2 zwar subjektiv von uns anhand ihrer Umsetzungsproblematik in vier Stufen bewertet, es zeigt sich aber, dass die in den bundesweit existierenden Leitfäden zur Kompensation“ aufgeführten Post-hoc-Maßnahmen Schlagopfersuche, Gondelmonitoring, CEF-/FCS-Maßnahmen und Nutzung von Abschaltalgorithmen (diese werden i. d. R. wieder durch – die gleichen? – Fachgutachter:innen vorgenommen) die Genehmigungsfähigkeit von WEAs sicherstellen, scheinbar ungeachtet der gemessenen Aktivitäten und der hieraus abgeleiteten Konfliktbewertungen. Diese rein verbalargumentative Deduktion von eingriffsmindernden Maßnahmen aus subjektiven Bewertungen von aus akustischen Kontaktdaten begründeten Konfliktpotenzialen zeigt auch bei vier weiteren Arten den gleichen Trend (Abb. 7.3). Selbst mittlere und hohe Konfliktpotenziale werden in nicht nachvollziehbarer und damit rein subjektiver Form bewertet, sodass in nahezu allen Fällen der Eingriff als schlimmstenfalls vertretbar bei Durchführung von Maßnahmen eingestuft wird. Gondelmonitoring, die Verwendung von Abschaltalgorithmen und CEF-Maßnahmen sind auch hier die standardmäßig vorgeschlagenen Maßnahmen.
Konfliktbewertungskaskade für die Zwergfledermaus bezogen auf 30 Windkraftgutachten zu Fledermäusen aus Rheinland-Pfalz (nach Trenz 2015). Die Farben kennzeichnen Kategorien steigenden (von grün nach rot) Konfliktpotenzials sowie steigender Konfliktbewertung durch die Gutachten (aus den Gutachten entnommen) und Maßnahmenbewertung (Letztere bezogen auf die Auswirkung für die Projektierer:innen; eigene subjektive Bewertung; häufig wurden mehrere Maßnahmen vorgeschlagen)
Fig. 7.2 Conflict assessment cascade for the common pipistrelle based on 30 wind power expert reports on bats from Rhineland-Palatinate (according to Trenz 2015). The colours indicate categories of increasing (from green to red) conflict potential as well as increasing conflict assessment by the expert reports (taken from the ecological impact assessments) and measure assessment (the latter related to the impact for the project developers; own subjective assessment; often several measures were proposed)
In 30 Windkraftgutachten zu Fledermäusen aus Rheinland-Pfalz dargestellte Konfliktpotenziale, Konfliktbewertungen und vorgeschlagene Maßnahmen für fünf Fledermausarten (nach Trenz 2015). Rot = Zwergfledermaus (P.pip.), dunkelblau = Rauhautfledermaus (P.nat), hellblau = Großer Abendsegler (N.noc.), dunkelgrün = Kleinabendsegler (N.lei), hellgrün = Bechsteinfledermaus (M.bec.)
Fig. 7.3 Conflict potentials, conflict assessments and proposed measures for five bat species presented in 30 wind power assessments on bats from Rhineland-Palatinate (after Trenz 2015). Red = common pipistrelle (P.pip.), dark blue = Nathusius’ pipistrelle (P.nat), light blue = common noctule (N.noc.), dark green = Leisler’s bat (N.lei), light green = Bechstein’s bat (M.bec.)
Offen bleibt, inwieweit die hier dargestellten Konfliktbewertungen in anderen als den Trenz (2015) zugänglichen Verfahrensunterlagen vorgenommen wurde (siehe hierzu auch Gebhard et al. 2016). Ein gänzliches Fehlen der Konfliktbewertung, wie von Trenz (2015) und Gebhard et al. (2016; 15 von 156 Fachgutachten) gezeigt, macht eine Zulässigkeitsbeurteilung durch die zuständigen Behörden im Grunde jedoch unmöglich. Bereits Gebhard et al. (2016) zeigten jedoch, dass keines der von ihnen bewerteten 156 Fachgutachten zu einer Ablehnung der jeweils geplanten WEA führte; offen bleibt allerdings, ob solche Projekte bereits zu einem früheren Zeitpunkt aus der Planung genommen wurden.
7.8 Maßnahmen zur Konfliktminderung
7.8.1 Schlagopfersuche
Die Zählung von Schlagopfern an WEA ist nach wie vor die einzige Methode, um quantitative Daten zur Mortalität von Fledermäusen an WEA zu ermitteln. Während früher hieraus das Schlagrisiko ermittelt wurde, wird Letzteres heute aus den akustisch ermittelten Aktivitätsdaten approximiert und für die Berechnung artenschutzkonformer Betriebszeiten genutzt. Dennoch wird die Schlagopfersuche weiterhin von einigen länderspezifischen Arbeitshilfen vorgeschlagen (Tab. 7.1).
Schlagopfernachsuchen sind, wenn sie aussagekräftige Daten liefern sollen, methodisch aufwendig und ermöglichen auch im besten Fall einer täglichen Nachsuche nur Rückschlüsse auf das Kollisionsrisiko während der gesamten vorhergehenden Nacht (Niermann et al. 2015). Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Auffindbarkeit toter Fledermäuse unter WEA und damit die Aussagekraft solcher Schlagopferzahlen, z. B. Flächengröße und Begehungsdauer, Bodenbewuchs (beeinflusst die Auffindbarkeit der Kadaver), Länge des Zeitraums zwischen Schlagereignis und Opfersuche, Abtragrate durch Aasfresser sowie die personenspezifische Sucheffizienz (siehe u. a. Behr et al. 2007 und Niermann et al. 2011). Die Sucheffizienz kann zwar durch den Einsatz von Hunden gesteigert werden (z. B. Mathews et al. 2013; Domínguez del Valle et al. 2020; Smallwood et al. 2020), dennoch muss insbesondere im Wald mit erhöhten Problemen beim Auffinden von Schlafopfern gerechnet werden (Hurst et al. 2016). Wie viele Tiere im Bereich der WEA-Rotoren verletzt werden, aber sich dennoch aktiv aus einem potenziellen Schlagopfer-Suchbereich entfernen können und gegebenenfalls später sterben, bleibt zudem völlig unklar, was eine Unterschätzung der Schlagopferzahlen und der daraus ableitbaren Mortalitätsraten verursachen könnte (siehe auch die von Voigt et al. 2020 ausgewerteten Expert:innenmeinungen). Im Rahmen des RENEBAT II-Forschungsvorhabens quantifizierten Niermann et al. (2015) diesbezüglich relevante Parameter und überführten diese in ein online verfügbares Statistiktool (http://www.kollisionsopfersuche.uni-hannover.de/) zur Berechnung der vermutlich tatsächlichen Schlagopferzahl aus der Anzahl gefundener toter Tiere. Ob zukünftig die automatisierte Schlagopferidentifizierung und -zählung (z. B. mittels B-Finder; https://b-finder.eu/tbs/) die Limitierungen dieses Ansatzes überwinden kann, ist angesichts der technischen Beschränkungen des Verfahrens (z. B. nur 50 m Reichweite bei Fledermäusen; https://b-finder.eu/tbs/) fragwürdig. Auch die automatisierte Bodenabsuche mit Kameras (Happ et al. 2021) funktioniert besser bei Tageslicht als nachts und ist daher für Fledermäuse weniger geeignet. Die fehlende Art-Diskriminierung ist ein Nachteil beider Ansätze.
Die Nützlichkeit der optischen Schlagopfersuche bleibt umstritten, wobei dies in besonderem Maße für ihre Anwendung in Wäldern gilt (siehe hierzu auch Voigt et al. 2020). Nicht nur sind Fragen wie zum Aktivitätsschwerpunkt der Fledermäuse im Nachtverlauf, zum Verhalten der Tiere im Rotorbereich oder zum detaillierten Einfluss meteorologischer Parameter auf die Aktivität und damit die Sterberate offen (Behr et al. 2015). Selbst die Entwickler des o. g. Statistiktools sehen noch verbliebene Unsicherheiten in der Berechnung der tatsächlichen Schlagopferzahl (korrigiert für Schwundrate und Auffindewahrscheinlichkeit; Korner-Nievergelt et al. 2011). Die durch das Programm berechneten Konfidenzintervalle tragen dieser Unsicherheit Rechnung und sind daher nicht nur anzugeben, sondern auch konsequent bei einer daraus abgeleiteten Bewertung zu diskutieren.
Die genannten Unsicherheiten, mit denen die Schlagopfersuche insbesondere im Wald behaftete ist, dürfte dazu geführt haben, dass fünf länderspezifische Arbeitshilfen diese nicht als Methode empfehlen (Tab. 7.1). Die AH-NW kommt daher angesichts der methodischen Probleme, welche nur mit extrem hohem und damit einer Studie mit wissenschaftlichem Grundlagencharakter entsprechendem Arbeitsaufwand kompensiert werden können, sogar zum Schluss, dass eine Schlagopfersuche als Bestandteil des Risikomanagements grundsätzlich nicht Bestandteil der Genehmigung werden kann und damit als alleiniger Bestandteil des Risikomanagements ungeeignet ist. In Fällen, in denen a priori bereits die Minimierung der Schlagopferzahl durch eine auf akustischen Aktivitätsdaten basierende Modifizierung der Betriebszeiten einer WEA vorgenommen wurde, können Schlagopfersuchen ohnehin nicht angeordnet werden (AH-BY). Gleichwohl mag im Einzelfall eine Schlagopfersuche sinnvoll sein (Hurst et al. 2016) und zur Überprüfung der Effizienz einer auf Basis akustischer Daten berechneten Abschaltung herangezogen werden können. Voigt et al. (2020) halten daher eine weitere Beauflagung der Schlagopfersuche für ratsam, zumal auch die Methode des Gondelmonitorings problembehaftet ist.
7.8.2 Gondelmonitoring
Das automatisierte akustische Monitoring der Fledermausaktivität im Gondelbereich (Gondelmonitoring) ist eine der fokalen Methoden der vom Bundesamt für Naturschutz beauftragten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben RENEBAT I-III. Insofern verweisen wir für methodische Grundlagen sowie die Anwendung der Methode auf die entsprechenden Berichte (Brinkmann et al. 2011; Behr et al. 2015, 2018). Das Gondelmonitoring liefert essenzielle Daten für das Tool ProBat, mit dessen Hilfe der Betrieb einer WEA an die im Nabenbereich gemessenen Fledermausaktivitäten angepasst wird, um damit deren Tötungsrisiko zu minimieren und die Rechtssicherheit des WEA-Betriebs sicherzustellen.
Lindemann et al. (2018) beschrieben detailliert technische Defizite des Gondelmonitorings in Bezug auf die Erfassung der potenziell im Wirkbereich der Rotorblätter einer WEA existierenden Fledermausaktivitäten. Insbesondere die zunehmende Veränderung des Rotordurchmessers moderner WEA im Bezug zu den in RENEBAT I und II betrachteten Anlagentypen bergen Gefahren für dort aktive Fledermäuse, die mit den gängigen automatischen und im Gondel-/Nabenbereich installierten Erfassungsgeräten nicht abgebildet werden können (Runkel 2020). Sie stellen daher grundsätzlich die Validität von durch Gondelmonitoring erfassten Aktivitätsdaten als Berechnungsgrundlage für Abschaltalgorithmen infrage. Die bei modernen Anlagen deutlich verlängerten Rotorblätter reichen zudem wesentlich tiefer, und damit in Strata (z. B. das Kronendach eines Waldes), in dem einerseits a priori mehr bzw. andere Fledermäuse aktiv sind als im Gondelbereich, und in dem auch niedrigere Windgeschwindigkeiten zu erwarten sind (Lindemann et al. 2018). Das Gondelmonitoring kann dies methodisch bedingt nicht abbilden und unterschätzt somit die tatsächlich im gesamten Rotor-Wirkbereich herrschende Fledermausaktivität systematisch (Lindemann et al. 2018; Voigt et al. 2020). Besonders evident ist dies offensichtlich bei der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii). An ausgewählten küstennahen Standorten fand sich keine signifikante Korrelation der Schlagopferrate der Art mit der in Gondelhöhe gemessenen Aktivität (Bach et al. 2020a); in einzelnen WEA-Jahren fanden sie sogar tote Tiere trotz fehlenden akustischen Nachweises im Gondelbereich. Bach et al. (2020b) verglichen die Aktivität von Rauhautfledermäusen in Gondelhöhe mit der im Bereich der unteren Rotorspitze am Mast gemessenen akustischen Aktivität. Sie konnten zeigen, dass die Aktivitäten hier deutlich höher waren und die Tiere im Bereich der unteren Rotorspitze i. d. R. bei einer geringeren Windgeschwindigkeit flogen als jener, die gleichzeitig auf Nabenhöhe gemessen wurde. Da folglich aus den Aktivitätsdaten im Bereich der unteren Rotorspitze bei scheinbar hohen Windgeschwindigkeiten nicht auf eine höhere Windtoleranz der Tiere geschlossen werden darf, regen Bach et al. (2020b) die Verwendung eines zweiten Mikrofons im Bereich der unteren Rotorspitze einer WEA an, um hierdurch das eigentliche Gondelmonitoring durch realitätsnähere Aktivitätsdaten im Wirkbereich der Rotoren zu ergänzen.
7.8.3 Abschaltalgorithmen (ProBat)
Neben der eigentlichen Standortwahl spielt für den Schutz von Fledermäusen die Beauflagung von Abschaltzeiten als wirksamste Vermeidungsmaßnahme eine wichtige Rolle (Bach et al. 2020b). In Deutschland setzte das im Rahmen der Forschungsvorhaben RENEBAT I-III (Brinkmann et al. 2011; Behr et al. 2015, 2018) entwickelte Software-Tool ProBat Maßstäbe in Bezug auf die Minimierung der Schlagopferzahlen von Fledermäusen an WEA durch temporäre Abschaltung. Mit dieser Software wird durch eine standort-, jahreszeiten- und witterungsspezifische Steuerung des WEA-Betriebs die zu erwartende Anzahl an Schlagopfern pro Anlage auf einen vorab festgelegten Schwellenwert reduziert. Zugleich soll der wirtschaftliche Betrieb einer Anlage gewährleistet und Planungssicherheit hergestellt werden. ProBat entwickelte sich seit seinem Start 2014 (damals als „Bat 3.0“) ständig weiter; seit Ende 2020 wird es mit Version 7.0 online bereitgestellt. Es leistet seit seiner Einführung einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Fledermäusen im Bereich von WEA. Als Algorithmus-getriebene und damit im Ergebnis deterministische Software vermeidet es subjektive und gegebenenfalls manipulative Festlegungen von Abschaltzeiten (Veith et al. 2022).
Für die Berechnung der fledermausfreundlichen Betriebszeiten benötigt ProBat im Wesentlichen Fledermausaktivitätsdaten (ermittelt durch eine automatisierte akustische Erfassung im Gondelbereich) und Winddaten. Anlagenspezifika wie der Standort selbst und der Rotordurchmesser fließen ebenfalls in die Berechnung ein. Veith et al. (2022) testeten die ProBat-Versionen 5.4, 6.2 und 7.0 an sieben Anlagen auf ihre Sensitivität für manuell vorgenommene schrittweise Winddatenänderungen unter Beibehaltung der Fledermausaktivitätsdaten. Hiermit simulierten sie eine steigende Windtoleranz der Fledermäuse, was zu einer schrittweisen Erhöhung derjenigen Windgeschwindigkeit führen müsste, ab der die WEA betrieben werden können. Während Version 6.2 dies auch abbildete, reagierte Version 5.4, mit der nach vorsichtiger Schätzung der Autoren ca. 5000 WEA in Deutschland ihre Betriebsgenehmigung erhielten, völlig unsensibel auf diese Datenmanipulation. Demgegenüber reagierten beide Versionen erwartungsgemäß mit einem Anstieg der Anlauf-Windgeschwindigkeit, wenn die vorab festgelegte Zahl zugelassener Schlagopfer von zwei auf eins gesenkt wurde (Veith et al. 2022). Dies zeigte den Autoren, dass, ungeachtet des Wertes von ProBat für die Minimierung der Fledermausschlagopfer an WEA, zumindest die frühere Programmversion (5.4) offensichtlich nicht hinreichend sensitivitätsanalytisch getestet worden war. Version 7.0, welche im Wesentlichen nur die Übertragung der Version 6.2 in eine Online-Version darstellt, verhielt sich analog zu Version 6.2 (Veith et al. 2022).
Dass ProBat grundsätzlich eine Reduktion der Schlagopferzahl bewirkt, belegten Niermann et al. (2015) anhand einer Schlagopfersuche unter 16 WEA, welche wechselweise mit und ohne die durch ProBat berechneten Abschaltzeiten betrieben wurden. Während im Normalbetrieb der WEA 18 Fledermäuse nachweislich erschlagen wurden, waren dies im Abschaltbetrieb nur 3. Somit ist ProBat derzeit das einzige Verfahren zur Schlagopferminimierung, dessen Wirksamkeit experimentell getestet wurde.
Die grundsätzliche artenschutzrechtliche Problematik des in ProBat vorab einzustellenden Schwellenwerts diskutierten Lindemann et al. (2018). Die meisten Arbeitshilfen legen diesen Wert auf < 2 je WEA fest (in ProBat wird dann der Wert 2 eingestellt); einige AH schlagen artspezifische Festlegungen vor, in der AH-TH wird ein Wert < 1 empfohlen. Nach unseren Recherchen legen vier Arbeitshilfen keinen Wert fest (Tab. 7.1). Ein populationsbiologisch nicht begründbarer Wert von 2 (gleiches gilt natürlich auch für den Wert 1) wurde von den ProBat-Entwicklern nie für die Praxis vorgeschlagen (Hurst et al. 2016). Gleichwohl wurde er von der Planungsseite operationalisiert, um so überhaupt eine Festlegung treffen zu können. Ob dies, wie Lindemann et al. (2018) argumentieren, einer intendierten Tötung und damit einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos gleichzusetzen ist (zwei Exemplare dürfen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % getötet werden), bedarf einer juristischen Überprüfung. Interessanterweise führt die AH-NI, die 2016 und damit vor Lindemann et al. (2018) veröffentlicht wurde, hierzu aus: „Hiernach ist das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG individuenbezogen zu verstehen. Es ist schon dann erfüllt, wenn die Tötung eines Exemplars der besonders geschützten Arten nicht im engeren Sinne absichtlich erfolgt, sondern sich als unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwaltungshandelns erweist.“
7.8.4 Abschaltung durch Früherkennung
Ansätze zur Abschaltung durch eine optische oder radarbasierte Früherkennung werden vor allem im ornithologischen Bereich erforscht (siehe Übersicht von Ammermann et al. 2020). Auch wenn eine Reihe solcher technischen Systeme auch Fledermäuse als Zielorganismen ausweisen, so wird ihr erfolgreicher Einsatz bereits bei Vögeln, insbesondere Greifvögeln, oft kritisch bewertet (KNE 2018). Auf Fledermäuse dürften diese Systeme daher aufgrund der geringen Größe derselben vorerst nicht erfolgreich anwendbar sein.
7.8.5 Vergrämung
Seit mehreren Jahren wird Vergrämung als Methode zur Verminderung des Fledermausschlags an WEA diskutiert. Bisherige Vergrämungsversuche mittels Ultraschall-Störsignalen waren jedoch entweder nur bei einigen Arten erfolgreich (Arnett et al. 2013a, 2013b; Romano et al. 2019), oder sie zeigten zeitlich stark schwankende intra- und interspezifisch Erfolgsraten (Romano et al. 2019). Alle bislang publizierten Untersuchungen wurden zudem an amerikanischen Fledermäusen durchgeführt; eine Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse auf europäische Arten gilt es daher zu prüfen. Zudem reichen die bislang nur niedrigen Minderungsraten (oft nur im Bereich von 30 % je Art und Jahr; Romano et al. 2019) nicht aus, die Tötung von Fledermäusen an WEA sicher zu vermeiden. Nach aktuellem Stand des Wissens ist diese Methode daher derzeit kein probates Mittel zur Minderung des Fledermausschlags an WEA (siehe auch Schirmacher 2020).
Theoretisch ist auch eine Vergrämung von Fledermäusen mittels Radarstrahlung denkbar; bislang ist eine Umsetzung dieser Idee an Windkraftanlagen jedoch weder mit stationären noch mit mobilen Anlagen bekannt (Arnett und Baerwald 2013). Zudem wird vermutet, dass die vergrämende Wirkung der Radarstrahlen auch darauf beruht, dass sie Stress und Hyperthermie bei den Tieren erzeugen (Nicholls und Racey 2007). Damit jedoch wäre diese Vergrämungsmethode a priori als artenschutzrechtlich kritisch anzusehen.
7.8.6 CEF- und FCS-Maßnahmen
§ 44 Abs. 5 des BNatSchG eröffnet die Möglichkeit der Zerstörung und Beschädigung von Fledermauslebensstätten unter Heranziehung von Maßnahmen mit funktional-kompensatorischem Charakter. Solche vorgezogenen Maßnahmen dienen der Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraums für die jeweilige Art (CEF = Continued Ecological Function). Die im Leitfaden der EU-Kommission (European Commission 2007) hierzu definierten Kriterien sind streng und fordern u. a. artspezifische und objektiv belegbare Erfolgsaussichten. Kann solchen Maßnahmen keine vollständig funktional-kompensierende Wirkung prognostiziert werden oder verhindern sie nicht eine wesentliche zeitliche Unterbrechung der Funktionsfähigkeit z. B. der Fortpflanzungsstätten (z. B. Baumquartiere bei Fledermäusen im Wald), so sind sie nicht geeignet, Ausnahmen von den Verboten des BNatSchG im Zuge einer Eingriffsplanung zuzulassen (Trautner 2020). Zudem scheint die fachgerechte Umsetzung von CEF-Maßnahmen in der Planungspraxis häufig problematisch zu sein. Rechtliche, inhaltlich-fachliche sowie Durchführungs- und Umsetzungsprobleme wurden häufig von Planungsträgern angeführt, Erfolgskontrollen werden zudem nur in geringem Umfang vorgenommen (Grün 2016).
Die am häufigsten vorgeschlagene CEF-Maßnahme zur Kompensation von Quartierverlusten bei baumbewohnenden Fledermausarten im Wald ist die Ausbringung von Nisthilfen (Fledermauskästen). Sie haben sich jahrzehntelang als scheinbar quartierstützende Maßnahme bewährt. Die Tatsache jedoch, dass Nistkästen von Fledermäusen grundsätzlich angenommen werden (und dies auch durch die einschlägige Fachliteratur belegt ist; s. z. B. die Übersichtsarbeiten von Ruegger (2016) und Berthinussen et al. (2021), aber auch die umfangreiche neuere Studie von Leitl (2020) aus Nordostbayern), bedeutet nicht, dass sie auch als CEF-Maßnahmen geeignet sind. Gegenüber natürlichen Baumquartieren stellen sie, trotz der Verfügbarkeit unterschiedlicher Kastentypen, eher räumlich und mikroklimatisch homogene Quartiere dar (Ruegger 2016). Die Frage, wie waldbewohnende Fledermäuse sie überhaupt finden, ist zudem nicht erforscht (Ruegger 2016). Zudem ist ihre Lebensdauer, mit Ausnahme von Holzbetonkästen, nur gering. Es bedarf daher zur Herstellung einer langfristigen Funktionsfähigkeit eines Kastenbestands einer stetigen Kontrolle und Wartung (Ruegger 2016; Zahn et al. 2021a); Letzteres entfällt jedoch bei nach unten offenen und damit wartungsfreien Fledermauskästen.
Bereits Meschede und Heller (2000) stuften daher die Ausbringung von Nisthilfen für Fledermäuse im Wald als nicht geeignet für eine langfristige Sicherung des Quartierangebots ein. Dennoch empfehlen Runge et al. (2009) Nisthilfen für z. B. die Bechsteinfledermaus als Maßnahme, die eine kurzfristige Entwicklungsdauer (3–5 Jahre) bis zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit benötigen. Daher fordern sie hierfür eine dauerhafte Überprüfung ihrer Funktionsfähigkeit alle fünf Jahre. Streng genommen wäre dies auch der zu fordernde zeitliche Vorlauf für die Nutzung von Fledermauskästen als CEF-Maßnahme für die Bechsteinfledermaus im Wald, da CEF-Maßnahmen vor der Realisierung eines Vorhabens voll funktionsfähig sein müssen (Runge et al. 2009). Die Auswertung von Fledermaus-Besatzdaten aus 146 Waldgebieten (ca. 6500 Fledermauskästen) durch Zahn und Hammer (2017) relativiert jedoch selbst diesen für die Kompensation von Eingriffen in Fledermauslebensräumen durch WEA notwendigen Zeithorizont. Nistkasten-naive Fledermauspopulationen benötigen bis zu zehn Jahre, um die Kästen anzunehmen; nur wenn Fledermauskolonien bereits an Kästen gewöhnt sind, neigen sie dazu, neue Kästen zügig anzunehmen (Zahn und Hammer 2017; siehe auch Leitl 2020). Fledermauskästen scheiden ihrer Meinung nach somit als vorgezogen wirksame (eben dies ist das Prinzip von CEF-Maßnahmen!) Ausgleichsmaßnahmen oder auch als populationsstützende Maßnahmen in der Regel aus, da ihre Wirksamkeit nicht mit hoher Prognosesicherheit bescheinigt werden kann (Zahn und Hammer 2017). Philipp-Gerlach (2017) konstatiert daher, dass die derzeit in vielen Planungsverfahren gängige Praxis, das Aufhängen von Fledermauskästen als langfristig wirksame CEF-Maßnahme darzustellen, fachlich nicht mehr zu vertreten und damit rechtlich unzulässig sei; auch die diesbezügliche Rechtsprechung müsse revidiert werden. Folglich empfehlen Zahn et al. (2021a, b) den Einsatz von Fledermauskästen (Anbringung mindestens ein Jahr vor der Beseitigung der Quartierbäume) nur in Kombination mit langfristigen Maßnahmen zur Stärkung des Quartierangebots oder begleitend zu FCS-Maßnahmen (= Favourable Conservation Status; s. u.), und zudem beides auch nur dort, wo die lokalen Fledermauskolonien an Kästen gewöhnt sind. Seminatürliche Nisthilfen könnten diesbezüglich einen Ausweg bieten, da sie schneller als herkömmliche Holzbetonkästen angenommen werden (Encarnação und Becker 2018).
Zahn und Hammer (2017) empfehlen angesichts der weitgehenden Wirkungslosigkeit von Fledermauskästen als CEF-Maßnahme die Entwicklung neuer Quartierbaumzentren – dies entspricht dem Konzept der FCS-Maßnahme. Im Rahmen einer zu erteilenden artenschutzrechtlichen Ausnahme sollen sie helfen, eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes betroffener Arten zu verhindern (Trautner 2020). Weder der räumliche noch der zeitliche Bezug müssen so strikt an die Maßnahme gekoppelt sein, wie dies bei den CEF-Maßnahmen gefordert ist (siehe hierzu auch Runge et al. 2009). Allerdings müssen sie spezifisch für die jeweils betroffene Art sein. Bei WEA-Planungen im Wald betrifft dies vor allem die baumbewohnenden Arten sowie Arten, die bevorzugt im Wald jagen. Die Entwicklung von Altholzbeständen, z. B. durch Nutzungsaufgabe, die Erhaltung von Höhlenbäumen sowie die Aufwertung von Jagdhabitaten stellen geeignete FCS-Maßnahmen im Wald dar. Die Größe solcher Ausgleichsflächen muss an das vorkommende Artspektrum angepasst sein und den tatsächlich betroffenen Populationen zugutekommen. Viele Fledermausarten zeigen, vor allem zur Wochenstubenzeit, eine gewisse Territorialität gegenüber anderen Wochenstubenverbünden derselben Art (z. B. Dietz et al. 2013). Daher könnten falsch gewählte Ausgleichsflächen ihre Wirksamkeit für die vom Eingriff betroffene Population verfehlen.
7.8.7 Empfehlungen
Die von uns aufgezeigten Defizite im Bearbeitungs- und Bewertungsablauf bei der Windkraftplanung im Wald können nicht zu einem gänzlichen Verzicht auf Konfliktbewertung und -bewältigung führen. Vielmehr müssen erkannte Schwächen benannt und vermindert werden und wenig zielführende Untersuchungsansätze vermieden und in ihrer Wirkung fragliche Kompensationsmaßnahmen unterlassen werden. An dieser Stelle möchten wir diesbezüglich einige Anregungen liefern; zum Teil decken sie sich mit Vorschlägen, die unter Federführung des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende KNE gGmbH (KNE 2019) verabschiedet wurden:
-
Die derzeit existierenden Arbeitshilfen sollten vereinheitlicht werden. Das Wissen zur Ökologie der Arten sowie zu den Stärken und Schwächen von Nachweismethoden gilt als jeweiliger Stand der Technik für alle Bundesländer. Eine bundesweit einheitliche und verbindliche Arbeitshilfe wäre wünschenswert.
-
Arbeitshilfen, ob auf Länder- oder Bundesebene, sollten kontinuierlich dem neusten Stand der Forschung angepasst werden (siehe auch KNE 2019; so basieren z. B. die AH-RP und die AH-SL bezüglich der Erfassungsmethodik im Wesentlichen noch auf einem Wissenstand von 2005); dies fördert eine transparente Sicherstellung der Wissenschaftlichkeit der im Rahmen der Eingriffsplanung zu erstellenden Fachgutachten (siehe auch Weber et al. (2020) zu dem im US-amerikanischen Umweltrecht adressierten Best-Available-Science/Information-(BAS/I-)Wissenschaftsmandat).
-
Fachgutachter:innen und Planungsbüros sollten zertifiziert werden (siehe auch Kurtze 2013). Die finanzielle Abhängigkeit zwischen Gutachter:in und Projektierer:in sollte aufgehoben werden. Beide Themen wurden im Rahmen des von des KNE moderierten Fachdialogs (KNE 2019), bei dem Vertreter:innen aller an der WEA-Planung beteiligten Interessensgruppen involviert waren, kontrovers diskutiert.
-
Sämtliche methodisch-technischen Details der im Rahmen einer Untersuchung eingesetzten Methoden (z. B. akustisches Monitoring, Netzfang, Radiotelemetrie) müssen detailliert dokumentiert und damit einer Überprüfung und Bewertung zugänglich gemacht werden (siehe auch Runkel et al. 2018; Runkel 2020). Einige Arbeitshilfen der Bundesländer fordern dies bereits (z. B. AH-TH). Eine im Sinne der Transparenz verpflichtende und bundesweit einheitliche Ablage der Planungsdaten, z. B. in öffentlich zugänglichen Repositorien, sollte geprüft werden.
-
Die automatisierte akustische Erfassung sollte durch in Höhe des unteren Rotorbereichs befestigte Horchboxen ergänzt werden (bessere Bewertung der Rauhautfledermaus; siehe Bach et al. 2020b).
-
Der Prozess der Konfliktwertung erfolgt nach unserer Einschätzung derzeit ausschließlich subjektiv (siehe auch Kurtze 2013). Daher müssen Kriterien für den Umgang mit qualitativen und quantitativen Daten in der Konfliktbewertung entwickelt werden (siehe auch KNE 2019). Selbst hiermit wird zwar letztendlich keine absolute Objektivität herstellbar sein, dennoch erwarten wir eine deutlich transparentere Bewertungspraxis und damit eine höhere Akzeptanz für sowohl die WEA-Errichtung im Wald als auch für die beauflagten Kompensationsmaßnahmen.
-
Die Konfliktbewertung muss kumulative Effekte mit benachbarten WEA und Windparks berücksichtigen. Solche Aspekte werden in der momentanen Praxis ausgeblendet, da nicht explizit gefordert; sie werden aber vonseiten der Wissenschaft dringend eingefordert (z. B. Arnett et al. 2013a, b; Lindemann et al. 2018). Die in den Entscheidungsprozess involvierten öffentlichen Stellen sind in die Lage zu versetzen, Planungen diesbezüglich zu bewerten und kommentieren.
-
Software-Tools wie ProBat müssen konsequent einer Sensitivitätsanalyse unterworfen werden (Veith et al. 2022); dies stellt sicher, dass sie so reagieren wie erwartet und erhöht die Akzeptanz für solche objektiven Instrumente.
-
Der Schwellenwert für die zulässige Höchstzahl an Schlagopfern je WEA und Jahr sollte konsequent < 1 gesetzt werden; dieser Wert ist zwar ebenso wie der Wert 2 populationsbiologisch nicht begründbar, würde aber definitiv die Schlagopferzahl erheblich vermindern (Hurst et al. 2020). Zwar wäre eine arten- und populationsbezogene Festlegung wünschenswert (wie in einigen Arbeitshilfen empfohlen), dies ist jedoch unrealistisch. Solche Werte müssten in aufwendigen populationsökologischen Simulationen ermittelt werden; und selbst umfangreiche Untersuchungen der betroffenen Populationen über viele Jahre können nicht sicherstellen, dass am Ende die hierfür notwendigen Parameter mit hinreichender Genauigkeit ermittelt worden sind.
-
Der Entwicklung von Waldbereichen als ökologisch wertvolle Lebensräume für die von einem Eingriff betroffenen Arten sollte gegenüber CEF-Maßnahmen Vorrang eingeräumt werden (FCS-Maßnahmen). Hierunter zählt die langfristige Nutzungsaufgabe von ökologisch wertvollen Altholzbeständen oder die Entwicklung jüngerer Standorte zu solchen ökologisch wertvollen nutzungsfreien Altholzbeständen.
-
Nisthilfen als CEF-Maßnahmen sind weitgehend abzulehnen (Philipp-Gerlach 2017; Zahn et al. 2021a, b; siehe jedoch Hurst et al. 2020); sie sind bei WEA-Planungen weder mit einem realistischen, für ihre Wirksamkeit nötigen zeitlichen Vorlauf einsetzbar, noch bieten sie die geforderte Prognosesicherheit für einen eventuellen Erfolg. Zudem lenken sie gegebenenfalls von potenziell weit wirksameren, finanziell aber unattraktiveren FCS-Maßnahmen (s. o.) ab. Bestenfalls können sie unterstützend zu FCS-Maßnahmen eingesetzt werden (Zahn et al. 2021a, b).
-
Die Genehmigungsbehörden müssen zeitlich und informell in die Lage versetzt werden, die im Rahmen einer saP erstellten Fachbeiträge zu Fledermäusen (aber auch alle anderen Fachbeiträge) inhaltlich zu bewerten (siehe auch Gebhard et al. 2016; KNE 2019).
-
In den Nebenbestimmungen der nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erteilten Betriebsgenehmigungen sollte den nach einer WEA-Errichtung potenziell eintretenden Veränderungen im Bereich der Standorte (Segers und Broders 2014) Rechnung getragen werden (siehe auch Hurst et al. 2020). Gerade Zwergfledermäuse scheinen WEAs gezielt anzufliegen (Richardson et al. 2021) und vom Boden aus zu erkunden (eigene unveröffentlichte Daten; siehe auch Budenz et al. 2017 für die Mopsfledermaus). Ein Gondelmonitoring wird i. d. R. für maximal zwei Jahre beauflagt und bildet daher längerfristige Veränderungen und Reaktionen der Tiere auf die Anlage nicht hinreichend ab. Dies ist durch eine Beauflagung von standardisierten Wiederholungsuntersuchungen möglich (s. z. B. die AH-MV, die diesbezüglich eine Nacherfassung nach der Hälfte des Genehmigungszeitraums, spätestens jedoch alle zwölf Jahre, sowie eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung der Abschaltzeiten vorschreibt) und bietet die Option der Nachsteuerung bei den kompensatorischen Maßnahmen (sowohl zugunsten des Artenschutzes als auch zugunsten der Sicherstellung des WEA-Betriebs). Nachsteuerungsinstrumente und auslösende Schwellenwerte müssen daher ausformulierte Bestandteile der Betriebsgenehmigung sein, und die Einhaltung derselben muss transparent sein.
-
Ein deutschlandweites, datenbasiertes Monitoring der Populationsentwicklung WEA-sensibler Fledermausarten sollte als Grundlage für Anpassungen von Schutzmaßnahmen etabliert werden.
7.9 Fazit
Der Bau von WEA im Wald ist für Projektierer:innen zweifelsohne attraktiv, befinden sich doch viele Waldstandorte in höheren und damit windhöffigen Lagen. Insofern ist der Konflikt mit dem Artenschutz vorprogrammiert. Expert:innen aus den Bereichen Behörden, Fachbegutachtung, NGO-Ehrenamt und Wissenschaft sehen daher WEA im Wald auf unterschiedliche Weise kritisch (Fritze et al. 2020). Lediglich Windkraftvertreter:innen halten mehrheitlich den Ausbau der Windkraft im Wald für einen „notwendigen Kompromiss im Sinne der Energiewende“ (Fritze et al. 2020). Bedenkt man die vielfältigen von uns aufgezeigten Probleme bei der Einschätzung des Konfliktes zwischen WEA im Wald und dem Schutzgut Fledermäuse, so mag das Ergebnis der Umfrage von Fritze et al. (2020) nicht verwundern. Mehr noch könnte man fragen, ob eine realistische und sinnvolle Konfliktbewertung möglich ist und als ultima ratio nicht ganz von der Installation von WEA im Wald abgesehen werden müsste (s. a. Rodrigues et al. 2016).
Bei einer anvisierten Fläche von 2 % der Landesfläche für die Nutzung der Windenergie und einem Waldanteil von lediglich ca. 30 % bundesweit drängt sich die Frage auf, ob der, gleichwohl zur Erreichung der Klimaziele notwendige, weitere Ausbau der Windenergie im Wald notwendig ist. Angesichts der Biodiversitätskrise des Anthropozäns, die auch die Fledermäuse erfasst hat (siehe Übersicht in Voigt und Kingston 2016) sollten ökologisch wertvolle Lebensräume konsequent geschützt werden und der Klimaschutzes nicht – im Zuge einer konkurrierenden Abwägung unterschiedlicher Ziele – die Probleme des Artenschutzes verschärfen.
Literatur
Albrecht K, Grünfelder C (2011) Fledermäuse für die Standortplanung von Windenergieanlagen erfassen. Erhebung in kollisionsrelevanten Höhen mit einem Heliumballon. Natursch Landschaftspl 43:5–14
Ammermann K, Bruns E, Ponitka J, Schuster E, Sudhaus D, Tucci F (2020) Technische Systeme zur Minderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen. Entwicklungsstand und Fragestellungen. BfN-Skripten 571:29 S
Angetter LS (2014) Fledermausfang im Rahmen der Eingriffsplanung von Windkraftanlagen in Wäldern. Empfehlungen für eine Standardisierung der Methoden. Natursch Landschaftspl 48:73–79
Arnett EB, Baerwald EF (2013) Impacts of wind energy development on bats: implications for conservation. In: Adams RA, Peterson SC (Hrsg) Bat evolution, ecology, and conservation. Springer Science Press, New York, S 435–456
Arnett EB, Barclay RMR, Hein CD (2013a) Thresholds for bats killed by wind turbines. Front Ecol 11:171
Arnett EB, Hein CD, Schirmacher MR, Huso MMP, Szewczak JM (2013b) Evaluating the effectiveness of an ultrasonic acoustic deterrent for reducing bat fatalities at wind turbines. PLoS ONE 8:e65794
Bach L, Bach P, Tillmann M, Zucchi H (2012) Fledermausaktivität in verschiedenen Straten eines Buchenwaldes in Nordwestdeutschland und Konsequenzen für Windenergieplanungen. Schriftenr Natursch Biol Vielfalt 128:147–158
Bach L, Bach P, Kesel R (2020a) Akustische Aktivität und Schlagopfer der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) an Windenergieanlagen im nordwestdeutschen Küstenraum. In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin, Heidelberg, S 77–100
Bach L, Bach P, Kesel R (2020b) Akustisches Monitoring von Rauhautfledermaus an Windenergieanlagen: Ist ein zweites Ultraschallmikrofon am Turm notwendig? In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin/Heidelberg, S 101–119
Baerwald EF, D’Amours GH, Klug BJ, Barclay RMR (2008) Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at wind turbines. Curr Biol 18:R695–R696
Barclay RMR, Ulmer J, MacKenzie CJA, Thompson MS, Olson L, McCool J, Cropley E, Poll G (2004) Variation in the reproductive rate of bats. Can J Zool 82:688–693
Barré K, Le Viol I, Bas Y, Julliard R, Kerbiriou C (2018) Estimating habitat loss due to wind turbine avoidance by bats: Implications for European siting guidance. Biol Cons 226:205–214
Bartonička T, Řehák Z (2007) Influence of the microclimate of bat boxes on their occupation by the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus: possible cause of roost switching. Acta Chiropt 9:517–526
Basile M, Asbeck T, Pacioni C, Mikusiński G, Storch I (2020) Woodpecker cavity establishment in managed forests: relative rather than absolute tree size matters. Wildl Biol 2020:wlb.00564
Bass HE, Sutherland LC, Zuckerwar AJ (1972) Atmospheric absorption of sound: analytical expressions. J Acoust Soc Am 52:2019–2021
Bayerische Staatsministerien (2016) Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen (Windenergie-Erlass). https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/publikationen/pdf/Windenergie-Erlass_2016.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Behr O, Brinkmann R, Korner-Nievergelt F, Nagy M, Niermann I, Reich M, Simon R (Hrsg) (2015) Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). Umwelt und Raum 7, 368 S., Institut für Umweltplanung, Hannover
Behr O, Brinkmann R, Niermann I, Korner-Niervergelt F (2011) Akustische Erfassung der Fledermausaktivität an Windenergieanlagen. In: Brinkmann R, Behr O, Niermann I, Reich M (Hrsg) Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. Cuvillier, Göttingen, S 177–286
Behr O, Eder D, Marckmann U, Mette-Christ H, Reisinger N, Runkel V, von Helversen O (2007) Akustisches Monitoring im Rotorbereich von Windenergieanlagen und methodische Probleme beim Nachweis von Fledermaus-Schlagopfern – Ergebnisse aus Untersuchungen im mittleren und südlichen Schwarzwald. Nyctalus 12:115–127
Behr O, Brinkmann R, Hochradel K, Mages J, Korner-Nievergelt F, Reinhard H, Simon R, Stiller F, Weber N, Nagy M (2018) Bestimmung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen in der Planungspraxis – Endbericht des Forschungsvorhabens gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Förderkennzeichen 0327638E). Erlangen, Freiburg, Ettiswil.
Berger KM, Gese EM (2007) Does interference competition with wolves limit the distribution and abundance of coyotes? J Anim Ecol 76:1075–1085
Berger-Tal O, Berger-Tal R, Korine C, Holderied MW, Fenton MB (2008) Echolocation calls produced by Kuhl’s pipistrelles in different flight situations. J Zool 274:59–64
Berthinussen A, Richardson OC, Altringham JD (2021) Bat conservation: global evidence for the effects of interventions, Conservation evidence series synopses. University of Cambridge, Cambridge
BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2020) Die Lage der Natur in Deutschland – Ergebnisse von EU-Vogelschutz- und FFH-Bericht. 62 S Die Lage der Natur in Deutschland (bmu.de) (aufgerufen am 29.11.2021). https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/bericht_lage_natur_2020_bf.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) (2021) Erneuerbare Energien. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html. Zugegriffen am 14.01.2022
Brabant R, Laurent Dolap U, Degraer S, Poerink BJ (2018) Comparing the results of four widely used automated bat identification software programs to identify nine bat species in coastal Western Europe. Belgian J Zool 148:119–128
Braun De Torrez EC, Samoray ST, Silas KA, Wallrichs MA, Gumbert MW, Ober HK, McCleery RA (2017) Acoustic lure allows for capture of a high-flying, endangered bat. Wildl Soc Bull 41:322–328
Brinkmann R, Behr O, Niermann I, Reich M (2011) Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen: Ergebnisse eines Forschungsvorhabens. Umwelt Raum 4:457 S
Budenz T, Gessner B, Lüttmann J, Molitor F, Servatius K, Veith M (2017) Up and down: western barbastelles actively explore lattice towers – implications for mortality at wind turbines? Hystrix 28:272–276
Burgin CJ, Colella JP, Kahn PL, Upham NS (2018) How many species of mammals are there? J Mammal 99:1–14
Burt WH (1943) Territoriality and home range concepts as applied to mammals. J Mammal 24:346–252
BVerfG (2018) Beschluss des Ersten Senats vom 23. Oktober 2018 – 1 BvR 2523/13 –, Rn. 1–36. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/10/rs20181023_1bvr252313.html. Zugegriffen am 14.01.2022
Chaves-Ramierez S, Castillo-Salazar C, Sanchez-Chavarria M, Solis-Hernandez H, Chaverri G (2022) Comparing the efficiency of monofilament and traditional nets for capturing bats. R Soc Open Sci 8:211404
Clement MJ, Murray KL, Solick DI, Gruver JC (2014) The effect of call libraries and acoustic filters on the identification of bat echolocation. Ecol Evol 4:3482–3493
Cryan PM, Jameson JW, Baerwald EF, Willis CKR, Barclay RMR, Apple Snider E, Crichton EG (2012) Evidence of late-summer mating readiness and early sexual maturation in migratory tree-roosting bats found dead at wind turbines. PLoS ONE 7:e47586
Cryan PM, Gorresen PM, Hein CD, Schirmacher MR, Diehl RH, Huso MMP, Hayman DTS, Fricker PD, Bonaccorso FJ, Johnson DH (2014) Behavior of bats at wind turbines. Proc Natl Acad Sci USA 111:15126–15131
Deutsche Windguard (2021) Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/. Zugegriffen am 02.02.2022
Dietz M, Bögelsack K, Dawo B, Krannich A (2013) Habitatbindung und räumliche Organisation der Bechsteinfledermaus. In Dietz C (Hrsg) Populationsökologie und Habitatansprüche der Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii. Beiträge zur Fachtagung in der Trinkkuranlage Bad Nauheim, 25.–26.02.2011. S 85–103
Dietz C, Kiefer A (2020) Die Fledermäuse Europas: Kennen, bestimmen, schützen. 2. Aufl. Kosmos, Stuttgart, S 399
Doerpinghaus A, Eichen C, Gunnemann H, Leopold P, Neukirchen M, Petermann J, Schröder E (2005) Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Natursch Biol Vielfalt 20:454
Domínguez del Valle J, Cervantes Peralta F, Arjona J (2020) Factors affecting carcass detection at wind farms using dogs and human searchers. J Appl Ecol 57:1926–1935
Dürr T (2021a) Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Fledermäuse. Fledermäuse in Deutschland. Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Stand 7. Mai 2021 https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fledermaeuse-Uebersicht-de.xlsx. Zugegriffen am 14.01.2022
Dürr T (2021b) Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Fledermäuse. Fledermäuse in Europa. Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Stand 7. Mai 2021 https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fledermaeuse-Uebersicht-Europa.xlsx. Zugegriffen am 14.01.2022
Encarnação J, Becker N (2018) Seminatürliche Fledermaushöhlen als funktionaler CEF-Ausgleich – Ergebnisse aus einem 7-jährigen Monitoringprojekt und Mikroklimaanalysen. Tagung „Evidenzbasierter Fledermausschutz 2018“ (Poster). https://www.researchgate.net/project/Seminatuerliche-Fledermaushoehlen-FH1500C-als-kurzfristig-funktionale-Interimsloesung-zum-Ausgleich-von-Baumhoehlenverlust. Zugegriffen am 15.03.2022
European Commission (2007) Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC 88. 88 p.
Evans LB, Bass HE, Sutherland LC (1971) Atmospheric absorption of sound: theoretical predictions. J Acoust Soc Am 51:1565–1575
Ferre M, de Lucas M, Janss GFE, Casado E, Muñoz AR, Bechard MJ, Calabuig CP (2012) Weak relationship between risk assessment studies and recorded mortality in wind farms. J Appl Ecol 49:38–46
Ferreira DF, Jarrett C, Atagana PJ, Powell LL, Rebelo H (2021) Are bat mist nets ideal for capturing bats? From ultrathin to bird nets, a field test. J Mammal 102:1627–1634
Fleischmann D, Kerth G (2014) Roosting behavior and group decision making in 2 syntopic bat species with fission-fusion societies. Behav Ecol 25:1240–1247
Francis CM (1989) A comparison of mist nets and two designs of harp traps for capturing bats. J Mammal 70:865–870
Frick WF, Baerwald EF, Pollock JF, Barclay RMR, Szymanski JA, Weller TJ, Russel AL, Loeb SC, Medellin RA, McGuire LP (2017) Fatalities at wind turbines may threaten population viability of a migratory bat. Biol Conserv 209:172–177
Frick WF, Kingston T, Flanders J (2019) A review of the major threats and challenges to global bat conservation. Ann NY Acad Sci 1469:5–25
Fritsch G, Bruckner A (2017) Operator bias in software-aided bat call identification. Ecol Evol 4:2703–2713
Fritze M, Lehnert LS, Heim O, Lindecke O, Röleke M, Voigt CC (2020) Windenergievorhaben und Fledermausschutz: Was fordern Expert*innen zur Lösung des Grün-Grün-Dilemmas? In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin, S 161–173
Gebhard F, Kötteritzsch A, Lüttmann J, Kiefer A, Hendler R, Veith M (2016) Bewirken Arbeitshilfen eine Qualitätssteigerung von Fachgutachten zu Fledermäusen bei der Planung von Windenergieanlagen? Natursch Landschaftspl 48:177–183
Getz WM, Wilmers CC (2004) A local nearest-neighbor convex-hull construction of home ranges and utilization distributions. Ecography 27:489–505
Getz WM, Fortmann-Roe S, Cross PC, Lyons AJ, Ryan SJ, Wilmers CC (2007) LoCoH: nonparameteric kernel methods for constructing home ranges and utilization distributions. PloSOne 2:e207
Graf M, Frede M (2013) Zur Quartier- und Raumnutzung von Bechsteinfledermäusen in ehemaligen Eichen-Niederwäldern des Kreises Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen). In Dietz C (Hrsg) Populationsökologie und Habitatansprüche der Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii. Beiträge zur Fachtagung in der Trinkkuranlage Bad Nauheim, 25.–26.02.2011. S 269–279
Grün W (2016) CEF-Maßnahmen in der Planungspraxis. Natursch Landschaftspl 48:234–236
Gukasova A, Vlaschenko A (2011) Effectiveness of mist-netting of bats (Chiroptera, Mammalia) during the non-hibernation period in oak forests of Eastern Ukraine. Acta Zool Cracov Ser A Vertebrata 54:77–93
Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, Stenmans W, Müller A, Sumser H, Hörrer T, Goulson D, de Kroon H (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One 12:e0185809
Happ C, Sutor A, Hochradel K (2021) Methodology for the automated visual detection of bird and bat collision fatalities at onshore wind turbines. J Imaging 7:272
Hein C, Gruver J, Arnett E (2013) Relating pre-construction bat activity and post-construction bat-fatality to predict risk at wind energy facilities: a synthesis. Bericht im Auftrag des National Renewable Energy Laboratory. Golden, S 21. https://tethys.pnnl.gov/publications/relating-pre-construction-bat-activity-post-construction-bat-fatality-predict-risk. Zugegriffen am 14.01.2022
von Helversen O, Heller K-G, Mayer F, Nemeth A, Volleth M, Gombkötö P (2001) Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (Myotis alcathoe n. sp.) in Europe. Naturwissenschaften 88:217–223
Hill DA, Armstrong KN, Barden PA (2015) Preliminary assessment suggests that acoustic lures can increase capture rates of Australian echolocating bats. Aust Mammal 37:104–106
Hill DA, Greenway F (2005) Effectiveness of an acoustic lure for surveying bats in British woodlands. Mammal Rev 35:116–122
Hillen J, Kiefer A, Veith M (2009) Foraging site fidelity shapes the spatial organisation of a population of female western barbastelle bats. Biol Cons 142:817–823
Hillen J, Kiefer A, Veith M (2010) Interannual fidelity to roosting habitat and flight paths by female western barbastelle bats. Acta Chiropt 12:187–195
Hillen J, Veith M (2013) Resource partitioning in three syntopic forest-dwelling European bat species (Chiroptera: Vespertilionidae). Mammalia 77:71–80
Hiryua S, Bates ME, Simmons JA, Riquimaroux H (2010) FM echolocating bats shift frequencies to avoid broadcast-echo ambiguity in clutter. Proc Nat Acad Sci USA 107:7048–7053
HMUKLV/HMWEVW (Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen) (2020) Gemeinsamer Runderlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen; Verwaltungsvorschrift (VwV) „Naturschutz/Windenergie“. https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/VVHE-VVHE000017550. Zugegriffen am 14.01.2022
Holbech LH (2020) The elevated mist-net frame: a robust and versatile manoeuvrable design for capturing upper strata birds. Methods Ecol Evol 11:1086–1091
Horn JW, Arnett EB, Kunz TH (2008) Behavioral responses of bats to operating wind turbines. J Wildl Manag 72:123–132
Hurst J, Balzer S, Biedermann M, Dietz C, Dietz M, Höhne E, Karst I, Petermann R, Schorcht W, Steck C, Brinkmann R (2015) Erfassungsstandards für Fledermäuse bei Windkraftprojekten in Wäldern. Natur Landschaft 90:157–168
Hurst J, Biedermann M, Dietz C, Dietz M, Karst I, Krannich E, Petermann R, Schorcht W, Brinkmann R (Hrsg) (2016) Fledermäuse und Windkraft im Wald. Natursch Biol Vielfalt 153:400. Bonn-Bad Godesberg (Bundesamt für Naturschutz)
Hurst J, Biedermann M, Dietz C, Dietz M, Reers H, Karst I, Petermann R, Schorcht W, Brinkmann R (2020) Windkraft im Wald und Fledermausschutz – Überblick über den Kenntnisstand und geeignete Erfassungsmethoden und Maßnahmen. In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin, S 29–54
Hutterer R, Ivanova T, Meyer-Cords C, Rodrigues L (2005) Bat migrations in Europe: a review of literature and analysis of banding data. Naturschutz Biol Vielfalt 28:1–172
IPCC (2021) Summary for policymakers. In Masson-Delmotte V, Zhai P, Pirani A, Connors SL, Péan C, Berger S, Caud N, Chen Y, Goldfarb L, Gomis MI, Huang M, Leitzell K, Lonnoy E, Matthews JBR, Maycock TK, Waterfield T, Yelekçi O, Yu R, Zhou B (Hrsg) Climate change 2021. The physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press
IWES F (2018) Ausbaustand und Ausbauziele der Windenergie in den Bundesländern. Stand 2018. http://windmonitor.iee.fraunhofer.de/windmonitor_de/3_Onshore/7_karten/. Zugegriffen am 14.01.2022
Jameson JW, Willis CKR (2014) Activity of tree bats at anthropogenic tall structures: implications for mortality of bats at wind turbines. Anim Behav 97:145–152
Kalko EKV, Schnitzler HU (1993) Plasticity in echolocation signals of European pipistrelle bats in search flight: implications for habitat use and prey detection. Behav Ecol Sociobiol 33:415–428
Kenward R (2001) A manual for wildlife radio tagging. Academic Press, San Diego/London
Kerth G, König B (1999) Fission, fusion and non-random associations in female Bechstein’s bats (Myotis bechsteinii). Behaviour 136:1187–1202
Kingston T, Francis CM, Akbar Z, Kunz TH (2003) Species richness in an insectivorous bat assemblage from Malaysia. J Trop Ecol 19:67–79
KNE (Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende) (2018) Synopse der technischen Ansätze zur Vermeidung von potenziellen Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse durch die Windenergienutzung. https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/2018/. Zugegriffen am 25.01.2022
KNE (Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende) (2019) Empfehlungen für die Qualitätssicherung von Fledermausgutachten in Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen – Ergebnisse eines KNE-Fachdialogs. https://www.naturschutz-energiewende.de/dialog/empfehlungen-fuer-die-qualitaetssicherung-von-fledermausgutachten-in-planung-und-genehmigung-von-windenergieanlagen-2/. Zugegriffen am 05.03.2022
Korner-Nievergelt F, Korner-Nievergelt P, Behr O, Niermann I, Brinkmann R, Hellriegel B (2011) A new method to determine bird and bat fatality at wind energy turbines from carcass searches. Wildl Biol 17:350–363
Kotowska D, Zegarek M, Osojca G, Satory A, Pärt T, Zmihorski M (2020) Spatial patterns of bat diversity overlap with woodpecker abundance. PeerJ 8:1–18
Kruszynski C, Bailey LD, Bach L, Bach P, Fritze M, Lindecke O, Teige T, Voigt CC (2022) High vulnerability of juvenile Nathusius’ pipistrelle bats (Pipistrellus nathusii) at wind turbines. Ecol Appl 2022:e2513
Kunz TH, Parsons S (2009) Ecological and behavioral methods for the study of bats, 2. Aufl. The John Hopkins University Press, Baltimore
Kurtze W (2013) Chiropterologische Gutachten – Kritik und Vorschläge zur Optimierung. Nyctalus (N.F.) 18:11–21
LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz) (2009) Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetztes. 26 S. https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/49599. Zugegriffen am 14.01.2022
Laforge A, Archaux F, Coulon A, Sirami C, Froidevaux J, Gouix N, Ladet S, Martin H, Barré K, Roemer C, Claireau F, Kerbiriou C, Barbaro L (2021) Landscape composition and life-history traits influence bat movement and space use: analysis of 30 years of published telemetry data. Global Eco Biogeography 2012:1–13
LANU (Landesamt für Natur und Umwelt) (2008) Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei Windenergieplanungen in Schleswig-Holstein. https://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Law BS, Reinhold L, Pennay M (2002) Geographic variation in the echolocation calls of Vespadelus spp. (Vespertilionidae) from New South Wales and Queensland, Australia. Acta Chiropt 4:201–215
Lehnert LS, Kramer-Schadt S, Schönborn S, Lindecke O, Niermann I, Voigt CC (2014) Wind farm facilities in Germany kill noctule bats from near and far. PLoS One 9:e103106
Leitl R (2020) Fledermäuse in Wäldern Nordostbayerns. Erfassung vorhandener Kästen und deren Belegung in einer Synchronzählung im Sommer 2017. Bayerisches Landesamt für Umwelt und den Bayerischen Staatsforsten, Augsburg, S 117
Lemen C, Freeman P, White JA, Andersen BR (2015) The problem of low agreement among automated identification programs for acoustical surveys of bats. West North Am Nat 75:218–225
LfU BY (Landesamt für Umwelt Bayern) (2017a) Arbeitshilfe Fledermausschutz und Windkraft. Teil 1: Fragen und Antworten. Fachfragen des bayerischen Windenergie-Erlasses. https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:34,AARTxNR:lfu_nat_00329,AARTxNODENR:350310,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X. Zugegriffen am 14.01.2022
LfU BY (Landesamt für Umwelt Bayern) (2017b) Arbeitshilfe Fledermausschutz und Windkraft. Teil 2: Verringerung des Kollisionsrisikos. Fachfragen des bayerischen Windenergie-Erlasses. https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:34,AARTxNR:lfu_nat_00330,AARTxNODENR:350311,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X. Zugegriffen am 14.01.2022
LfU BY (Landesamt für Umwelt Bayern) (2017c) Arbeitshilfe Fledermausschutz und Windkraft. Teil 3: Schlussfolgerungen aus dem Gondelmonitoring. Fachfragen des bayerischen Windenergie-Erlasses. https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:34,AARTxNR:lfu_nat_00331,AARTxNODENR:350312,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X. Zugegriffen am 14.01.2022
LfU RLP (Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz) (2018) Arbeitshilfe Mopsfledermaus. https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU_final_MUEEF.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Lindemann C, Proelß A, Veith M. (o. J.) Is the ‚bat population‘ a non-operational concept for statutory protection?
Lindemann C, Runkel V, Kiefer A, Lukas A, Veith M (2018) Abschaltalgorithmen für Fledermäuse an Windenergieanlagen – Eine naturschutzfachliche Bewertung. Natursch Landschaftspl 50:418–425
Lintott PR, Fuentes-Montemayor E, Goulson D, Park KJ (2013) Testing the effectiveness of surveying techniques in determining bat community composition within woodland. Wildl Res 40:675
Lintott PR, Richardson SM, Hosken DJ, Fensome SA, Mathews F (2016) Ecological impact assessments fail to reduce risk of bat casualties at wind farms. Curr Biol 26:R1135–R1136
Lintott PR, Davison S, Van Breda J, Kubasiewicz L, Dowse D, Daisley J, Mathews F (2017) Ecobat: an online resource to facilitate transparent, evidence-based interpretation of bat activity data. Ecol Evol 8:935–941
Long CV, Flint JA, Lepper PA (2011) Insect attraction to wind turbines: does colour play a role? Eur J Wildl Res 57:323–331
LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) (2014) Hinweise zur Untersuchung von Fledermausarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen. https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/Untersuchungsumfang_Fledermaeuse_Endfassung_01_04_2014.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Lukas A (2016) Vögel und Fledermäuse im Artenschutzrecht. Die planerischen Vorgaben des §44 BNatSchG. Natursch Landschaftspl 48:289–295
LUNG (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) (2010) Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern – Hauptmodul Planfeststellung/Genehmigung. https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
LUNG (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) (2016) Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA), Teil Fledermäuse. https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/aab_wea_fled.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
MacSwiney GMC, Clarke FM, Racey PA (2008) What you see is not what you get: the role of ultrasonic detectors in increasing inventory completeness in Neotropical bat assemblages. J Appl Ecol 45:1364–1371
Marques JT, Ramos Pereira MJ, Marques TA, Santos CD, Santana J, Beja P, Palmeirim JM (2013) Optimizing sampling design to deal with mist-Net avoidance in Amazonian birds and bats. PLoS ONE 8:e74505
Mathews F, Swindells M, Goodhead R, August TA, Hardman P, Linton DM, Hosken DJ (2013) Effectiveness of search dogs compared with human observers in locating bat carcasses at wind-turbine sites: a blinded randomized trial. Wildl Soc Bull 37:34–40
Meinig H, Boye P, Dähne M, Hutterer R, Lang J (2020) Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. Natursch Biol Vielfalt 170:73
MELUR und LLUR (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume; Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) (2016) Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) innerhalb des potenziellen Beeinträchtigungsbereiches und des Prüfbereiches bei einigen sensiblen Großvogelarten. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/eingriffsregelung/Downloads/errichtungWEA.pdf?__blob=publicationFile&v=3. Zugegriffen am 02.02.2022
MELUR und LLUR (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume; Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) (2017) Integration artenschutzrechtlicher Vorgaben in Windkraftgenehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG). https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/Downloads/artenschutzrechtlicheVorgaben.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Zugegriffen am 14.01.2022
Meschede A, Heller K-G (2000) Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. Schriftenr Landschaftspfl Natursch 66:374
Meschede A, Schorcht W, Karst I, Biedermann M, Fuch, D, Bontadina F (2017) Wanderrouten der Fledermäuse. BfN-Skripten 453:237
MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen) (2013) Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20130205_nrw_leitfaden_massnahmen.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen) (2017) Leitfaden „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring“. https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20170309_methodenhandbuch%20asp%20einfuehrung.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
MLUL (Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft)) (2010) Handlungsempfehlung zum Umgang mit Fledermäusen bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Brandenburg (Anlage 3 zum WEE). https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Windkrafterlass_Anlage3.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Mortimer G (2006) Foraging, roosting and survival of natterer’s bats, Myotis nattereri, in a commercial coniferous plantation. Unpublished PhD thesis, University of St Andrews. https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/6483. Zugegriffen am 23.02.2022
Müller J, Brandl R, Buchner J, Pretzsch H, Seifert S, Strätz C, Veith M, Fenton B (2013) From ground to above canopy—Bat activity in mature forests is driven by vegetation density and height. Forest Ecol Manag 306:79–184
MUGV (Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) (2014) Leitfaden des Landes Brandenburg für Planung, Genehmigung und Betrieb von Windkraftanlagen im Wald. https://lewatana.de/wp-content/uploads/2016/12/Brandenburg_Leitfaden-WKA-im-Wald_Mai-2014.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
MULE (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie) (2018) Leitfaden „Artenschutz an Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalt“. 47 S https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
MULNV, LANUV (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) (2017) Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“. https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20171110_nrw%20leitfaden%20wea%20artenhabitatschutz_inkl%20einfuehrungserlass.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Murray KL, Britzke ER, Robbins LW (2001) Variation in search-phase calls of bats. J Mammal 82:728–737
Nicholls B, Racey PA (2007) Bats avoid radar installations: could electromagnetic fields deter bats from colliding with wind turbines? PLoS ONE 2(3):e297
Niermann I, Brinkmann R, Korner-Nievergelt F, Behr O (2011) Systematische Schlagopfersuche – Methodische Rahmenbedingungen, statistische Analyseverfahren und Ergebnisse. In Brinkmann R, Behr O, Niermann I, Reich M. Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an On shore-Windenergieanlagen. Göttingen, Cuvillier, Umwelt und Raum 4, S 40–115
Niermann I, Korner-Nievergelt F, Brinkmann R, Behr O (2015) Kollisionsopfersuchen als Grundlage zur Überprüfung der Wirksamkeit von Abschaltalgorithmen. In Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). Behr O, Brinkmann R, Korner-Nievergelt F, Nagy M, Niermann I, Reich M, Simon R (Hrsg) Hannover, Institut für Umweltplanung: Umwelt und Raum 7, S 165–204
NMUEK (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz) (2016) Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“. https://www.umwelt-online.de/regelwerk/cgi-bin/suchausgabe.cgi?pfad=/bau/laender/nds/wealeitf16.htm&such=RdErl. Zugegriffen am 14.01.2022
Obrist MK, Boesch R, Flückiger PF (2007) Variability in echolocation call design of 26 Swiss bat species: consequences, limits and options for automated field identification with a synergetic pattern recognition approach. Mammalia 68:307–322
O’Mara MT, Wikelski M, Dechmann DKN (2014) 50 Years of bat tracking: device attachment and future directions. Meth Ecol Evol 5:311–319
O’Shea TJ, Bogan MA, Ellison LE (2003) Monitoring trends in bat populations of the United States and territories: status of the science and recommendations for the future. Wildl Soc Bul 31:16–29
O’Shea TJ, Cryan PM, Hayman DT, Plowright RK, Streicker DG (2016) Multiple mortality events in bats: a global review. Mammal Rev 46:175–190
Philipp-Gerlach U (2017) Fledermauskästen und Nutzungsverzicht in Wäldern erfüllen die Anforderungen an vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) nicht. Recht der Natur – Schnellbrief 205:68–69
Regnery B, Couvet D, Kubarek L, Julien JF, Kerbiriou C (2013a) Tree microhabitats as indicators of bird and bat communities in Mediterranean forests. Ecol Indicators 34:221–230
Regnery B, Paillet Y, Couvet D, Kerbiriou C (2013b) Which factors influence the occurrence and density of tree microhabitats in Mediterranean oak forests? Forest Ecol Manag 295:118–125
Richardson SM, Lintott PR, Hosken DJ, Economou T, Mathews F (2021) Peaks in bat activity at turbines and the implications for mitigating the impact of wind energy developments on bats. Sci Rep 11:3636
Rodrigues L, Bach L, Dubourg-Savage M-J, Karapandža B, Kovač D, Kervyn T, Dekker J, Kepel A, Bach P, Collins J, Harbusch C, Park K, Micevski B, Mindermann J (2016) Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windenergieprojekten – Überarbeitung 2014. EUROBATS Publication Series No. 6, UNEP/EUROBATS Sekretariat, Bonn, Deutschland, S 146
Romano WB, Skalski JR, Townsend RL, Kinzie KW, Coppinger KD, Miller MF (2019) Evaluation of an acoustic deterrent to reduce bat mortalities at an Illinois wind farm. Wildl Soc Bull 43:608–618
Rueegger N (2016) Bat boxes—a review of their use and application, past, present and future. Acta Chiropt 18:279–299
Runge H, Simon M, Widdig T (2009) Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben, FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. Bonn, S 97
Runkel V, Gerding G, Marckmann U (2018) Handbuch: Praxis der akustischen Fledermauserfassung. tredition, Hamburg, S 244
Runkel V (2020) Akustische Erfassung von Fledermäusen – Möglichkeiten und Grenzen im Bau und Betrieb von Windkraftanlagen. In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin, S 3–27
Russ J (2021) Bat calls of Britain and Europe. A guide to species identification. Pelagic Publishing (Exeter), S 462
Russo D, Voigt CC (2016) The use of automated identification of bat echolocation calls in acoustic monitoring: a cautionary note for a sound analysis. Ecol Indicators 66:598–602
Russo D, Ancillotto L, Jones G (2018) Bats are still not birds in the digital era: echolocation call variation and why it matters for bat species identification. Can J Zool 96:63–78
Rydell J, Bach L, Dubourg-Savage MJ, Green M, Rodrigues L, Hedenström A (2010) Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe. Acta Chiropt 12:261–274
Rydell J, Nyman S, Eklöf J, Jones G, Russo D (2017) Testing the performances of automated identification of bat echolocation calls: a request for prudence. Ecol Indicators 78:416–420
Samoray ST, Gumbert MW, Roby PL, Janos GA, Borthwick RR (2019) Effectiveness of acoustic lures for increasing Indiana bat captures in mist-nets. J Fish Wildl Manag 10:206–212
Sändig S, Schnitzler HU, Denzinger A (2014) Echolocation behaviour of the big brown bat (Eptesicus fuscus) in an obstacle avoidance task of increasing difficulty. J Exper Biol 217:2876–2884
Schnitzler HU, Kalko EKV (2001) Echolocation by insect-eating bats. Bioscience 51:557–569
Schuler KL, Schroeder GM, Jenks JA, Kie JG (2014) Ad hoc smoothing parameter performance in kernel estimates of GPS-derived home ranges. Wildl Biol 20:259–266
Schirmacher MR (2020) Evaluating the effectiveness of an ultrasonic acoustic deterrent in reducing bat fatalities at wind energy facilities. United States: N. p. https://doi.org/10.2172/1605929. https://www.osti.gov/biblio/1605929. Zugegriffen am 25.01.2022
Segers J, Broders H (2014) Interspecific effects of forest fragmentation on bats. Can J Zool 92:665–673
Seibold S, Gossner MM, Simons NK, Blüthgen N, Müller J, Ambarlı D, Ammer C, Bauhus J, Fischer M, Habel JC, Linsenmair KE, Nauss T, Penone C, Prati D, Schall P, Schulze E-D, Vogt J, Wöllauer S, Weisser WW (2019) Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. Nature 574:671–674
Silverman BW (1986) Density estimation for statistics and data analysis, Monographs on statistics and applied probability, 26. Chapman & Hall, Boca Raton
Simon R, Hochradel K, Mages J, Nagy M, Naucke A, Niermann I, Webea N, Behr O (2015) Methoden akustischer Erfassung der Fledermausaktivität an Windenergieanlagen. Umwelt Raum 7:39–80
Singer D, Hondong H, Dietz M (2021) Habitat use of Bechstein’s bat (Myotis bechsteinii) and woodpeckers reveals the importance of old-growth features in European beech forests. Forest Ecol Manag 498:119547
Smallwood KS, Bell DA, Standish S (2020) Dogs detect larger wind energy effects on bats and birds. J Wildl Manag 84:852–864
Stidsholt L, Greif S, Goerlitz HR, Beedholm K, Macaulay J, Johnson M, Madsen PT (2021) Hunting bats adjust their echolocation to receive weak prey echoes for clutter reduction. Sci Adv 7:eabf1367
Thomas DW, Bell GP, Fenton MB (1987) Variation in echolocation call frequencies recorded from North American Vespertilionid bats: a cautionary note. J Mammal 68:842–847
TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015) Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Fledermausschutzes bei der Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen. https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/1_zool_artenschutz/artenschutz_windenergie/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121_.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Trautner J (2020) Artenschutz. Rechtliche Pflichten, fachliche Konzepte, Umsetzung in der Praxis. Ulmer, Stuttgart, S 218
Trenz M (2015) Deskriptive Auswertung der Datengrundlage und Konfliktbewertung von Fledermaus-Gutachten in Rheinland-Pfalz. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Universität Trier. https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/BIO/Datenbank_sortiert/03Forschung/Projekte/BatLab/Bachelorarbeit.Trenz.2015.pdf. Zugegriffen am 25.01.2022
Trusch R, Falkenberg M, Mörtter R (2020) Auswirkung von Windenergieanlagen auf nachtaktive Insekten. Carolinea 78:73–128
UMK (Umweltministerkonferenz) (2020) Ergebnisprotokoll zur 94. Umweltministerkonferenz am 15. Mai 2020. https://www.umweltministerkonferenz.de/Dokumente-UMK-Protokolle.html. Zugegriffen am 02.02.2022
Vanderelst D, Holderied MW, Peremans H (2015) Sensorimotor model of obstacle avoidance in echolocating bats. PLoS Comput Biol 11:1–31
Veith M, Buglowski S, Frohn F, Kiefer A, Runkel V (2022) Wie sensibel reagiert ProBat auf Änderungen der Windgeschwindigkeit und der festgelegten Schlagopferzahl von Fledermäusen? Ein Vergleich der Programmversionen 5.4, 6.2 und 7.0. Natursch Landschaftspl 54:24–31
Voigt CC (2020) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin/Heidelberg, S 178
Voigt CC (2021) Insect fatalities at wind turbines as biodiversity sinks. Cons Sci Prac 3:e366
Voigt, CC, Kingston, T (Hrsg) (2016) Bats in the anthropocene. Conservation of bats in a changing world. Springer, Heidelberg, S 606
Voigt CC, Lehnert LS, Petersons G, Adorf F, Bach L (2015) Wildlife and renewable energy: German politics cross migratory bats. Eur J Wildl Res. http://link.springer.com/10.1007/s10344-015-0903-y. Zugegriffen am 14.01.2022.
Voigt CC, Rehning K, Lindecke O, Pētersons G (2018) Migratory bats are attracted by red light but not by warm- white light: implications for the protection of nocturnal migrants. Ecol Evol 8:9353–9361
Voigt CC, Roeleke M, Heim O, Lehnert LS, Fritze M, Lindecke O (2020) Expert*innenbewertung der Methoden zum Fledermausmonitoring bei Windkraftvorhaben. In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin, S 57–76
Voigt CC, Roeleke M, Marggraf L, Pētersons G, Voigt-Heucke SL (2017) Migratory bats respond to artificial green light with positive phototaxis. PLoS ONE 12:e0177748
Voigt CC, Russo D, Runkel V, Goerlitz HR (2021) Limitations of acoustic monitoring at wind turbines to evaluate fatality risk of bats. Mammal Rev 51:559–570
Vonhof MJ, Barclay RMR (1996) Roost-site selection and roosting ecology of forest-dwelling bats in southern British Columbia. Can J Zool 74:1797–1805
VSW HE, RP und SL und LUWG (Staatliche VSW für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland; Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht) (2012) Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz. Artenschutz (Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete. https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Wagner S (2021) Zur Rolle artenschutzrechtlicher Ausnahmen im Rahmen der raumordnerischen Konzentrationszonenplanung für die Windenergie: Ausnahmevoraussetzungen nach 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG. Nat Recht 43:803–811
Weber J, Köppel J, Geißler G (2020) Best-Available-Science/Information-Mandat – evidenzbasierter Artenschutz in den USA. In: Voigt CC (Hrsg) Evidenzbasierter Fledermausschutz in Windkraftvorhaben. Springer, Berlin, S 147–160
White GC, Garrott RA (1990) Analysis of wildlife radio-tracking data. Academic Press, San Diego
Wilson DE, Mittermeier RA (Hrsg) (2019) Handbook of the mammals of the world. Vol. 9 Bats. Lynx Edicions, Barcelona
Zahn A, Hammer M (2017) Zur Wirksamkeit von Fledermauskästen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme. ANLiegen Natur 39:27–35
Zahn A, Hammer M, Pfeiffer B (2021a) Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen für vorhabenbedingt zerstörte Fledermausbaumquartiere. Hinweisblatt der Koordinationsstellen für Fledermausschutz in Bayern: 23 S; www.tierphys.nat.fau.de/files/2021/07/empfehlung_vermeidung_cef_fcs-masnahmen_fledermausbaumquartiere_2021.pdf. Zugegriffen am 14.01.2022
Zahn A, Hammer M, Pfeiffer B (2021b) Hinweisblatt zu artenschutzrechtlichen Maßnahmen für vorhabenbedingt zerstörte Fledermausquartiere. ANLiegen Natur 43:11–16
Zeus VM, Reusch C, Kerth G (2018) Long-term roosting data reveal a unimodular social network in large fission-fusion society of the colony-living Natterer’s bat (Myotis nattereri). Behav Ecol Sociobiol 72:99
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Veith, M., Lindemann, C., Kiefer, A., Koch, M. (2023). Windkraft und Fledermausschutz im Wald – eine kritische Betrachtung der Planungs- und Zulassungspraxis. In: Voigt, C.C. (eds) Evidenzbasiertes Wildtiermanagement. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65745-4_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-65745-4_7
Published:
Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-65744-7
Online ISBN: 978-3-662-65745-4
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)