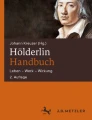Zusammenfassung
Innerhalb der für die jüdische Religion und Kultur bedeutsamen Responsa-Praxis lassen sich bei den drei großen jüdischen Denominationen distinkte rhetorische Profile ausmachen, die durch die jeweiligen institutionellen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen der einzelnen Richtungen geprägt sind. Die Respondenten des Orthodoxen Judentums greifen auf eine tradierte, in traditionellen Kontexten vermittelte Rhetorik zurück, während sich in den Responsa des Konservativen Judentums und des Reformjudentums jeweils eigene rhetorische Profile herausgebildet haben, die sich vorrangig der gängigen rhetorisch-kommunikativen Mittel der Mehrheitskultur bedienen. Den Respondent/innen aller drei Denominationen ist gemeinsam, dass sie sich – in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichem Ausmaß – der Persuasivität des Responsa-Genres und der Bedeutung der rhetorischen Einfassung ihrer Argumente bewusst sind und sie persuasive Elemente zur Aktivierung ihrer jeweiligen community of interpretation daher auch gezielt einsetzen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- Jüdische Responsa
- Argumentation und Persuasion
- Orthodoxes Judentum
- Konservatives Judentum
- Liberales Judentum
Die hebräische Bezeichnung für das Responsa-Genre she’elot u-teshuvot, ‚Fragen und Antworten‘, betont den dialogischen Charakter dieses Genres, der schon für sich genommen eine Untersuchung der in Responsa Anwendung findenden Rhetoriken geradezu herausfordert. Ein Responsum ist ein Gutachten, das eine religiöse Autorität als Antwort auf eine schriftlich gestellte Anfrage verfasst. Innerhalb der jüdischen Traditionsliteratur bilden Responsa ein eigenes, umfangreiches Genre, das sich über einen Zeitraum von mehr als 1300 Jahren in verschiedenen Kulturräumen dynamisch entwickelt hat und bis heute praktiziert wird. Für die Untersuchung der historischen Entwicklung der jüdischen Rechtspraxis und des religiösen Selbstverständnisses stellen Responsa eine wesentliche Quelle dar. Ein Großteil der in Responsa verhandelten Fragen sind Fragen der praktischen Halacha, des jüdischen Religionsgesetzes, die sich insbesondere aus veränderten Lebensumständen und kulturellem Wandel ergeben.Footnote 1 Die Grundform eines Responsums setzte sich ab dem 11. Jahrhundert mit den sog. rabbinischen Responsa, die die Entscheidung eines Einzelnen darstellen, durch.Footnote 2 In den Responsa wird die Entscheidung des Respondenten in der Regel nicht nur mitgeteilt, sondern sie wird begründet, um sie für die Anfragenden argumentativ nachvollziehbar zu machen und den Adressaten des Responsums damit von der ‚Richtigkeit‘ der getroffenen Entscheidung und von der halachischen Autorität des Respondenten zu überzeugen und die Entscheidung so als verbindlich durchzusetzen. Die Argumentation, nach Perelman und Olbrechts-Tyteca ein wesentliches Element rhetorischer Kommunikation,Footnote 3 bildet demnach den essenziellen Kern eines Responsums. Moshe Feinstein, als Posek haDor, als ‚Dezisor der [aktuellen] Generation‘, einer der einflussreichsten Poskim, ‚Dezisoren‘, des 20. Jahrhunderts, betont entsprechend in seinem Vorwort zu seiner Responsa-Sammlung Iggrot Moshe, in dem er die Responsa-Praxis reflektiert, die zentrale Relevanz der Ausführung der Argumentation, denn nur durch sie könne der Leser die Methodik halachischer Entscheidensprozesse erlernen.Footnote 4 Daher spricht sich Feinstein auch deutlich gegen eine verkürzte, ausschließlich das Entscheidungsresultat mitteilende Wiedergabe seiner Responsa aus.Footnote 5 Neben den inhaltlichen Argumenten kommt in diesem auf die Zustimmung der Leser/innen abzielenden Genre auch rhetorischen Strategien eine zentrale Funktion zu. In der in der Responsa-Literatur häufig zu findenden Formulierung, dass ein Gelehrter wörtlich ‚schön [yafeh]‘, d. h. ‚überzeugend‘ bzw. ‚richtig‘ geschrieben habe, manifestiert sich prägnant das persuasive Element dieses Genres durch die Verbindung von inhaltlicher Überzeugungskraft und rhetorischer Ästhetik.
Von Peter Haas und insbesondere von Marc Washofsky, der an das Law- and Literature-Movement anknüpft, wurden Ansätze entwickelt, die sich auf Responsa als literarische Texte, auf halachische Entscheidungsfindung als interpretativen Prozess sowie auf die Rhetorik von Responsa fokussieren. Im Anschluss an Washofskys Forschungsansatz (und zugleich über das allgemeine Postulat einer rhetorischen Verfasstheit von Responsa hinausgehend) soll im Folgenden erstmals gezeigt werden, dass sich innerhalb der drei großen jüdischen Denominationen – Orthodoxie (Abschn. 1.) sowie Konservatives Judentum/Masorti (Abschn. 2.) und Reformjudentum bzw. Liberales oder Progressives Judentum (Abschn. 3.) – jeweils distinkte rhetorische Profile im Hinblick auf das Responsa-Genre herausgebildet haben. Diese spezifischen rhetorischen Profile sind – so die These – durch das jeweilige religiöse Selbstverständnis sowie, damit verbunden, durch die jeweiligen institutionellen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen der einzelnen Denominationen maßgeblich geprägt.
1 Orthodoxe Responsa
Der Begriff ‚Orthodoxie‘ ist gegenwärtig ein Sammelbegriff für ein breites Spektrum an Gruppierungen, die von ultraorthodox bis zu modernorthodox reichen. In Abgrenzung von anderen jüdischen Denominationen verstehen sich die Anhänger der Orthodoxie als Repräsentant/innen eines authentischen und normativen Judentums. Die Halacha stellt für die Anhänger der Orthodoxie theonomes und damit normatives Recht dar, dessen Gültigkeit außer Zweifel steht und das daher unveränderlich ist. Die Auslegung des jüdischen Rechts erfolgt unter Anwendung der spezifisch rabbinischen Hermeneutik und in Orientierung an orthodoxen Interpretationskonventionen.
Intertextualität und Argumentationsmuster
Die rhetorische Ausgestaltung orthodoxer Responsa zeichnet sich wesentlich durch spezifische, von der Tradition vorgegebene Formen von Intertextualität und Argumentationsmuster aus. Um die Antwort des Respondenten auf der Grundlage des jüdischen Rechts zu legitimieren, finden sich in den Responsa autoritätsstiftende Verweise auf die gesamte jüdische Traditionsliteratur in Form von Zitaten und Anspielungen. So erhebt der erwähnte Posek haDor Moshe Feinstein den Anspruch, dass seine Positionen ausschließlich auf „Tora-Wissen [yediat hatora]“ – gemeint ist hier die gesamte Überlieferung der schriftlichen und mündlichen Tora – und nicht auf „äußeren Kenntnissen“, d. h. auf Wissen außerhalb des orthodoxen Halacha-Verständnisses, gegründet seien.Footnote 6 Der Respondent analysiert die für die Thematik des Responsums relevanten halachischen Quellen in der Reihenfolge der Hierarchisierung der Autoritäten nach der Tradition, wodurch der Argumentationsgang orthodoxer Responsa nach wiederkehrenden, spezifischen Mustern strukturiert ist.Footnote 7 Durch die intertextuellen Bezüge zur jüdischen Traditionsliteratur und den Rekurs auf überlieferte Autoritätshierarchien und, damit verbunden, durch die Anwendung von der Tradition vorgegebener Argumentationsmuster soll der Leser davon überzeugt werden, dass der Respondent seine Antwort in Auseinandersetzung mit den Meinungen der Autoritäten in der Halacha aufgefunden hat, statt lediglich nach Begründungen für eine vorgefasste Meinung zu suchen. Auf diese Weise sollen die halachische Expertise des Respondenten unter Beweis gestellt und die Kontingenz des Entscheidens zum Verschwinden gebracht werden.
Topoi, Metaphern und Semantiken
Die rhetorische Ausgestaltung orthodoxer Responsa zeichnet sich zudem durch die Verwendung von in der Tradition vorgegebenen zentralen Topoi und Metaphern aus. Einer dieser für das Genre zentralen Topoi ist der Bescheidenheitstopos, für den häufig die charakteristische Formulierung „Meiner bescheidenen Meinung nach“ verwendet wird. Mit dem Rückgriff auf den Bescheidenheitstopos, der bereits in der mittelalterlichen Responsa-Literatur etabliert ist, geben die Respondenten eine Zurückhaltung vor, die jedoch gerade ihrer Kompetenz als halachische Experten umso mehr Gewicht verleihen soll.Footnote 8 Ein weiterer geläufiger Topos ist der facettenreiche Autoritätstopos. Dieser Topos besteht in der Berufung auf die Autorität der schriftlichen und mündlichen Tora per se, etwa, wenn Feinstein jegliche Kritik an seiner Entscheidung mit dem Verweis auf die „Lehre der Wahrheit [torat emet] aus den Worten unserer Gelehrten, der Rischonim“Footnote 9 zu unterbinden versucht, oder in der Berufung auf eine bestimmte Autorität. Zugleich wird der Autoritätstopos in zahlreichen Semantiken manifest, denen allen gemeinsam ist, dass sie die Autorität des Respondenten – subtil oder explizit – unter Beweis stellen sollen, indem sie betonen, dass der Respondent es auf Grund seiner Gelehrsamkeit vermag, die an ihn gerichteten Anfragen oder halachische Positionen anderer Gelehrter zu bewerten, z. B. wenn Unverständnis über eine an den Respondenten gerichtete Anfrage ausgedrückt oder diese entweder affirmativ oder ablehnend bewertet wird.Footnote 10
Vor dem Hintergrund der zentralen Funktion, die der Argumentation innerhalb des Responsa-Genres zukommt, wird von den Respondenten häufig auch der Topos des Prüfens und Wählens verwendet. Dieser Topos wird zum einen auf die Poskim selbst bezogen. Moshe Feinstein etwa betont, dass er die an ihn gerichteten Anfragen erst nach einer sorgfältigen Analyse der relevanten halachischen Quellen beantworte: „Selbst auf die Ausführungen unserer großen Gelehrten stütze ich mich nicht blind, sondern ich habe sie mit größter Anstrengung geprüft“.Footnote 11 Andere Gelehrte fordert er dazu auf, seine Argumentation zu prüfen,Footnote 12 wobei er selbstverständlich davon ausgeht, eine stringente und überzeugende Argumentation vorgelegt zu haben. Zum anderen beziehen die Poskim diesen Topos auf die Leser, was insbesondere die Aufforderungen „Und der Wähler wähle!“Footnote 13 prägnant verdeutlicht: Der Leser möge die Argumentation prüfen und dann wählen, das heißt, eine Entscheidung für verbindlich anerkennen oder ablehnen.Footnote 14 Durch das Appellieren an die Kompetenz ihrer Leser, die subtil betont und nicht bestritten wird, versuchen die Respondenten zweifellos gleichzeitig auch, die Adressaten für ihre Position einzunehmen. Daher wird gerade in dem Topos des Prüfens und Wählens das persuasive Element der rhetorischen Kommunikation von Responsa besonders manifest.
Eine für die orthodoxe Responsa-Literatur zentrale Metapher ist die Metapher des Weges (derekh), die für den halachischen Argumentationsgang verwendet wird. Zusätzlich klingt die Konnotation des Lebenswandels im Sinne der HalachaFootnote 15 an. Von zahlreichen Poskim wird die Bezugnahme auf die halachische Argumentation anderer Gelehrter entsprechend mit der Formulierung „Und diesen Weg beschritt auch […]“ eingeleitet.Footnote 16 Die halachische Argumentation eines anderen Gelehrten wird dabei affirmierend etwa auch als „neuer Weg“ bezeichnet.Footnote 17 Zudem findet in der Responsa-Literatur häufig eine Hell-Dunkel-Metaphorik Anwendung, um die Klarheit und Eindeutigkeit von halachischen Positionen hervorzuheben. So wird beispielsweise die Metapher vom „klaren [bahir]“, d. h. erleuchteten Auge eines Respondenten verwendet oder die damit im Zusammenhang stehende Formulierung, dass bestimmte Aussagen nicht das „Auge“ anderer erwähnter Respondenten „verdunkeln“ würden.Footnote 18 In diesem Kontext ist auch der zur Betonung von Klarheit und Wirkmächtigkeit einer Aussage veranschaulichende Vergleich „lichtvoll wie die Sonne“ oder, noch deutlicher, „lichtvoll wie die Sonne zu Mittag“ zu sehen.Footnote 19
Darüber hinaus durchziehen das gesamte Responsa-Genre spezifische Semantiken, deren Funktionen darin bestehen, religiöse Autorität zu generieren. Dabei greifen die Poskim auf ein durch die Tradition vorgegebenes breites und differenziertes Spektrum an spezifischen Formulierungen mit graduellen Abstufungen zurück. Dazu gehört vor allem die bereits in mittelalterlichen Responsa geläufige, unmissverständliche Formulierung „Das ist klar und einfach“,Footnote 20 die jegliche Ambiguität ausschließen soll. Zu kategorischen Semantiken, die der Unterbindung eines möglichen Widerspruchs dienen, gehört etwa, dass es sich um „eine klare und nicht anfechtbare Angelegenheit“ handle, über die „keineswegs zu diskutieren“Footnote 21 sei.
Kommunikationsformen und Codes
Nicht zuletzt sind die orthodoxen Responsa insgesamt geprägt durch eigene, von der Tradition vorgegebene Kommunikationsformen und durch die Verwendung spezifisch orthodoxer Codes, die in den letzten, entscheidenden Feinheiten nur von Lesern mit demselben religiösen Hintergrund und von Angehörigen derselben kulturellen Praxis verstanden werden. Dazu gehören Anspielungen auf die Hebräische Bibel und die gesamte jüdische Traditionsliteratur, die sich in Wortspielen, einzelnen Worten und Formulierungen finden und durch die die Argumentation weitere Ebenen der Kommunikation erhält. Nicht zuletzt eignet sich diese rhetorische Technik hervorragend für emotionale Appelle und für die Kommunikation eines Hinter- und Nebensinns ‚zwischen den Zeilen‘. Zu den spezifischen Kommunikationsformen und Codes gehört auch die Verwendung bestimmter Formeln im Einleitungsteil der Responsa, wie die Eingangsformel „mit Gottes Hilfe“ sowie die Anrede eines anderen Gelehrten als „mein verehrungswürdiger, geschätzter Kollege“,Footnote 22 oder im Schlussteil der Responsa Formeln wie „Derjenige, der schreibt und unterschreibt zur Ehre der Tora“Footnote 23 oder „[Ich verbleibe als] Sein hochachtungsvoller Kollege“.Footnote 24 Die Verwendung von innerhalb der orthodoxen Welt etablierten und verbreiteten Akronymen für Gelehrte und Werktitel sowie Abkürzungen bestimmter Formulierungen durchzieht und prägt die gesamte ultraorthodoxe und orthodoxe Responsa-Literatur. Auch die Bezugnahme auf andere Gelehrte ist durch spezifische Ehrerbietungs- und Respektformeln geprägt, wie z. B. die Verwendung des Ehrentitels Gaon, ‚der Erhabene‘, für einen herausragenden Gelehrten, die Bezeichnung der früheren Gelehrten mit dem Akronym Chasa”l [‚Unsere Weisen, möge ihr Andenken gesegnet sein‘] oder die Verwendung des Akronyms Shlit”a [‚Möge er ein langes und gutes Leben leben. Amen‘] als Zusatz zu den Gelehrtennamen. Zugleich verwenden die Respondenten ein breites Spektrum an traditionellen Gottesnamen und Gottesbezeichnungen. Charakteristisch für die Rhetorik der orthodoxen Responsa ist zudem die häufige Verwendung von Exklamationen wie „Gelobt sei Gott“ bzw. „Das behüte Gott“, die außer ihrer Funktion als etablierte Stilfigur auf Gott als oberste Instanz innerhalb der Praxis religiösen Entscheidens verweisen.Footnote 25
Identitäts- und Alteritätskonstruktionen
Die Rhetorik orthodoxer Responsa ist nicht zuletzt auch wesentlich geprägt durch die für die orthodoxe Weltsicht essenziellen Identitäts- und Alteritätskonstruktionen, die von dem Daʽat Tora-Konzept (‚Tora-Wissen‘) ausgehen, das für die orthodoxe Auffassung rabbinischer Autorität maßgeblich ist.Footnote 26 Die orthodoxen Identitäts- und Alteritätskonstruktionen lassen sich auf verschiedenen Ebenen fassen, zu denen insbesondere die Gegenüberstellung von Religion vs. Moderne und Säkularismus, Tradition vs. Innovation, Glaube vs. Wissenschaft, jüdisch vs. nichtjüdisch, Männer vs. Frauen sowie jüdische Orthodoxie vs. andere jüdische Denominationen gehören. Grundlegend für die dichotomische orthodoxe Weltsicht ist dabei das aus dem 19. Jahrhundert stammende antimodernistische Diktum „Neues ist von der Tora verboten“Footnote 27 des Posek Moses Sofer, der die Entstehung der Orthodoxie in Europa im 19. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst hat. Der Niederschlag dieser dichotomischen Weltanschauung auf rhetorischer Ebene soll am Beispiel des Häresie-Topos exemplifiziert werden. Die ultraorthodoxe Gleichsetzung von religiöser Reform mit „Aufruhr gegen den Namen, gesegnet sei er, [d. h. Gott] und die Tora“Footnote 28 sowie mit Häresie schlägt sich in polemischen Bezeichnungen für deren Anhänger/innen nieder, etwa in Menashe Kleins und Moshe Feinsteins Bezeichnung von Repräsentanten des Reformjudentums und des Konservativen Judentums als „Häretiker/Abtrünnige [kofrim]“Footnote 29 bzw., im Falle Feinsteins, von Frauen, die für ihre religiöse Gleichberechtigung eintreten, als „Häretikerinnen/Abtrünnige [kofrot]“Footnote 30. An Hochzeitszeremonien des Reformjudentums Teilnehmende werden als „böse/frevelhaft“Footnote 31 abqualifiziert. Von Rabbinern des Konservativen Judentums vorgenommene Konversionen werden als rituell „untauglich [psulin]“Footnote 32 klassifiziert, wobei der Begriff ‚conservative‘ in diesem Kontext als verachtenswert beschrieben wird. Als ultraorthodoxer Posek geht Feinstein sogar so weit, religiöse Reformversuche als „Krieg“Footnote 33 zu bezeichnen. Um auch auf rhetorischer Ebene die Distanz von den anderen jüdischen Denominationen zum Ausdruck zu bringen und die orthodoxe Gruppenzugehörigkeit zu stärken, benutzen Klein und Feinstein ausschließlich für orthodoxe Rabbiner die traditionelle Bezeichnung ‚rabbanim‘; Rabbiner des Konservativen Judentums und des Reformjudentums hingegen werden als ‚Rabbis‘ (in der Aussprache des amerikanischen Englisch) bezeichnet, wodurch ihnen die Anerkennung als religiöse Autoritäten abgesprochen wird.Footnote 34
Insgesamt sind die orthodoxen Responsa durch bestimmte Formen von Intertextualität, durch feste Argumentationsmuster, durch spezifische Topoi, Metaphern, Semantiken sowie durch spezifische Kommunikationsformen und Codes grundlegend geprägt, sodass sich von einer genre- und kulturspezifischen Rhetorik sprechen lässt. Die Funktion dieser den ultraorthodoxen und orthodoxen Responsa inhärenten Rhetorik ist neben dem Überzeugen des Empfängers die Etablierung der Autorität des Verfassers – auch und gerade in Abgrenzung zu Gelehrten, die andere Meinungen vertreten – sowie die Aktivierung einer community of interpretation. Wenngleich diese Rhetorik als solche kein eigener separater Lehrgegenstand des traditionellen religiösen Studiums ist und damit in der orthodoxen Welt keinen Gegenstand theoretischer Durchdringung darstellt, sind sich die religiösen Gelehrten der Bedeutung einer rhetorischen Einfassung ihrer Argumente bewusst. Der Gebrauch der spezifisch orthodoxen Rhetorik beruht auf einer bewussten Aneignung einer distinkten kulturellen Praxis sowie einer Orientierung an etablierten Vorbildern und damit auf Tradierung.
2 Konservatives Judentum
Grundlegend für das religiöse Selbstverständnis des Konservativen Judentums ist die Überzeugung, dass eine Synthese von Tradition und Moderne möglich und erstrebenswert ist. Das Konservative Judentum vertritt ein wesentlich anderes Halacha-Verständnis als die Orthodoxie, das in der Grundsatzerklärung Emet ve’Emunah. Statement of Principles of Conservative Judaism von 1988 prägnant zusammengefasst wird. Die Halacha wird für unverzichtbar gehalten, allerdings in Gestalt einer dynamisch zu interpretierenden Halacha, die dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung trägt und als fortlaufender Prozess verstanden wird, der notwendig ist, um die jüdische Tradition lebendig zu erhalten. Der Halacha wird eine zentrale identitätsstiftende, ethische und soziale Funktion für das Individuum und die Gemeinschaft zugeschrieben, wobei die Halacha nur als ein, wenn auch unverzichtbares Element von verschiedenen Konstituenten jüdischer Identität bestimmt wird:
Halakhah in its developing form is an indispensable element of a traditional Judaism which is vital and modern. Halakhah is not the entirety of our Jewish identity; Judaism includes the ethical and theological reflections embodied in its lore (aggadah), a history, a commitment to a specific land and language, art, music, literature, and more. Judaism is indeed a civilization in the fullest sense of the term. But Halakhah is fundamental to that civilization.Footnote 35
Das nichtnormative Halacha-Verständnis geht einher mit einer Affirmation von religiösem Pluralismus – sowohl innerhalb der eigenen Denomination als auch in Bezug auf die jüdische Gemeinschaft insgesamt. Diese Haltung gegenüber religiösem Pluralismus sowie das Ideal einer Synthese von Tradition und Moderne implizieren darüber hinaus eine Distanzierung von den traditionellen, für orthodoxe Responsa maßgeblichen Autoritäts- und Hierarchisierungskonzepten. Die Responsa-Praxis des Konservativen Judentums weist daher gegenüber der des Orthodoxen Judentums grundlegende Änderungen auf. Neu ist vor allen Dingen, dass die Responsa innerhalb eines institutionellen Rahmens verfasst werden und nicht mehr nur eine Einzelentscheidung darstellen. In den USA, in denen das Konservative Judentum gegenwärtig die zweitgrößte Denomination darstellt,Footnote 36 werden die Responsa innerhalb des Committee on Jewish Law and Standards (CJLS) der Rabbinical Assembly (RA), des Dachverbands der Rabbiner/innen des Konservativen Judentums in den USA, verfasst. Bedeutsam ist zunächst, dass Responsa in diesem institutionellen Rahmen nicht mehr ausschließlich von Respondenten verfasst werden, sondern – entsprechend der religiösen Gleichberechtigung von Frauen innerhalb des Konservativen Judentums – auch von Respondentinnen.Footnote 37 Gemäß den veränderten Autoritäts- und Hierarchisierungskonzepten werden in das Entscheidensverfahren auch Laien einbezogen. Insgesamt gehören dem Gremium fünfundzwanzig stimmberechtigte Rabbiner/innen an, fünf nicht stimmberechtigte Laienvertreter/innen der United Synagogue, d. h. des Hauptverbands der dem Konservativen Judentum zuzurechnenden Gemeinden in den USA, sowie eine nicht stimmberechtigte Kantorin bzw. ein nicht stimmberechtigter Kantor der Cantor’s Assembly. Wird eine Anfrage von Mitgliedern der Rabbinical Assembly oder anderer Institutionen des Konservativen Judentums an das CJLS gerichtet, verfassen Komitee-Mitglieder zu dieser Anfrage Responsa, die dann in Subkomitees diskutiert werden. Anschließend wird von den stimmberechtigten Mitgliedern des gesamten Komitees über die Responsa abgestimmt. Wird ein Responsum mit mindestens sechs Stimmen angenommen, wird es als offizielle halachische Position des Konservativen Judentums veröffentlicht. Zu ein- und demselben Thema können zeitgleich mehrere Responsa als offizielle halachische Positionen des CJLS veröffentlicht werden.Footnote 38 Den lokalen Rabbiner/innen wird explizit das Recht auf individuelle Entscheidungen eingeräumt, falls die jeweiligen lokalen Umstände dies erfordern sollten. Zudem können Mitglieder des Komitees abweichende Meinungen vorlegen, die gemeinsam mit dem durch das CJLS als offizielle halachische Position genehmigten Responsum auf dessen Webseite veröffentlicht werden, jedoch keinen offiziellen Status besitzen. Innerhalb des Konservativen Judentums wird damit ein formalisiertes, transparentes und auf Prinzipien repräsentativer Demokratie beruhendes halachisches Entscheidensverfahren praktiziert, in dem Responsa als Kollektiventscheidungen des CJLS legitimiert werden und das gleichzeitig das Pluralismuskonzept des Konservativen Judentums berücksichtigt. Die Abfassung der Responsa des Konservativen Judentums in der LandesspracheFootnote 39 wirkt sich grundlegend auf ihr rhetorisches Profil aus und bedeutet einen Bruch mit der den orthodoxen Responsa inhärenten Rhetorik. Die Responsa des CJLS sind auf Englisch verfasst; allerdings ist dem Hebräischen ein zwar eingeschränkter, aber fester Funktionsbereich zugewiesen, der die Verbindung zum Erbe der Tradition aufrechterhalten soll: Zitate aus der jüdischen Traditionsliteratur werden im Original mit englischer Übersetzung angeführt. Halachische Fachtermini werden in der Regel bei den Leser/innen als bekannt vorausgesetzt. Für etablierte jüdische Gelehrte verwenden einige Respondent/innen die traditionellen Akronyme, z. B. Rambam für Moses Maimonides, andere Respondent/innen verwenden die latinisierten Namen.
Aufbau und Struktur
Zentrales formales Kennzeichen der Responsa des Konservativen Judentums ist zunächst, dass im Anschluss an die Nennung der Verfasser/innen und des Titels des Responsums das Abstimmungsergebnis zu dem jeweiligen Responsum angegeben wird, wobei die einzelnen Voten der an der Abstimmung teilnehmenden Rabbiner/innen des CJLS namentlich aufgeführt werden und das Ergebnis für die Leser/innen transparent ist. Mehrheitlich werden die dann folgende Frage und Antwort mit den entsprechenden hebräischen Begriffen she’ela (‚Frage‘) und teshuva (‚Antwort‘) betitelt, entweder in hebräischen Buchstaben oder transkribiert. Indem die Dokumente schon durch diese Benennungen in das traditionelle Responsa-Genre eingereiht werden, erheben die Respondent/innen des Konservativen Judentums den Anspruch, legitimer Teil der Responsa-Praxis zu sein,Footnote 40 auch wenn ihre Texte in vielerlei Hinsicht – vor allem in sprachlicher, inhaltlicher und rhetorischer – von der traditionellen Grundform eines Responsums abweichen. Insgesamt orientieren sich Aufbau, Struktur und Form der Responsa des Konservativen Judentums jedoch eher an einem akademischen Diskussionspapier bzw. einem Beitrag in einem akademischen Journal. In den oftmals umfangreichen Responsa wird nach einer Einleitung, in der das analytische Vorgehen erläutert wird, die Argumentation entfaltet, häufig in einzelnen, mit Zwischenüberschriften gekennzeichneten und unter systematischen Aspekten gegliederten Abschnitten. Das Responsum schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Nicht selten integrieren die Respondent/innen ihren Text abschließend noch einmal explizit in den Halacha-Diskurs, indem sie einen Psak Din, eine halachische Entscheidung, formulieren. Die Orientierung an akademischen Formaten manifestiert sich nicht zuletzt auch in der Verwendung umfangreicher Fußnotenapparate, die eine grundsätzlich veränderte Textualität von Responsa erzeugen und, anders als in der traditionellen Responsa-Praxis, zwei Textebenen und -teile unterschiedlicher Gewichtung voneinander abgrenzen. Den Fußnoten, die schon für sich genommen für einen wissenschaftlichen Anspruch stehen, kommt die Funktion von „small narratives“Footnote 41 zu. Die Respondent/innen verwenden die Fußnoten für Belege, Verweise auf weiterführende Literatur, zusätzliche, z. T. auch persönlich gehaltene Kommentare sowie für Danksagungen für erhaltene Hinweise. Ergänzt werden die Fußnoten durch umfangreiche Bibliographien und z. T. auch Appendices.
Intertextualität und Ressourcen des Entscheidens
Entsprechend dem Verständnis des Konservativen Judentums ist die Halacha die oberste Ressource des Entscheidens. Insofern sind die Responsa des Konservativen Judentums zunächst geprägt durch intertextuelle Bezüge zu der gesamten jüdischen Traditionsliteratur von der Antike bis zur Gegenwart, wobei, anders als in den orthodoxen Responsa, in denen die Zitate oftmals nicht gekennzeichnet sind, alle Zitate aus der Traditionsliteratur als solche kenntlich gemacht werden. Zusätzlich zu der jüdischen Traditionsliteratur werden in den Responsa des Konservativen Judentums zahlreiche weitere Ressourcen des Entscheidens aus den verschiedensten Bereichen genutzt. Dazu gehören wissenschaftliche Literatur, die die unterschiedlichsten Fachgebiete abdeckt, Zeitungsartikel, juristische, psychologische und theologische Literatur, Statistiken, Bezugnahmen auf das Zivilrecht und die Human Rights Campaign, Theaterstücke und Filme und persönliche Erfahrungen. In einem Responsum zu der Frage, ob Abtreibungen nach der Halacha erlaubt seien, wird sogar auf eine Entscheidung der Katholischen Kirche sowie eine Fatwa Bezug genommen.Footnote 42
Argumentation und Persuasion
Anders als die Argumentation orthodoxer Responsa ist die Argumentation der Responsa des Konservativen Judentums keine normative. Die Entscheidung der Respondent/innen wird nicht als in der Halacha aufgefunden dargestellt, sondern die Analyse der Halacha erfolgt aus einer Perspektive, die die Quellen kontextualisiert und auf ihre hermeneutischen Prämissen und das methodische Vorgehen fokussiert. Dabei fließen zum Teil auch meta-halachische Reflexionen ein, die der Argumentation eine abstraktere, methodologische Ebene verleihen. Zum Teil gehen die Respondent/innen bei ihrer Analyse der halachischen Quellen chronologisch vor, zum Teil aber auch nach systematischen Kriterien. Dabei erheben die Respondent/innen nicht, wie die orthodoxen Respondenten, den Anspruch auf eine umfassende Erörterung aller potenziell relevanten Quellen, sondern die Analyse konzentriert sich auf die aus Sicht der Respondent/innen wesentlichen Quellen mit direktem Bezug zu der Thematik des Responsums.Footnote 43 Die Analyse der Traditionsliteratur soll die profunden Halacha-Kenntnisse der Respondent/innen unter Beweis stellen und ihre Entscheidung als konform mit der Halacha im Verständnis des Konservativen Judentums legitimieren. Die zahlreichen Verweise auf sehr heterogene nichthalachische und nichtreligiöse Quellen stellen aber auch die breite akademische Bildung der Respondent/innen unter Beweis. In der bereits erwähnten Grundsatzerklärung des Konservativen Judentums wird als ein Charakteristikum des „ideal Conservative Jew“ ausgeführt: „Jewish learning is a lifelong quest through which we integrate Jewish and general knowledge for the sake of personal enrichment, group creativity and world transformation“.Footnote 44 Diese angestrebte Integration von spezifisch jüdischem Wissen und Allgemeinbildung schlägt sich auch in der Argumentation der Responsa nieder. Zentrales Kennzeichen der Responsa des Konservativen Judentums ist zudem die starke Präsenz der Verfasser/innen in Form der ersten Person Singular oder Plural, was sich z. B. in Formulierungen wie „in my view“Footnote 45, „I will argue“Footnote 46 und „we will see“Footnote 47 niederschlägt. Durch den häufigen rhetorischen Einbezug der Leser/innen, insbesondere durch die erste Person Plural, durch Appelle oder rhetorische Fragen,Footnote 48 wird der für das Responsa-Genre zentrale dialogische Charakter gerade auch auf rhetorischer Ebene umgesetzt, wobei die Respondent/innen über individuelle Leser/innen-Instanzen hinaus gehend zum Teil die Denomination des Konservativen Judentums als solche adressieren. Das persuasive Element ist damit in vielen Responsa manifest und wird z. T. auch explizit thematisiert, wie in einem Responsum Myron S. Gellers zu der Frage, ob Frauen in halachischen Angelegenheiten als Zeuginnen auftreten können:
It is my sincere hope that rabbis and laity within our movement will be persuaded by this teshuvah and the support it may receive from CJLS, that edut nashim [Zeugenschaft der Frauen] is acceptable in our day, within the framework of halakhah.Footnote 49
Gesellschaftlicher Wandel
Das Konzept einer Halacha, die dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung trägt und einen fortlaufenden Prozess darstellt, ist, auf Grund seiner Relevanz für das Selbstverständnis des Konservativen Judentums, nicht nur epistemische und hermeneutische Prämisse, sondern zugleich auch zentrales Thema der Responsa. Die Rhetorik der Responsa des Konservativen Judentums ist dementsprechend wesentlich geprägt durch das Bewusstsein veränderter sozialer Realität sowie durch ein Bekenntnis zu den Wertvorstellungen der modernen amerikanischen Gesellschaft. Daher integrieren die Respondent/innen des Konservativen Judentums oft eine quasi-soziologische Perspektive in die Entscheidungsfindung. In zahlreichen Responsa ist gesellschaftlicher Wandel Ausgangspunkt der Argumentation, etwa, wenn Leonard A. Sharzer in seinem Responsum „Transgender Jews and Halakhah“ konstatiert:
The halakhic concern related to transgender Jews was first addressed by the CJLS in 2003 in a teshuvah, „Status of Transsexuals“, by Rabbi Mayer Rabinowitz. In the fourteen years since the approval of that teshuvah, there has been a sea change in our understanding as a society at large, and no less so in the Jewish community, of the meaning of gender and gender identity.Footnote 50
Der gesellschaftliche Wandel impliziere, dass bestimmte halachische Kategorien nicht mehr anwendbar seien:
In order to apply those halakhic categories in ways that are sensitive and compassionate, and at the same time maintain halakhic integrity, we must acknowledge that our understanding of human sex, sexuality, and gender, limited through it may be, is advanced far beyond anything our ancestors could have imagined.Footnote 51
Aus dem gesellschaftlichen Wandel ergibt sich für die Akteur/innen des Konservativen Judentums das Erfordernis von Novellierungen und neuen Interpretationen, um die Halacha weiterhin lebendig zu erhalten.Footnote 52 So betont Pamela Barmash in ihrem Responsum „Women and Mitzvot“ [ ‚Gebote‘] von 2014:
We are aware that our tradition has developed historically, and at times there have been dramatic transformations. We find ourselves in a period of the reinvention of tradition, and we are seeking to preserve tradition by modifying it. [….] We are on a spiritual quest with a modern mind and heart.Footnote 53
Einige Respondent/innen berufen sich auf das halachische Prinzip Shinnui ha-Ittim (‚Die Zeiten haben sich geändert‘), um halachische Novellierungen in Reaktion auf veränderte Zeitumstände als der Tradition selbst inhärent zu legitimieren,Footnote 54 während insbesondere Gordon Tucker für die Entwicklung einer neuen halachischen Methodologie plädiert.Footnote 55
Das Festhalten an Normen, die nicht mit der gesellschaftlichen Realität vereinbar sind, wird von den Respondent/innen daher auch z. T. scharf kritisiert, z. B. in dem von Bradley Shavit Artson verfassten Responsum „The Woman took the Child and Nursed It: A Teshuvah on Breast Feeding in Public“:
How do we, today, respond to the fact that the Rabbis of the Talmud treated women in a less than equal manner, since we find such discrimination distressingly unethical? […] In short, our agenda is to retain general rabbinic concerns of modesty, but stripped of the patriarchal and sexist context that shaped the expression of those concerns in antiquity.Footnote 56
Pluralismus
Religiöser Pluralismus – sowohl innerhalb der eigenen Denomination als auch auf die gesamte jüdische Gemeinschaft bezogen – wird vom Konservativen Judentum keineswegs als „unvermeidbares Übel“ und als Bedrohung wahrgenommen, sondern als Bereicherung und als „Segen“Footnote 57. Für die Entwicklung jüdischen Lebens und Denkens sei der der jüdischen Tradition inhärente religiöse Pluralismus ein positiver, schöpferischer Faktor. Der zentrale Stellenwert, der religiösem Pluralismus und der damit verbundenen religiösen Diskurs- und Meinungsvielfalt seitens des Konservativen Judentums zuerkannt wird, schlägt sich im Hinblick auf die Responsa-Praxis zunächst in der bereits erwähnten Option der Veröffentlichung abweichender Meinungen nieder, die den Dialog zwischen den Respondent/innen innerhalb des Mediums Responsa fördert. Auf der rhetorischen Ebene wird durch die Bezeichnungen der abweichenden Meinungen insbesondere als „Dissenting Opinion“ oder als „Concurrence“ verdeutlicht, dass diese Beiträge als legitimer Teil einer Diskussions- und Auslegungskultur aufgefasst werden sollen. Der grundsätzlich dialogisch-kommunikative Aspekt von Responsa wird damit im institutionellen Rahmen des CJLS bewusst gefördert. Das als abweichende Meinung veröffentlichte Responsum stellt eine direkte Auseinandersetzung mit der Argumentation des offiziell durch das CJLS angenommenen Responsums dar, wobei in der Regel zunächst, wie formelhaft auch immer, Konsenspunkte mit der offiziellen Position betont werden, um im Anschluss daran die Kritikpunkte zu entfalten. So leitet z. B. Jonathan Lubliner seine „Concurring Opinion“ zu Joseph Prousers Responsum „Ana Ger Ana: May a Convert to Judaism Serve on a Bet Din?“ mit den Worten ein: „I commend Rabbi Prouser for his thorough treatment of the halakhic literature regarding the permissibility of a convert serving on a bet din [ ‚Rabbinatsgericht‘], and am in full accordance with his conclusions in affirmative“,Footnote 58 um dann seinen Einwand zu formulieren, der nicht die Entscheidung als solche betrifft, sondern Prousers Funktionsbestimmung des Rabbinatsgerichts.
Die Haltung des Konservativen Judentums zu religiösem Pluralismus impliziert auch die Legitimität unterschiedlicher methodischer Ansätze zur Halacha-Auslegung.Footnote 59 Entsprechend finden sich in den Responsa nicht nur theoretische Reflexionen über die methodischen Ansätze innerhalb des Konservativen Judentums,Footnote 60 sondern auch direkte Auseinandersetzungen über die z. T. zwischen den Respondent/innen divergierenden methodischen Ansätze, was besonders Mayer Rabinowitz’ und Joel Roth’ insgesamt vier Responsa zu der Frage nach der Ordination von Frauen zu Rabbinerinnen verdeutlichen.Footnote 61 Beide Respondenten gelangen zu derselben Entscheidung, weichen aber in der Methode der Halacha-Auslegung grundsätzlich voneinander ab, was sie auch thematisieren: „Though we clearly come to some identical conclusions, it is equally clear that we arrive at them in very different ways. On certain points of halakhic theory we differ significantly“.Footnote 62 Auch die grundsätzliche Anerkennung des positiven Werts religiöser Vielfalt innerhalb des gesamten Judentums und das Bekenntnis zu Klal Israel (‚Ganz Israel‘), d. h., zum Volk Israel und dem Judentum in seiner Gesamtheit, das die Legitimität unterschiedlicher Zugänge zur jüdischen Tradition und der Existenz anderer jüdischer Denominationen impliziert,Footnote 63 schlägt sich auf der rhetorischen Ebene nieder. So werden bei der Analyse der halachischen Quellen auch die Positionen der zeitgenössischen orthodoxen Poskim einbezogen, die in einem sachlichen, differenzierten Ton analysiert werden.Footnote 64 Auch wenn die orthodoxen Autoritäts- und Hierarchisierungskonzepte seitens des Konservativen Judentums nicht anerkannt werden, wird die Legitimität dieser Konzepte innerhalb des orthodoxen Judentums nicht negiert, sondern als religiöse und soziale Realität akzeptiert.Footnote 65 Auch Diskurse des Reformjudentums werden in den Responsa des Konservativen Judentums rezipiert, wobei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den beiden Denominationen erörtert werden.Footnote 66 Im Rahmen eines grundsätzlichen Bekenntnisses zu religiösem Pluralismus sowie zu Klal Israel erfolgt die Auseinandersetzung mit den beiden anderen großen jüdischen Denominationen in den Responsa aus der Perspektive einer distinkten religiösen Denomination, deren spezifisch religiöses Selbstverständnis und deren Leistungen deutlich und selbstbewusst hervorgehoben werden.
3 Reformjudentum
Im Zentrum des religiösen Selbstverständnisses des Reformjudentums steht der erklärte Anspruch, eine moderne Denomination zu sein, die es vermag, zeitgemäße jüdische Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart zu geben.Footnote 67 Zu den grundlegenden Prinzipien des Reformjudentums gehören vor allem Ethik, Moral, soziale Gerechtigkeit sowie die Autonomie des Individuums. Das Reformjudentum der Gegenwart ist insgesamt traditionsgebundener als in seinen Anfängen, was sich auch in der Haltung zur Halacha widerspiegelt. Nachdem die Legitimität der Halacha im ersten Jahrhundert des Bestehens des Reformjudentums wiederholt bestritten worden war, wird ihr nunmehr als identitätsstiftendes Erbe insgesamt ein positiver, zentraler Wert zuerkannt.Footnote 68 Auf der Grundlage der Überzeugung der Geschichtlichkeit der Offenbarung vertritt das gegenwärtige Reformjudentum ein nicht-normatives, prozessual-diskursives Halacha-Verständnis: „We see halachah as a discourse, an ongoing conversation through which we arrive at an understanding, however tentative, of what God and Torah require of us“.Footnote 69 Eine in dieser Weise verstandene Halacha ist der Ausgangspunkt für die Responsa-Praxis der Central Conference of American Rabbis (CCAR), des Dachverbands der Reformrabbiner/innen in den USA, wo das Reformjudentum die größte jüdische Denomination darstellt.Footnote 70 Innerhalb des Reformjudentums sind das Responsa-Genre als solches wie auch die Praxis, religiöse Fragen über ein Responsum zu beantworten, keineswegs unumstritten und unterscheiden sich allein schon dadurch grundsätzlich in ihren Voraussetzungen von den beiden anderen großen jüdischen Denominationen. Zu den von Anhänger/innen des Reformjudentums geäußerten Kritikpunkten gehört, dass das Verfassen von Responsa geradezu eine Antithese zum Selbstverständnis des Reformjudentums als einer modernen Denomination darstelle.Footnote 71 Die in Responsa explizit wie auch implizit vorgenommene Unterscheidung zwischen ‚richtigen‘ und ‚falschen‘ Antworten bedeute einen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit des Individuums und sei nicht mit dem Prinzip persönlicher religiöser Autonomie vereinbar. Die Entscheidungsgrundlage der Responsa seien nicht mehr zeitgemäße, antike und mittelalterliche Texte und damit eine Vergangenheit, von der sich das Reformjudentum längst emanzipiert habe.Footnote 72 Kritisiert wird zudem, dass hauptsächlich für das Reformjudentum irrelevante Detailfragen religiöser Observanz Gegenstand von Responsa seien: „Since the halakhic world is not our world, we should not waste time writing halakhic literature“.Footnote 73 Trotz dieser Einwände hält die CCAR an der Responsa-Praxis fest. Die skizzierten Kritikpunkte werden insbesondere mit dem Argument zu widerlegen versucht, dass es keine unbegrenzte religiöse Autonomie geben könne und dass die persönliche religiöse Autonomie im Rahmen der Denomination des Reformjudentums ausgeübt werden müsse.Footnote 74 Aus einer kritischen Perspektive heraus bleibe die jüdische Tradition auch im Reformjudentum unverzichtbarer Ausgangspunkt für Diskussionen über religiöse Fragen ebenso wie die Halacha selbst, die zentraler Bestandteil dieser Tradition sei. Als Ausdruck der Identifikation mit dem jüdischen Erbe sei es das Bestreben der Respondent/innen, traditionelle halachische Zugänge aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber die Observanz der Halacha mit den religiösen, moralischen und kulturellen Konzepten des Reformjudentums in Einklang zu bringen.Footnote 75 In diesem Sinne sei das Reformjudentum sehr wohl eine „‚halachische‘ Bewegung“Footnote 76. Die von Reformrabbiner/innen verfassten Responsa sollen daher nach Auffassung des CCAR nicht als autoritativ verstanden werden. Auch wenn die Respondent/innen davon überzeugt seien, die bestmöglichen Antworten auf die an sie gerichteten Fragen zu geben, sei es keineswegs ihre Intention, mit dem Verfassen von Responsa jegliche Diskussion zu beenden; vielmehr sollen gerade mithilfe der Responsa halachische Diskussionen innerhalb des Reformjudentums gefördert werden.Footnote 77 Der dialogische Charakter des Responsa-Genres wird mit dieser Funktionsbestimmung besonders betont. Ein Dialog soll nicht nur innerhalb des Mediums der Responsa stattfinden, sondern auch weitere kommunikative Prozesse außerhalb desselben einleiten: „A Responsum may be a good answer to a question, but it is certainly an invitation to learning and to debate“.Footnote 78
Gemeinsam ist der Responsa-Praxis des Konservativen Judentums und des Reformjudentums, dass in beiden Denominationen Responsa auch von Frauen verfasst werden.Footnote 79 Zudem sind die institutionellen Voraussetzungen der Responsa-Praxis des Konservativen Judentums und des Reformjudentums vergleichbar: Auch innerhalb des Reformjudentums werden Responsa in einem speziellen Komitee der CCAR verfasst. Seit den 1990er Jahren stellen die Responsa des CCAR Kollektiventscheidungen dar, mit denen sich die Respondent/innen explizit in die Tradition der Responsa aus der Zeit der Geonim stellen. Um den Kollektivcharakter der Responsa auch rhetorisch zu untermauern, wird in den Responsa durchgehend entweder die erste Person Plural verwendet oder in der dritten Person Singular oder Plural über das Responsa-Komitee und seine Mitglieder gesprochen.
Wie innerhalb des Responsa-Komitees der RA wird auch innerhalb des Responsa-Komitees der CCAR über die Responsa abgestimmt, wobei das Abstimmungsergebnis nicht zusammen mit den Responsa veröffentlich wird. Im Falle von Dissens wird, anders als im Konservativen Judentum, die abweichende Meinung nicht als eigenständige Meinung veröffentlicht, sondern in der Zusammenfassung des Responsums oder in den Fußnoten anonym angeführt, wobei Dissens insgesamt eher selten ist.
Die Responsa des CCAR sind auf Englisch verfasst. In der Regel werden die Positionen der jüdischen Traditionsliteratur von den Respondent/innen paraphrasierend zusammengefasst. Zitate aus der Traditionsliteratur werden nur in englischer Übersetzung angeführt. Von halachischen Fachtermini wird nur selten Gebrauch gemacht. Wenn die Respondent/innen sie verwenden, dann zumeist mit einer Übersetzung oder Erläuterung – im Sinne einer allgemeinen Verständlichkeit und vermutlich auch zur Weiterbildung religiöser Laien.
Aufbau und Struktur
Die Fragen und Antworten werden mit den transkribierten hebräischen Begriffen She’elah (‚Frage‘) und Teshuva (‚Antwort‘) betitelt, wodurch die Responsa, wie die des Konservativen Judentums, schon in rein formaler Hinsicht in das traditionelle Responsa-Genre eingereiht werden.Footnote 80 Mehrheitlich werden der Verfasser bzw. die Verfasserin der Frage namentlich angegeben. Die Antworten der Responsa des Reformjudentums sind grundsätzlich zweigeteilt: In einem ersten Teil werden die relevanten halachischen Quellen erörtert, in einem zweiten Teil die Position des Reformjudentums, an die sich eine Zusammenfassung anschließt.Footnote 81 Kennzeichen der Responsa des Reformjudentums ist auch ein Fußnotenapparat, in dem Belege, Verweise auf weiterführende Literatur, Kommentare und Danksagungen angeführt werden.
Ressourcen des Entscheidens
Die systematische Zweiteilung der Responsa in die Erörterung der halachischen Positionen einerseits und die Positionen des Reformjudentums andererseits macht bereits manifest, dass die Halacha zwar grundlegend in die Entscheidungsfindung einbezogen wird, aber keineswegs die alleinige oder oberste Ressource des Entscheidens darstellt. Zentrale Ressource des Entscheidens sind in den Reform-Responsa die historischen und aktuellen Positionen des Reformjudentums, die insbesondere über Responsa, Essays und Artikel der führenden Repräsentant/innen des Reformjudentums sowie über Statements der CCAR und über die offiziellen Programme des amerikanischen Reformjudentums umfassend belegt werden. In Responsa zu medizinethischen Fragestellungen wird umfangreich auf medizinische Fachliteratur verwiesen. Zudem wird in die Responsa auch wissenschaftliche, etwa historische und soziologische, sowie juristische Literatur einbezogen.
Argumentation und Persuasion
Wie aus den Schriften und Responsa des CCAR hervorgeht, ist den Respondent/innen die tragende Rolle von Argumentation und Persuasion für das Responsa-Genre durchaus bewusst. Eine erste Theoretisierung der rhetorischen Ausgestaltung von Responsa wurde von Mark Washofsky, von 1996 bis 2007 Vorsitzender des Responsa-Komitees der CCAR, in seinem Vorwort zu der Responsa-Sammlung Reform Responsa for the Twenty-First Century vorgelegt. Da der Respondent den Leser von seiner Interpretation überzeugen müsse, stelle die Argumentation, so Washofsky, die Essenz von Responsa dar: „Each responsum is therefore an exercise in argumentation, an essay which seeks to elicit the agreement of a particular Jewish audience that shares the religious values of its author“.Footnote 82 Die spezifische Funktion von Responsa des Reformjudentums besteht nach Washofsky darin, die notwendigen Grenzen im Hinblick auf die Freiheit selbstverantworteter Entscheidungen ziehen zu können und zugleich, auf Grund der für Responsa zentralen Argumentation, den Dialog über religiöse Fragen zu fördern: „Reform Responsa are best understood as individual building-blocks in a structure of ongoing argument. Our answers therefore claim no finality. We argue our positions, and we realize that others can respond with arguments of their own“.Footnote 83 Die Initiierung des Dialogs über religiöse Fragen als Ziel von Responsa wird auch in den Responsa selbst mehrfach thematisiert.Footnote 84
Die zentrale Bedeutung, die Respondent/innen den persuasiven Elementen zuerkennen, schlägt sich auf der rhetorischen Ebene insbesondere in der direkten Ansprache des in der Regel namentlich bekannten Adressaten nieder, wodurch eine persönliche Kommunikationssituation entsteht. Im Allgemeinen wird dabei Verständnis für die Position der Anfragenden bekundet und der Ton einer nichthierarchischen Kommunikation auf Augenhöhe gewählt, etwa wenn in dem Responsum „Woman as a Scribe“ die Anfragende folgendermaßen direkt angesprochen wird:
You, Ms. Ackerman, ought therefore to be able to serve the entire Jewish community, and not just its liberal segment, as a scribe. […] You say that it is your dream to become a scribe. We say that you have every right to pursue that dream and to serve your people thereby. We pray that God grant you the energy, perseverance, and insight to make your dream come trueFootnote 85
Als ein weiteres rhetorisches Charakteristikum der Responsa ist die häufige Verwendung rhetorischer Fragen mit ihrer persuasiven Funktion zu nennen. Die Argumentation der Responsa ist auch dadurch wesentlich geprägt, dass potenzielle Einwände oftmals bereits angesprochen werden, um sie im Vorfeld entkräften zu können.Footnote 86
Persönliche Autonomie und Pluralismus
Grundlegend für die Responsa des Reformjudentums ist, ausgehend von den konkreten Fragestellungen, der Rekurs auf die erklärten Grundsätze der Denomination zur Stärkung der Gruppenidentität. Rhetorisch schlägt sich der hohe Stellenwert der Gruppenidentität in der häufigen Nennung der Denomination als solcher in Form der ersten Person Plural nieder, etwa, wenn es heißt „As Reform Jews […] we consider“Footnote 87 oder „Our answer, as liberal Jews“Footnote 88. Ein zentrales Thema ist in diesem Kontext das Verhältnis zwischen persönlicher Autonomie einerseits und der Zugehörigkeit zum Kollektiv der Denomination andererseits. Die Betonung der Legitimität individueller selbstverantworteter Entscheidungen sei prägend für den gesamten reformjüdischen religiösen Diskurs: „As Reform Jews, we place a high value upon personal freedom in the realm of the religious observance. Phrases such as ʽabsolute requirementʼ are conspicuous by their absence from typical Reform Jewish religious discourse“.Footnote 89 Entsprechend wird die in den Responsa mitgeteilte Entscheidung in der Regel gezielt unverbindlich als Vorschlag oder Empfehlung formuliert, etwa mit Appellen wie „Let their decision be respected“ oder Formulierungen wie „we find“, „we would counsel“, „we would advice“ oder „we think“. Zu den dringlicheren Formulierungen gehören „We heartily endorse“ oder insbesondere „We strongly urge“.
In den Responsa kommt zudem das für das Reformjudentum bedeutsame Pluralismus-Prinzip zum Tragen. Zum einen wird der Pluralismus innerhalb der eigenen Denomination hervorgehoben, zum anderen wird die religiöse Pluralität der gesamten jüdischen Gemeinschaft anerkannt. Während die Respondent/innen vorhandene Gemeinsamkeiten mit dem Konservativen Judentum und der Modernen Orthodoxie betonen,Footnote 90 ist jedoch die diskursive Auseinandersetzung mit der Orthodoxie als Denomination geprägt durch die skizzierte Polemik seitens der Orthodoxie gegenüber dem Reformjudentum. Im Gegenzug stellen die Respondent/innen des Reformjudentums das eigene Selbstverständnis als moderne, fortschrittliche Denomination heraus, was auch eine theologische und rationale Überlegenheit der eigenen Denomination und damit eine Schlüsselrolle für die Zukunft des Judentums impliziere: „If they are not liberals, we are; if their conception of Judaism cannot make room for diversity, ours does and must. We look upon Orthodox Jews not as enemies but as friends. We greet them not as aliens and heretics but as brothers and sisters“.Footnote 91 Auch wenn der religiöse Pluralismus ein bedeutender Wert für das Reformjudentum darstellt, wird zugleich die Notwendigkeit von Grenzziehungen in diesem Bereich im Interesse einer Gruppenidentität als reformjüdischer Denomination unterstrichen: „Reform Judaism cannot be everything, or it will be nothing“.Footnote 92
4 Fazit
Die Entstehung des Konservativen Judentums und des Reformjudentums hat die traditionelle Responsa-Praxis grundlegend verändert, in institutioneller, in verfahrenstechnischer, inhaltlich-hermeneutischer und nicht zuletzt auch in rhetorischer Hinsicht. Innerhalb der Responsa-Praxis der drei großen jüdischen Denominationen lassen sich jeweils distinkte rhetorische Profile ausmachen, die geprägt sind durch bereits im Grundsatz divergierende Auffassungen der Halacha und, damit einhergehend, durch grundsätzlich unterschiedliche Autoritäts-, Hierarchisierungs- und Gelehrsamkeitskonzepte sowie durch abweichende hermeneutische Ansätze. Die Respondenten des Orthodoxen Judentums greifen eine tradierte, in traditionellen Kontexten vermittelte Rhetorik auf und orientieren sich in der rhetorischen Ausgestaltung ihrer Responsa bewusst an den etablierten Vorbildern ihrer Denomination. In den Responsa des Konservativen Judentums und des Reformjudentums haben sich jeweils eigene rhetorische Profile herausgebildet, denen gemeinsam ist, dass sie sich in erster Linie der gängigen rhetorisch-kommunikativen Mittel der Mehrheitskultur bedienen. Auch wenn die Respondent/innen des Konservativen Judentums und des Reformjudentums das Responsa-Genre in modifizierten Formen praktizieren, stellen sie sich bewusst in die Responsa-Tradition und erheben den Anspruch, ein zeitgemäßer, legitimer Teil dieser Tradition zu sein. Den Respondent/innen aller drei Denominationen ist gemeinsam, dass sie sich – auf je unterschiedliche Weise und in je unterschiedlichem Ausmaß – der Persuasivität des Responsa-Genres und der Bedeutung der rhetorischen Einfassung ihrer Argumente bewusst sind und sie persuasive Elemente zur Aktivierung ihrer jeweiligen community of interpretation daher auch gezielt einsetzen. Die religiöse Vielfalt innerhalb der gegenwärtigen jüdischen Gemeinschaft schlägt sich nicht nur in ihrer jeweils unterschiedlichen Praktizierung des Responsa-Genres als solchem nieder, sondern gerade auch in den distinkten rhetorischen Profilen der drei großen Denominationen. Von einer oder der Rhetorik der gegenwärtigen Responsa-Literatur lässt sich daher nicht sprechen, sondern ausschließlich von Rhetoriken.
Notes
- 1.
Vgl. hierzu ausführlich Grundmann, 2018, 163 f.
- 2.
- 3.
Vgl. Perelman und Olbrechts-Tyteca, 1958.
- 4.
Vgl. Iggrot Moshe, Orach Chayim, 1, Vorwort. Die orthodoxen Responsa werden nach Bar-Ilan University, 2015 zitiert.
- 5.
Vgl. Iggrot Moshe, Yoreh Deah, 3, 91. Vgl. auch Iggrot Moshe, Choshen Mishpat, 2, 72.
- 6.
Iggrot Moshe, Even haEzer, 2, 11. Dennoch nimmt Feinstein selbst in seinen medizinethischen Responsa z. T. Bezug auf medizinisches Expertenwissen. Vgl. z. B. Iggrot Moshe, Choshen Mishpat, 2, 72.
- 7.
Vgl. Grundmann, 2021, 434 f.
- 8.
Vgl. Grundmann, 2021, 438.
- 9.
Iggrot Moshe, Even haEzer, 2, 11.
- 10.
Vgl. z. B. Yabia Omer 4, Orach Chayim 25; Iggrot Moshe, Choshen Mishpat 2,74.
- 11.
Iggrot Moshe, Orach Chayim, 1, Vorwort.
- 12.
Vgl. Iggrot Moshe, Orach Chayim, 1, Vorwort.
- 13.
Vgl. z. B. Tzitz Eliezer 4,14; Yaskil Avdi 2, Even haEzer 4.
- 14.
Vgl. Grundmann, 2021, 439.
- 15.
Das Wort ‚Halacha‘ ist eine Ableitung des Verbs ‚halach‘, gehen. Halacha ist entsprechend wörtlich ‚der zu gehende Weg‘.
- 16.
Vgl. z. B. Tzitz Eliezer 19,26; 17,27; 8,36; Tzemach Yehuda 3,18.
- 17.
Vgl. Tzitz Eliezer, 9,51,3; 18,30; 21,56.
- 18.
Vgl. z. B. Har Tzvi, Yoreh Deah 2; Tzitz Eliezer, 6, 36, 4; Tzitz Eliezer 10, 25,5.
- 19.
Vgl. z. B. Yabia Omer 10, Orach Chayim 25; Tzitz Eliezer 9,51, 4; Shoel veNishal 1, Choshen Mishpat, 25; Iggrot Moshe Yoreh Deah, 1, 78.
- 20.
Vgl. z. B. Tzitz Eliezer, 8,12.
- 21.
Iggrot Moshe, Yoreh Deah, 2, 174.
- 22.
Vgl. z. B. Iggrot Moshe, Orach Chayim, 4,49; Tzitz Eliezer 14, 100.
- 23.
Vgl. z. B. Iggrot Moshe, Choshen Mishpat, 2, 69; Tzitz Eliezer 13,35.
- 24.
Vgl. z. B. Iggrot Moshe, Orach Chayim, 4,49; Tzitz Eliezer 1,3.
- 25.
Vgl. hierzu Grundmann, 2021, 437 f.
- 26.
Vgl. Kaplan, 1992. Die Richtung der Modern Orthodoxy oder Centrist Orthodoxy lässt sich in dieses Schema nicht ohne Weiteres einordnen, da sie sich, von einem grundsätzlich orthodoxen Selbstverständnis ausgehend, nicht gegen jegliche Innovationen verschließt und z. B. gegenüber den Wissenschaften eine differenzierte Position einnimmt.
- 27.
Mishneh Halachot 10, 200.
- 28.
Iggrot Moshe, Orach Chayim, 4,49.
- 29.
Mishneh Halachot 5, 123; Iggrot Moshe, Yoreh Deah, 1, 139.
- 30.
- 31.
Iggrot Moshe, Even haEzer, 1, 76.
- 32.
Iggrot Moshe, Yoreh Deah, 1, 160.
- 33.
Iggrot Moshe Orach Chayim, 4, 49.
- 34.
Vgl. z. B. Iggrot Moshe, Yoreh Deah, 3, 43; Mishneh Halachot 10, 200.
- 35.
Gordis, 1988, 20.
- 36.
Nach der aktuellsten Umfrage des Pew Research Center von 2020 rechnen sich 17 % der amerikanischen Jüdinnen und Juden der Denomination des Conservative Judaism zu. Vgl. Pew Research Center, 2021. Die Wurzeln des Konservativen Judentums liegen im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in Zacharias Frankels Konzept eines „positiv-historischen“ Judentums und in der Ausrichtung des Jüdisch-Theologischen Seminars in Breslau. Als eigene Denomination formierte sich die Richtung des Conservative Judaism Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. In Israel entwickelte sich in den 1970ern als Ableger des Conservative Judaism die Masorti (‚traditionell‘)-Bewegung, die nur eine sehr kleine Denomination darstellt. Nach den letzten Umfragen rechnen sich gegenwärtig zwei bzw. vier bis fünf Prozent der jüdischen Israel/innen der Denomination des Konservativen Judentum/Masorti zu. Vgl. hierzu The Jewish People Policy Institute, 2018. Diese numerischen Unterschiede spiegeln sich auch in der im Vergleich zu den Responsa des amerikanischen Konservativen Judentums geringeren Zahl der in Israel verfassten Masorti-Responsa wider. Zudem wurde vereinbart, dass sich der Va’ad Halakhah, das Halacha-Komitee der Rabbinical Assembly of Israel ausschließlich mit auf das Leben in Israel bezogenen Themen befasst und bei allgemeinen Themen die Entscheidungen des CJLS anerkennt. Vgl. Gilman, 1993, 187 f. Das Verfahren des Va’ad Halakhah orientiert sich an dem des CJLS; Aufbau und Struktur der in den USA und in Israel verfassten Responsa des Konservativen Judentums sind vergleichbar. Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt daher auf den Responsa des US-amerikanischen Konservativen Judentums.
- 37.
1985 wurde am Jewish Theological Seminary die erste Frau zur Rabbinerin ordiniert. Inwieweit das Verfassen von Responsa durch Respondentinnen auf die rhetorische Konstruktion von Männlich- und Weiblichkeit in den Responsa Einfluss genommen hat, soll im Rahmen einer anderen Arbeit erörtert werden.
- 38.
- 39.
Mit dem konsequenten Verfassen von Responsa in der Landessprache findet eine Entwicklung ihren Abschluss, die als Folge des Emanzipations- und Akkulturationsprozesses der jüdischen Gemeinschaft in Europa im 19. Jahrhundert einsetzte. Responsa wurden von diesem Zeitpunkt an zunehmend in der Landessprache verfasst.
- 40.
Der Rekurs auf die Tradition manifestiert sich auch in der Anordnung der Responsa des CJLS auf der Homepage der Rabbinical Assembly. Die Responsa werden nach der traditionellen, auf dem Ordnungsprinzip des Kodifikationswerks Schulchan Arukh basierenden Systematik von Responsa-Sammlungen angeordnet.
- 41.
Gossmann, 1990, 292.
- 42.
Vgl. Klein, 1983, 4 f.
- 43.
Vgl. z. B. Geller u. a., 2006, 24.
- 44.
Gordis, 1988, 46.
- 45.
Z. B. Dorff, 1990, 7, 15.
- 46.
Z. B. Popovsky, 2008, 1.
- 47.
Z. B. Berkowitz und Popovsky, 2010, 6.
- 48.
Als persuasive Stilmittel werden, wenn auch im wesentlich geringeren Umfang, die erste Person Plural, rhetorische Fragen und Appelle auch in orthodoxen Responsa verwendet.
- 49.
Geller, 2001, 24.
- 50.
Sharzer, 2017, 2.
- 51.
Sharzer, 2017, 4.
- 52.
- 53.
Barmash, 2014, 3.
- 54.
- 55.
Vgl. Tucker, 2006.
- 56.
Artson, 2005, 8 f.
- 57.
Gordis, 1988, 33.
- 58.
Lubliner, 2012, 1.
- 59.
Vgl. Gordis, 1988, 22.
- 60.
- 61.
- 62.
Roth, 1984b, 1.
- 63.
Vgl. Gordis, 1988, 33 f.
- 64.
Vgl. z. B. Lincoln, 1986, 14 f.
- 65.
Vgl. z. B. Jacobs, 2008, 37.
- 66.
Vgl. insbes. Dorff, 1988.
- 67.
Das Reformjudentum ist vor dem Hintergrund der Emanzipations- und Akkulturationsbestrebungen im 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden. Die USA, wo sich die Strömung im 19. Jahrhundert entfaltete, wurden zum „Gelobten Land der Reformbewegung“ (Meyer, 2000, 324). Neben der Bezeichnung ‚Reformjudentum‘ existieren auch die Selbstbezeichnungen ‚Liberales Judentum‘ und ‚Progressives Judentum‘.
- 68.
Von dem ideologischen Wandel des amerikanischen Reformjudentums seit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert zeugen insbesondere die insgesamt vier offiziellen Programme des Reformjudentums von 1885, 1937, 1976 und 1999. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Responsa, die seit den 1990er Jahren von amerikanischen Reformrabbiner/innen verfasst wurden und damit die größere Traditionsgebundenheit des gegenwärtigen amerikanischen Reformjudentums widerspiegeln.
- 69.
Washofsky, 2010c, XXVII.
- 70.
Nach der aktuellsten Umfrage des Pew Research Center von 2020 rechnen sich 37 % der US-amerikanischen Jüdinnen und Juden der Denomination des Reform Judaism zu. Vgl. Pew Research Center, 2021. In Israel wurde 1971 das Israel Movement for Progressive Judaism gegründet. Nach den letzten Umfragen rechnen sich gegenwärtig drei bzw. vier bis Prozent der jüdischen Israel/innen dem Reformjudentum zu. Vgl. hierzu The Jewish People Policy Institute, 2018.
- 71.
Vgl. Washofsky, 1997, XV.
- 72.
Vgl. Washofsky, 1997, XVf.
- 73.
Washofsky, 1997, XVI.
- 74.
Vgl. Washofsky, 1997, XVIIf.
- 75.
Vgl. Washofsky, 1997, XXVIII.
- 76.
- 77.
Vgl. Washofsky, 2010b, XXIIf.
- 78.
Washofsky, 2010b, XXIII.
- 79.
1972 wurde die erste Frau am Hebrew Union College, der Ausbildungsstätte für Reformrabbiner, ordiniert.
- 80.
Die Anordnung der Responsa der beiden diesen Ausführungen zu Grunde liegenden Responsa-Sammlungen erfolgt ebenfalls nach der traditionellen Systematik von Responsa-Sammlungen.
- 81.
Ein Teil der Responsa beginnt direkt mit der Erörterung der halachischen Quellen, während in anderen Responsa zunächst die Fragestellung als Einleitung zusammengefasst wird.
- 82.
Washofsky, 1997, XXI.
- 83.
Washofsky, 1997, XXI.
- 84.
- 85.
Plaut und Washofsky, 1997, 181.
- 86.
Vgl. z. B. Plaut und Washofsky, 1997, 4.
- 87.
Plaut und Washofsky, 1997, 340.
- 88.
Plaut und Washofsky, 1997, 351.
- 89.
Washofsky, 2010a, I, 171.
- 90.
Vgl. Plaut und Washofsky, 1997, 40.
- 91.
Washofsky, 2010a, I, 9.
- 92.
Literatur
Abelson, Kassel. 1983. Prenatal Testing and Abortion. HM 425:2.1983d. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20012004/03.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Adler, Rachel. 2001. Innovation and Authority: A feminist Reading of the „Women’s Minyan“ Responsum. In Gender Issues in Jewish Law, Hrsg. Walter Jacob und Moshe Zemer, 3–32. New York und Oxford: Berghahn Books.
Artson, Bradley Shavit. 2005. The Woman took the Child and Nursed It: A Teshuvah on Breast Feeding in Public. OH 75:1.2005a. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20052010/artson_breastfeeding.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Bar-Ilan University. 2015. The Responsa-Project.
Barmash, Pamela. 2014. Women and Mitzvot. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/2011-2020/womenandhiyyuvfinal.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Berkowitz, Miriam und Mark Popovsky. 2010. Contraception. EH 5:12.2010. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20052010/Contraception%20Berkowitz%20and%20Popovsky.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Bokser, Ben und Kassel Abelson. 1983. Statement on the Permissibility of Abortion. HM 425:2.1983c. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20012004/07.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Brody, Robert. 1998. The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture. New Haven und London: Yale Univ. Press.
Crane, Nate. 2018. Adoption. HM 290:1.2018. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/adoption_-_rabbi_nate_crane_-_final.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Dorff, Ellliot N. 1990. A Jewish Approach to End-Stay Medical Care. YD 339:1.1990b. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/dorff_care.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Dorff, Eliott N. 1988. Joint Conservative-Reform Religious Schools. YD 245:15.1988. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/dorff_jointschools.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Elon, Menachem. 1994. Jewish Law. History, Sources, Principles III. Jerusalem: Jewish Publication Society.
Feldman, David M. 1983. Abortion. The Jewish View. HM 425:2.1983a. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/feldman_abortion.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Fine, David J. 2002. Women and the Minyan, OH 55:1.2002 https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19912000/oh_55_1_2002.pdf. Zugegriffen: 24. August 2022.
Geller, Myron S., Robert E. Fine und David. J. Fine. 2006. The Halakhah of Same-Sex Relations in a New Context. EH 24.2006f. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20052010/geller_fine_fine_dissent.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Geller, Myron S. 2001. Woman Is Eligible to Testify. HM 35:14.2001a. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19912000/geller_womenedut.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Gilman, Neil. 1993. Conservative Judaism. The New Century. West Orange NJ: Behrman House.
Gordis, R. (1983). Abortion: Major wrong or basic right? HM 425:2.1983b. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20012004/05.pdf. Zugegriffen: 19. Aug. 2022.
Gordis, Robert. 1988. Emet VeEmunah: Statement of Principles of Conservative Judaism. New York: United Synagogue Book Service.
Gossman, Lionel. 1990. Between History and Literature. Cambridge: Harvard University Press.
Grundmann, Regina. 2018. Responsa als Praxis des religiösen Entscheidens im Judentum. In Religion und Entscheiden. Historische und kulturwissenschaftliche Perspektiven, Hrsg. Wolfram Drews, Ulrich Pfister und Martina Wagner-Egelhaaf, 163–178. Baden-Baden: Ergon Verlag.
Grundmann, Regina. 2021. „Und der Wähler wähle!“ Semantiken und Narrative des Entscheidens in Responsa des orthodoxen Judentums im 20. Jahrhundert. In Semantik und Narrative des Entscheidens, Hrsg. Philip R. Hoffmann-Rehnitz, Matthias Pohlig, Tim Rojek und Susanne Spreckelmeier, 433–447. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht.
Jacobs, Jill. 2008. Work, Workers and the Jewish Owner. HM 331:1.2008a. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20052010/jacobs-living-wage.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
The Jewish People Policy Institute. 2018. Rising Streams. Reform and Conservative Judaism in Israel. https://jppi.org.il/en/article/risingstreams/toc/numbers/#.Yvh-W_ixU2w. Zugegriffen: 19. August 2022.
Joseph, Norma Baumel. 2011. „Those Self-assured Women”. A Close Reading of Moshe Feinstein’s Responsum. A Journal of Jewish Women’s Studies 14(21): 67–87.
Kaplan, Lawrence. 1992. Daas Torah: A Modern Concept of Rabbinic Authority. In Rabbinic Authority and Personal Autonomy, Hrsg. Moshe Sokol, 160. Northvale NJ: Aronson.
Klein, Isaac. 1983. A Teshuvah on Abortion. HM 425:2.1983e. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20012004/06.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Lincoln, David H. 1986. Co-OPs for Kosher Meat. HM 376:1.1986. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/lincoln_coops.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Lubliner, Jonathan. 2012. Concurring Opinion with Rabbi Joseph Prouser’s Responsum On „Ana Ger Ana: May a Convert to Judaism Serve on a Bet Din?“. HM 7:1.2012c. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/2011-2020/lubliner-concurring-prouser.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Meyer, Michael A. 2000. Geschichte der Reformbewegung im Judentum. Wien: Böhlau.
Perelman, Chaïm., und Lucie Olbrechts-Tyteca. 1958. Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique. Paris: Presses Universitaires de France.
Pew Research Center. 2021. Jewish Americans in 2020. https://www.pewresearch.org/religion/2021/05/11/jewish-americans-in-2020/. Zugegriffen: 19. August 2022.
Plaut, W. Gunther und Mark Washofsky, Hrsg. 1997. Teshuvot for the Nineties. Reform Judaism’s Answers to Today’s Dilemmas. New York: CCAR Press.
Popovsky, Marc. 2008. Choosing Our Childrenʾs Genes: The Use of Preimplantation Genetic Diagnosis. EH 1:5.2008a. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/public/halakhah/teshuvot/20052010/Popovsky_FINAL_preimplantation.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Rabinowitz, Mayer E. 1984a. An Advocate’s Halakhic Responses on the Ordination of Women. HM 7:4.1984a. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/ordinationofwomen1.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Rabinowitz, Mayer E. 1984b. A Response to Rabbi Joel Roth. HM 7.4.1984c. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/ordinationofwomen3.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Roth, Joel. 1984a. On the Ordination of Women as Rabbis. HM 7:4.1984b. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/ordinationofwomen2.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022, 2234.
Roth, Joel. 1984b. A Response to Rabbi Mayer Rabinowitz. HM 7.4.1984d. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/19861990/ordinationofwomen4.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Roth, Joel und Daniel Gordis. 1983. Sociological Reality and Textual Traditions: Their Tension in the Kettubah. EH 66:6.1983b. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20012004/36.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Sharzer, Leonard A. 2017. Transgender Jews and Halakhah. EH 5:11.2017b. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/public/halakhah/teshuvot/2011-2020/transgender-halakhah.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022.
Tucker, Gordon. 2006. Derosh vekabel sakhar: Halakhic and Meta-Halakhic Arguments Concerning Judaism and Homosexuality. EH 24.2006g. https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/20052010/tucker_homosexuality.pdf. Zugegriffen: 19. August 2022
Washofsky, Mark. 1997. Introduction. Responsa and the Reform Rabbinate. In Teshuvot for the Nineties. Reform Judaism’s Answers to Today’s Dilemmas, Hrsg. Plaut, W. Gunther und Mark Washofsky, XIII–XXIX. New York: CCAR Press.
Washofsky, Mark, Hrsg. 2010a. Reform Responsa for the Twenty-First Cetury. Sh’eilot ut’shuvot. New York: CCAR Press. 2 Bde.
Washofsky, Mark. 2010b. Introduction: On Halachah and Reform Judaism. In Reform Responsa for the Twenty-First Cetury: Sh’eilot ut’shuvot I, Hrsg. Mark Washofsky, XV–XXIV. New York: CCAR Press.
Washofsky, Mark. 2010c. Jewish Living. A Guide to Contemporary Reform Practice. 2. Aufl. New York: URJ Press.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Grundmann, R. (2023). Rhetorische Profile jüdischer Response der Gegenwart. In: Wagner-Egelhaaf, M., Arnold, S., Schnetter, M., Heger, G. (eds) Rhetoriken zwischen Recht und Literatur. Literatur und Recht, vol 9. J.B. Metzler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66928-0_11
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-66928-0_11
Published:
Publisher Name: J.B. Metzler, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-66927-3
Online ISBN: 978-3-662-66928-0
eBook Packages: J.B. Metzler Humanities (German Language)