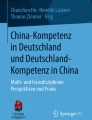Zusammenfassung
Aus der Perspektive der Struktur der internationalen Beziehungen lässt sich das Verhältnis zwischen China und Deutschland seit 1949 als eine „natürliche Partnerschaftsbeziehung“ charakterisieren, die sich auf die jeweils eigene Entwicklung der zwei Beziehungsakteure, ihre Stellung und Rolle in den internationalen Beziehungen und die Relation ihrer Werte und Interessenlage bezieht. Ihre Entwicklung hängt von drei intervenierenden Variablen ab: 1) dem chinesischen Primat der Innenpolitik und deren Perzeption durch Deutschland; 2) der deutschen Europapolitik und deren Akzeptanz durch die EU-Mitgliedstaaten und schließlich 3) der US-amerikanische Chinapolitik.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
1 Einführung
China und Deutschland sind in den internationalen Beziehungen zwei ungleiche Akteure. Das ergibt sich aus ihrer Bevölkerungsanzahl, der geografischen Lage und Ausdehnung, aus der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Struktur sowie aus der Ideologie, Philosophie und Kultur – auf der einen Seite die konfuzianisch-traditionelle chinesische und auf der anderen die christlich-abendländische. Auf der tagespolitischen Ebene zeigen sich Missverständnisse, Konflikte und sogar Krisen. Trotz dieser Unterschiede lassen sich aus dem Blickwinkel der Struktur der internationalen Beziehungen beträchtliche Parallelitäten und Gemeinsamkeiten zwischen China und Deutschland feststellen. Schon im Jahre 1919 zeigten China und Deutschland, zwei von großen Unterschieden gekennzeichnete Staaten – das besiegte Deutschland und der Siegerstaat China im Ersten Weltkrieg – eine Gemeinsamkeit: beide Staaten waren mit dem Versailler Vertrag unzufrieden, was zu einem „gemeinsamen Nenner“ wurde. China unterschrieb den Versailler Vertrag nicht.
Dieser Umstand führte dazu, dass beide am 20. Mai 1924 einen separaten Friedensvertrag unterzeichneten – nach acht Monaten und über vierzig Verhandlungsrunden. In dem Vertrag wurde festgehalten, dass die Achtung der territorialen Souveränität und die gegenseitige Gleichberechtigung die Leitprinzipien bilden. Dieser Vertrag wurde in China, im Gegensatz zum Versailler Vertrag, als das erste Abkommen seit dem Ersten Opiumkrieg 1840 wahrgenommen, das den Charakter der zwischenstaatlichen Gleichberechtigung innehatte.
Die Ähnlichkeit der Stellung und Rolle Chinas und Deutschlands in der Struktur der internationalen Beziehungen war nach der Staatsgründung der Volksrepublik China (VR China) und der Bundesrepublik Deutschland 1949 abermals festzustellen, sodass ihr Verhältnis als eine „natürliche Partnerschaftsbeziehung“ (Zhongde tianran mengyou guanxi) herausgestellt wurde.Footnote 1 Diese These wurde von nicht wenigen infrage gestellt, mitunter direkt abgelehnt und verworfen; vor allem Diplomaten hier und da sehen sich oft mit Problemen und Widersprüchen konfrontiert. Dennoch hat sie nicht an Vitalität verloren. Sie ging weder von der allgegenwärtigen Ideologisierung wie Menschenrechtsvorwurf aus, noch leitete sie sich von der realen Tagespolitik ab. Sie unterschied sich auch von den offiziellen Formulierungen des chinesisch-deutschen Verhältnisses.Footnote 2 Gegründet auf der Struktur der internationalen BeziehungenFootnote 3 trägt die These weniger einen temporären und operativ-funktionalen als vielmehr einen langfristigen und prinzipiell-substanziellen Charakter. Das Adjektiv „natürlich“ ist nicht naiv verwendet, sondern lehnt sich an das antike Verständnis von Natur im Sinne einer wohlgeordneten Gleichförmigkeit an.
2 Strukturelle Elemente der chinesisch-deutschen Beziehungen
Politologisch gesehen sind bei der „natürlichen Partnerschaftsbeziehung zwischen China und Deutschland“ drei strukturelle Elemente von Bedeutung.
2.1 Die jeweilige Entwicklung beider Beziehungsakteure
Die VR China und die Bundesrepublik Deutschland wurden beide 1949 gegründet. Ihre Entwicklungswege zeigen eine erhebliche Parallelität auf. Dies ist eine ungewöhnliche Einmaligkeit bei vergleichenden Akteursstudien.
Beide Staaten plädierten wegen der politischen Zweiteilung des jeweiligen Staates für ein Alleinvertretungsrecht und hielten an der nationalen Einheit fest; nach 1949 betrieben sie eine außenpolitische Strategie, die sich als „sich zu einer Seite neigen“ beschreiben lässt (China zur Sowjetunion und Deutschland zu den USA). Beide leiteten seit Anfang der 1970er Jahre eine neue Orientierung der Außenpolitik ein (die chinesische neue West- und die deutsche neue Ostpolitik).
Hervorzuheben ist, dass sowohl China als auch Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges zu den wiederaufsteigenden Mächten zählten. Man spricht vom chinesischen Aufstieg, während der des wiedervereinigten Deutschlands wenig Aufmerksamkeit findet. Der Unterschied liegt im Inhalt des Aufstiegs. Während der Aufstieg Chinas primär ökonomischer Natur ist, ist er im Fall Deutschlands aufgrund der zunehmenden Bedeutung in der Europäischen Union (EU) und Weltpolitik vor allem politisch gefasst. Für zwei Akteure mit ähnlicher Stellung und Rolle in den internationalen Beziehungen ist es relativ einfach, ihr Verhältnis auf einer gleichrangigen und ausbalancierten Grundlage zu gestalten und beizubehalten.
2.2 Stellung und Rolle Chinas und Deutschlands in den internationalen Beziehungen
In Stellung und Rolle beider Staaten in den regionalen und globalen Angelegenheiten zeigt sich ebenso eine Gemeinsamkeit. China und Deutschland sind zwei Staaten, die jeweils in Asien und Europa an die meisten direkten Nachbarländer grenzen und eine führende Position im laufenden regionalen Integrationsprozess aufgrund ihrer jeweiligen Gestaltungsfähigkeit einnehmen. Sie können und sollten beide daran Interesse haben und sich darum bemühen, dass Asien und Europa zur Bewältigung der globalen Herausforderungen und für das Wohlergehen der Völker der Welt noch mehr und intensiver als früher zusammenarbeiten.
Wichtig ist es auch darauf hinzuweisen, dass China und Deutschland, außenpolitisch jahrzehntelang eine Kultur der Zurückhaltung als Staatsräson innehatten. Als der Regierungswechsel 2013/2014 jeweils in Peking (Ablösung des Führungsduos Hu und Wen durch Xi und Li) und Berlin (Amtsantritt der schwarz-roten Großen Koalition) zustande kam, verkündeten beide Staaten der internationalen Öffentlichkeit ihren Gestaltungswillen zur Bewältigung der globalen Herausforderungen. Die deutsche Außen- und Europapolitik wird seitdem immer aktiver, und China zeigt sich mehr als früher bereit, der internationalen Gesellschaft, insbesondere im Rahmen der Aktivitäten der Vereinten Nationen (UN), öffentliche Güter zur Verfügung zu stellen. Statistisch gesehen sind es z. B. schon über 2,1 Mrd. Dosen Impfstoffe, die China an mehr als 120 Staaten und internationale Organisationen zur Bekämpfung der COVID-Pandemie geliefert hat.Footnote 4 Die im Oktober 2021 in Kunming tagende Weltkonferenz zur Förderung der Biodiversität hat auch die aktive Rolle Chinas zur Bewältigung der weltweiten Herausforderung authentisch bewiesen.
2.3 Die Relation ihrer Werte und Interessen
Die chinesischen und deutschen Interessen und damit verbundene Wertevorstellungen haben abermals eine erhebliche Parallelität aufgezeigt. Beide Staaten sind unter den größten Volkswirtschaften der Welt Handelsstaaten und am stärksten vom Außenhandel abhängig. Beide Staaten sind Profiteure des globalisierten Prozesses und treten für den freien Handel, eine regelbasierte internationale Wirtschaftsordnung, die Fortentwicklung der Global Governance und eine Stärkung des UN-Systems ein, zum Beispiel durch die Kooperation im G20-Format.
Es zeichnen sich vier neue globale Funktionen Chinas ab, die im Wesentlichen auch den deutschen Interessenlagen entsprechen. Deutschland tritt ebenso wie China für ein nachhaltiges Entwicklungsmodell ein, für den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen, für eine global stabilere Konstellation in der Zeit des Umbruchs der Weltpolitik und die Verbesserung der noch mangelhaften internationalen Mechanismen, die entweder reformbedürftig wie die Welthandelsorganisation sind oder einfach noch fehlen, um neu aufgetretene weltweite Herausforderungen zu bewältigen. Am 28. Juni 2019 fand die G20-Gipfeltagung in Japan statt. In diesem Rahmen trafen sich Angela Merkel und Xi Jinping mit folgendem Ergebnis: Beide Staaten wollten gerade vor dem Hintergrund des strukturellen Umbruchs der internationalen Lage ihre Verständigung, Abstimmung und Kooperation stärken; sich bemühen, auch im Rahmen der Seidenstraßeninitiative (Belt and Road Initiative) zusammenzuarbeiten. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland gilt insbesondere der Erhaltung des Multilateralismus, des Klimaschutzes, der Reform der Welthandelsorganisation und der friedlichen Lösung von Konflikten.
Aufgrund von Werten wie Frieden und Sicherheit, Wohlstand für alle und nachhaltige und inklusive Entwicklung zeigen sich wichtige Gemeinsamkeiten auch in der Währungspolitik und in der engeren Zusammenarbeit in Afrika. Seit der Etablierung des chinesisch-deutschen strategischen außen- und sicherheitspolitischen Dialogs 2014 gehört die Sicherheitspolitik zum festen Bestandteil der Regierungszusammenarbeit. Beide Seiten plädieren je aus ihrer eigenen Interessenlage heraus für kooperative sicherheitspolitische Lösungsansätze (z. B. zu Libyen, der Ukraine, dem Iran und Nordkorea).
3 Entwicklungsperspektive der chinesisch-deutschen Beziehungen
Die These von der chinesisch-deutschen natürlichen Partnerschaftsbeziehung schließt Probleme, Konkurrenz und Gegensätze selbstverständlich nicht aus. Wo überhaupt könnte es in den internationalen Beziehungen ein tadelloses Beziehungsmuster geben? Drei intervenierende Variablen können in diesem Zusammenhang thematisiert werden, die für die Entwicklungsperspektive der Beziehungen zwischen China und Deutschland von Bedeutung sind: 1) das chinesische Primat der Innenpolitik und deren Perzeption durch Deutschland; 2) die deutsche Europapolitik und deren Akzeptanz durch die EU-Mitgliedstaaten und schließlich 3) die US-amerikanische Chinapolitik.
3.1 Das chinesische Primat der Innenpolitik und deren Perzeption durch Deutschland
Das Primat der Innenpolitik ist im Fall Chinas vonnöten. Die chinesische Innenpolitik lässt sich mit der eines europäischen Staates von 4 bis 80 Mio. Menschen nicht vergleichen. Sie umfasst ein Fünftel bis ein Viertel der Weltbevölkerung und stellt damit aber nicht nur eine quantitative, sondern vielmehr auch eine qualitative Größe dar: Wenn das chinesische Projekt zum „Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand“ erfolgreich sein würde, wäre dies per se schon ein großer Beitrag für die Weltgesellschaft.
Die Perzeption der chinesischen Entwicklung durch Deutschland bleibt ein ernstes Problem. Bemerkenswerter ist die negative Darstellung Chinas durch die politische Elite Deutschlands. Der ehemalige Außenminister der rot-grünen Bundesregierung Joschka Fischer und Wolfgang Ischinger mit über 40 Jahren diplomatischer Erfahrung sind nur zwei Beispiele dafür. Ihnen zufolge bildet China die größte geopolitische Gefahr der zukünftigen weltpolitischen Entwicklung.Footnote 5 Der Politikwissenschaftler Ulrich Menzel teilt diese Meinung, indem er das beste Szenarium für Europa herausstellt, zusammen mit den USA nach Trump gegen China zu arbeiten (Menzel 2019).
Konkret vertrat Menzel in seinem 2019 veröffentlichten Artikel, betitelt „Welt im Übergang, Europa in der Krise – Vom amerikanischen zum chinesischen Jahrhundert“, folgende Argumente: Der Aufstiegsprozess Chinas ist vollzogen, China wird die globale Führungsrolle der USA ablösen; während der hegemoniale Übergang von Großbritannien auf die USA historisch gesehen schrittweise und kooperativ vonstattenging und normative Kontinuität versprach, wird die Ablösung des amerikanischen durch das chinesische Jahrhundert, also die Weltdominanz Chinas, konfliktreich und von einem normativen Paradigmenwechsel begleitet sein; der friedliche Aufstieg (peacefull rise) Chinas ist nur eine Schimäre, China betreibt eine neoimperiale Nachrüstung (Menzel 2019).
Auch die Seidenstraßeninitiative Chinas wurde in Deutschland häufig mit Expansion, Egoismus und Aufzwingen in Verbindung gebracht. Sind diese Wahrnehmungen über China in der Welt berechtigt? Menzels komparative Forschung über China und die USA ist interessant, aber es mangelt ihm dabei an tiefgehender kulturell-historischer Substanz. Es sollte zuerst nach dem Kern der gegenwärtigen Außenpolitik Chinas gefragt werden, die in der angestrebten „Zukunftsgemeinschaft der Menschheit“ ihren Ausdruck findet.Footnote 6
Diese spiegelt die traditionelle politische Kultur Chinas wider, die auf eine über 5000 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann. Inhaltlich verkörpert sie zwei konfuzianische Grundwerte: den menschenorientierten Wert und die Wertschätzung des Friedens. Der Kern des Konfuzianismus besteht in der die Menschen liebenden Tugend ren. Diese kann in doppelter Hinsicht verstanden werden, nämlich als zhong (Treue) und shu (Toleranz). Während bei zhong im positiven Sinne „das eigene gute Beispiel“ betont wird, ist bei shu aus negativer Perspektive die Tugend des „Nicht-Aufzwingens“ von großer Bedeutung.
Auf prinzipieller Ebene der chinesischen Außenpolitik ist auch he er bu tong (Harmonie ohne Gleichheit) erwähnenswert. Das Schriftzeichen he (Harmonie) erschien zuallererst in den Orakelknochen-Inschriften. In der Zeit von etwa 300 Jahren v. u. Z. war die Harmonie das Thema damaliger chinesischer Philosophien. Es wurde von Konfuzius aufgegriffen und auf den Umgang mit zwischenmenschlichen Beziehungen bezogen. Konfuzius stellte die These auf: „Junzi he er bu tong, xiaoren tong er bu he (Der Edle sinnt auf das harmonische Zusammenspiel, ohne alles einerlei werden zu lassen, der gemeine Mann macht alle Dinge gleich, ohne dass sie sich harmonisch ergänzen können)“. (Konfuzius 2015, S. 196) Das Verhältnis von Harmonie und Unterschied wurde wie folgt dargestellt: Die Harmonie ist das Ziel, sie basiert als Zielsetzung auf Unterschieden; Unterschiede sind wichtig, ohne Unterschiede kann von Einheit und Harmonie nicht die Rede sein. Dies ist universal und kann auch von anderen Staaten und Völkern akzeptiert werden. Die Entwicklung der europäischen Integration entspricht der Idee von he er bu tong (Harmonie ohne Gleichheit) voll und ganz.
Aufgrund der alten politischen Kultur Chinas sind zwei Punkte hinzufügen. Sie beziehen sich auf die nun weltweit bekannte Seidenstraßeninitiative und die traditionelle Philosophie im außenpolitischen Entscheidungsprozess Chinas.
Erstens: Was sind Ziel und Vorgehen bei der Seidenstraßeninitiative? Sie sind in dreierlei Hinsicht zu verstehen: gong shang (miteinander verhandeln), gong jian (gemeinsam aufbauen) und gong xiang (die Erfolge teilen). Das heißt, anderen den eigenen Willen nicht aufzuzwingen und sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen, sondern die jeweilige Politik aufgrund der beiderseitigen Interessen miteinander abzustimmen, gemeinsam zu handeln und schließlich positive Erfolge zu teilen.
Zweitens: Was charakterisiert die traditionelle Philosophie im außenpolitischen Entscheidungsprozess Chinas? Sie liegt prinzipiell in einer Reaktivität beziehungsweise Defensive. Dazu gehört zum Beispiel, anderen die eigene Meinung nicht aufzwingen; auf keinen Fall den ersten Schuss abgeben; Anstand beruht auf Gegenseitigkeit; den Anderen dreimal aus dem Weg gehen, der vierte Angriff muss mit einem Rückschlag erwidert werden.Footnote 7
Diese Positionen sowie dieses außenpolitische Verhalten der VR China lassen sich in dem von der US-Regierung unter Donald Trump entfachten Handelskonflikt deutlich beobachten. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, auf eine Rede hinzuweisen, die Frank-Walter Steinmeier am 27. Juni 2016 in seiner Zeit als Außenminister hielt. Dabei plädierte er für den Verzicht auf eine westzentristische Weltsicht und sagte: „Wir müssen uns in der Außenpolitik bewusst darüber sein, wonach andere Akteure auf der Weltbühne in ihren Ordnungsvorstellungen suchen. Wo liegen regionale, kulturelle, gesellschaftliche Unterschiede? Was sind die Geschichten und Erzählmuster, die Träume und Traumata von Gesellschaften, die die politischen und sozialen Verhältnisse über die faktische Ordnung hinaus begründen?“ (Steinmeier 2016).
China als einer der wichtigen Akteure der Weltpolitik verdient durchaus eine solche Betrachtung. Es verfügt im Vergleich zum Westen über völlig andere kulturelle Traditionen, politische Ideen und Weltanschauungen. Seine Entwicklung hat nur einen Ehrgeiz zum Ziel, um den chinesischen Diplomaten Dai Bingguo zu zitieren: die eigenen Angelegenheiten gut regeln, um der 1,4 Mrd. zählenden Bevölkerung Chinas ein Leben mit Wohlstand und Würde zu ermöglichen. (Dai 2016).
3.2 Die deutsche Europapolitik und deren Akzeptanz durch die EU-Mitgliedstaaten
Während in China die innere Akzeptanz für die Außenpolitik entscheidend ist, gilt im Fall Deutschland seine europäische Verträglichkeit als dominante Variable. Es lässt sich das „Primat der Außenpolitik“ in der deutschen Außenpolitik beobachten, wenn die Europapolitik noch zur konventionellen Außenpolitik Deutschlands zählen darf. Deutschland kann deshalb auch als aufsteigender Staat wahrgenommen werden, weil es sich in den EU-Rahmen eingefügt hat.Footnote 8
Das Nationalinteresse des wiedervereinigten Deutschlands kann nicht automatisch als europäisches Interesse definiert werden; die deutsche Politik muss aber, wenn sie erfolgreich sein will, stets unter Berücksichtigung der multilateralen Einbindung in die EU konzipiert und formuliert werden. Dabei ist ein deutsch-französisches Tandem oder das Weimarer Dreieck wichtig. Ohne eine deutsch-französische Zusammenarbeit, welche zwar keine Garantie für die Lösung aller Probleme der EU sein müßte, könnte aber kein einziges Problem der EU gelöst werden.
Im Jahre 2020 hat die COVID-Pandemie die ganze Welt, auch die EU und Deutschland vor eine der größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg gestellt. Um diese außergewöhnliche Krise mit außergewöhnlichen neuen Methoden zu bewältigen, hat Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Macron am 18. Mai 2020 eine gemeinsame Initiative ergriffen.Footnote 9 Es dauerte zwei Monate, bis der deutsch-französische Vorschlag, unterstützt von EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, am 21. Juli 2020 auf dem lang dauernden Sondertreffen des Europäischen Rats verabschiedet wurde. Damit sind zum ersten Mal in der Geschichte der EU neue Möglichkeiten geschaffen worden: Die Europäische Kommission nimmt erstmals in ihrem Bestehen im großen Stil eigene Schulden für ihren 750 Mrd. € schweren Aufbaufonds auf; alle Mitgliedsländer haften anteilig für die Schulden, von denen ein Großteil, nämlich 390 Mrd. €, als nicht zurückzuzahlende Zuschüsse verteilt wird. Bei den übrigen 360 Mrd. € handelt es sich um befristete Wiederaufbau-Darlehen.
Der zurückgelegte Weg war mühsam, und der Sondergipfel von 27 Staats-und Regierungschefs wurde von scharfen Auseinandersetzungen begleitet. Aber die gemeinsame Anstrengung hat sich gelohnt, oder wie der Spiegel formuliert: „Qualität kommt von Qual.“ (Klusmann 2020, S. 8) Zwar gibt es noch weitere zu lösende Probleme wie die Ratifizierung und operative Durchsetzung, aber keiner hegt den Zweifel, dass das Ergebnis von der Tagung von historischer Bedeutung ist. Es wurde das Fundament für ein neues Europa gelegt, nicht nur sich erstmals von der größten Corona-Krise zu erholen, vielmehr formiert sich eine echte geopolitische Kraft Europas in der Weltpolitik.Footnote 10
In einem Beitrag in Süddeutsche Zeitung von 2018 nutzte Joschka Fischer neunmal den Begriff „Souveränität“ in dem Sinne, dass aus dem Handels- und Friedensprojekt der EU „ein Projekt der gemeinsamen Souveränität“ werden müsse. Durch den Zwang von Donald Trump müsse die EU ihre Souveränität wiedererlangen, um auf globaler Ebene ihre Interessen durchsetzen zu können. Gelinge dies, dann hätte sich Trump um die Einheit Europas verdient gemacht. (Fischer 2018) Ob das gelingt beziehungsweise noch gelingen wird, wird nicht zuletzt der deutschen Stellung und Rolle in der EU zu verdanken sein.
3.3 Faktor USA
Die USA stellen unverändert als einzige Supermacht der Welt für alle Staaten einen wichtigen Einflussfaktor dar. Das gilt in besonderem Maße für Deutschland als Bündnispartner der USA. In der deutschen Perzeption, besonders seit 2018, hätten der US-Präsident und seine Anhänger vor, die von den USA nach 1945 geschaffene und beschützte internationale Ordnung und den freien Welthandel zu zerstören. Von diesem Befund wird in Deutschland fest ausgegangen. Joschka Fischer sah im US-amerikanischen Wandel „eine Revolution der globalen Ordnung“ (Fischer 2018). Die Trump-Präsidentschaft hat eine historische Zäsur eingeleitet. Einer Studie zufolge fürchten zwei Drittel der Bundesbürger, dass Trumps Politik die Welt gefährlicher macht. Vor nichts fürchten sich die Deutschen also mehr als vor diesem US-Präsidenten.Footnote 11
In Anbetracht der globalen Herausforderungen zeigt sich ein Dreieckverhältnis zwischen China, Deutschland und der USA. Das hat sich zum Beispiel im Streitthema 5G-Netz anschaulich gezeigt. Die USA warnen Deutschland seit langem eindringlich vor einer Beteiligung von Huawei an dem Mobilfunknetz Deutschlands. Die CDU beschloss am 23. November 2019 auf dem Parteitag in Leipzig mit großer Mehrheit, Huawei nicht generell vom Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunks in Deutschland auszuschließen. Ähnlich äußerte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der ARD-Sendung „Anne Will“ am 24. November 2019. Einen Tag später attackierte der damalige US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, die Bundesregierung.
Die US-Regierung versucht aktuell – besonders während der Pandemie – die westlichen Staaten, darunter auch Deutschland und die EU, gemeinsam gegen China in aller Hinsicht zu positionieren. Wenig spricht dafür, dass sich der strategische Konflikt zwischen den USA und China abkühlen wird. Nachdem die USA ein chinesisches Konsulat schließen ließen, muss nun auch eine US-Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu den Betrieb einstellen. Auch im Südchinesischen Meer droht eine Zuspitzung der amerikanisch-chinesischen Konfrontation bis hin zu einer militärischen Eskalation. Wie sollen Deutschland und Europa auf diese Konstellation reagieren?
Generell lässt sich sagen, dass sich die Europäer in ihrer Chinapolitik nicht von den USA treiben lassen. „Ein Handelskrieg, wie ihn Trump vom Zaun gebrochen, ja eine ökonomische Entkopplung von China, wie sie sein Wirtschaftsberater Peter Navarro im Sinn hat, ist nicht in Europas Interesse, schon gar nicht im Interesse Deutschlands.“ (Zand 2020, S. 89) Um Europa vor den Verwüstungen durch die Corona-Krise zu bewahren, wurde eine Rettungsaktion mit vielfältigen, bahnbrechenden Maßnahmen gewagt. Auch wenn sie nicht perfektFootnote 12 und noch mit schwerwiegenden Nachverhandlungen verbunden ist, gilt das Leitprinzip für alle EU-Mitgliedsstaaten: Europa müsse an einem Strang ziehen, um nicht auf der Weltbühne von den zwei übergroßen Akteuren USA und China an der Spitze marginalisiert zu werden.Footnote 13
Die Verwüstungen der weltweiten sozioökonomischen Lage durch die sich immer noch ausbreitende COVID-Pandemie rufen alle Seiten zur gemeinsamen Anstrengung auf. China und das europäische Deutschland sind beide Akteure in den internationalen Beziehungen, die mit objektiver Gestaltungsfähigkeit und subjektivem Gestaltungswillen ausgestattet sind, und sollten mehr denn je zusammenarbeiten. Wichtig sollte dabei sein, dass der Inhalt (wie die konstruktive Bewältigung der globalen Herausforderungen) gegenüber der Form (wie das Bündnis-Lagerdenken) zur Eindämmung der Gefahr von Unilateralismus und Protektionismus zugunsten der Stabilisierung der Weltordnung unter Vernachlässigung systemischer Unterschiede dominieren sollte.
Notes
- 1.
Diese These habe ich in einem Aufsatz gewagt, den ich im August 2007 anlässlich des Staatsbesuchs der Bundeskanzlerin Merkel in China verfasst hatte. Dazu siehe Lian 2007.
- 2.
Unter der Regierung Gerhard Schröder wurden die chinesisch-deutschen Beziehungen als die „Partnerschaft in globaler Verantwortung im Rahmen der umfassenden strategischen Partnerschaftsbeziehungen zwischen China und Europa“ charakterisiert. Nach einem Besuch von Angela Merkel in China im Juli 2010 wurden sie auf eine neue Stufe aufgewertet. Der Begriff „Strategie“ wird in China und Deutschland unterschiedlich verstanden. Während in China die Strategie als eine prinzipielle, langfristige und allumfassende Planung interpretiert wird, wird sie in Deutschland hauptsächlich als eine operative Maßnahme oder konkrete Politik definiert.
- 3.
Näheres dazu siehe Lian 2008.
- 4.
Siehe die virtuelle Rede des chinesischen Außenministers Wang Yi bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz, 19. Februar 2022. https://securityconference.org/mediathek/album/muenchner-sicherheitskonferenz-2022/. Zugegriffen: 24. Juli 2022.
- 5.
Joschka Fischer sagt, die sino-amerikanische Rivalität um die globale Dominanz sei gefährlich und würde die Geopolitik des 21. Jahrhunderts prägen (Fischer 2018). Wolfgang Ischinger sagt, China sei die große zukünftige Herausforderung. Es sei eine weltpolitische Aufgabe, dass der Aufstieg Chinas nicht in die Thukydides-Falle gerate (Ischinger 2018, S. 84).
- 6.
Ausführlich dazu siehe Lian 2017.
- 7.
Näheres zu den Punkten siehe die Rede Zhou Enlais vom 24. April 1963 beim Treffen mit einer ägyptischen Delegation: Zhou Enlai (1990, S. 327 f.).
- 8.
Zum Verhältnis Deutschlands mit Europa siehe Lian (2014). Darin wird das deutsche bzw. europäische Dilemma mit diesem Begriffspaar, das auf Thomas Mann (1953) zurückgeht, ausführlich analysiert.
- 9.
Für Näheres siehe https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz/von/bundeskanzlerin-merkel-und-dem-franzoesischen-praesidenten-emmanuel-macron-1753844. Zugegriffen: 25. Juli 2022.
- 10.
Vgl. die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron am 21. Juli 2020 in Brüssel. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-praesident-macron-am-21-juli-2020-1770170. Zugegriffen: 25. Juli 2022.
- 11.
In der Ausgabe vom 7. September 2018 wurde in Der Tagesspiegel ein Artikel über die Studie „Die Ängste der Deutschen 2018“ veröffentlicht. Dazu siehe Lehming et al. 2018.
- 12.
Siehe dazu Europäisches Parlament (2020): „Ein positiver Schritt für die kurzfristige Erholung, aber Kürzungen des langfristigen Haushalts sind inakzeptabel, demokratische Kontrolle des Aufbauinstruments notwendig, verbindliches Engagement für neue EU-Einnahmequellen unentbehrlich, klarer Mechanismus zur Verknüpfung von EU-Ausgaben und Achtung der Rechtsstaatlichkeit erforderlich. Abgeordnete sind bereit, ihre Zustimmung zum langfristigen Haushalt zu verweigern, wenn Kompromiss des EU-Gipfels nicht verbessert wird.“
- 13.
Vgl. Klusmann (2020).
Literatur
Dai, Bingguo. 2016. Dai Bingguo tongzhi 2016 nian 7 yue 5 ri zai Huashengdun Zhong Mei zhiku Nanhai wenti duihuahui shang de jianghua (Die Rede Dai Bingguos auf der Think-Tank-Konferenz zwischen China und den USA über die Frage des Südchinesischen Meeres, 5. Juli 2016, Washington D.C.). World Affairs, Nr. 14: 7.
Europäisches Parlament. 2020. Langfristiger EU-Haushalt: Gipfel-Kompromiss muss verbessert werden. Pressemitteilung vom 23. Juli. https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200722IPR83804/langfristiger-eu-haushalt-gipfel-kompromiss-muss-verbessert-werden. Zugegriffen: 25. Juli 2022.
Fischer, Joschka. 2018. Trump macht bitteren Ernst mit der Zerstörung des Westens. Süddeutsche Zeitung, 31. Juli 2018.
Ischinger, Wolfgang. 2018. „Wir erleben einen Epochenbruch.“ Der Spiegel 36.
Klusmann, Steffen. 2020. Qualität kommt von Qual. Der Spiegel 31.
Konfuzius. 2015. Gespräche. Ausgewählt, übersetzt und kommentiert von Wolfgang Kubin. 2. Aufl. Freiburg: Herder.
Lehming, Malte, C. von Marschall, und P. Starzmann. 2018. Wer hat Angst vor Donald Trump? Der Tagesspiegel, 7. September 2018.
Lian, Yu-ru. 2007. A Strong Foundation for China-Germany Ties. China Daily, 29. August: 11.
Lian, Yu-ru. 2008. Über die „Natürliche Partnerschaftsbeziehung“ zwischen China und Deutschland. Guoji zhengzhi yanjiu (Studies of International Politics), Nr. 3: 15–26.
Lian, Yu-ru. 2012. Neue Gedanken über die Frage vom „Deutschen Europa“ und „Europäischen Deutschland“. In Retrospect and Prospect of 40 Years’ China-Germany Diplomatic Relations, Hrsg. J. Gu. Peking: Social Sciences Academic Press.
Lian, Yu-ru. 2014. Zai lun „Deguo de Ouzhou“ yu „Ouzhou de Deguo“ (Abermalige Reflexionen über die Frage vom „Deutschen Europa“ und „Europäischen Deutschland“). Guoji zhengzhi yanjiu (Studies of International Politics), Nr. 6: 9–24.
Lian, Yu-ru. 2017. Reflexionen über den Kern der Außenpolitik der Volksrepublik China im 21. Jahrhundert. Berliner China-Hefte/Chinese History and Society 49: 101–112.
Menzel, Ulrich. 2019. Welt im Übergang, Europa in der Krise – Vom amerikanischen zum chinesischen Jahrhundert. Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 9: 65–74.
Steinmeier, Frank-Walter. 2016. Brüche und Brücken: Deutsche Außenpolitik in bewegten Zeiten. 27. Juni 2016. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160627-BM-GIGA.html. Zugegriffen: 25. Juli 2022.
Zand, Bernhard. 2020. Grenzen der Koexistenz. Der Spiegel 29.
Zhou, Enlai. 1990. Zhou Enlai waijiao wenxuan (Ausgewählte diplomatische Schriften von Zhou Enlai). Peking: Central Party Literature Press.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Lian, Yr. (2023). China und Deutschland vor globalen Herausforderungen. In: Hu, C., Triebel, O., Zimmer, T. (eds) Im Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdverstehen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_13
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_13
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-40030-9
Online ISBN: 978-3-658-40031-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)