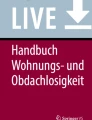Zusammenfassung
Die Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen wird in pflegewissenschaftlichen Diskursen bislang nur randständig betrachtet. Erkenntnisse zur Pflege dieser Zielgruppe sind notwendig, da die körperlichen Besonderheiten zu einer Inanspruchnahme pflegerischer Hilfestellungen führen können. Im Rahmen unserer qualitativen Grounded-Theory-Studie konnte gezeigt werden, dass Lebensqualität im Mittelpunkt der Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen steht. Demnach werden pflegerische Handlungen maßgeblich durch das Wohn- und Hilfsumfeld, z. B. stationäres oder ambulantes Wohnen, sowie intervenierende Bedingungen, z. B. das Ausmaß der Akzeptanz einer vorhandenen Körperbehinderung, beeinflusst. Pflegerische Maßnahmen können dann die Veränderung der Wohnform oder die positive Beeinflussung von Verarbeitungsprozessen sein, jedoch immer mit dem Ziel, dass Menschen mit Körperbehinderung selbst über die eigene Lebensqualität entscheiden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Die Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen wird in pflegewissenschaftlichen Diskursen bislang nur randständig betrachtet. Erkenntnisse zur Pflege dieser Zielgruppe sind notwendig, da die körperlichen Besonderheiten zu einer Inanspruchnahme pflegerischer Hilfestellungen führen können. Im Rahmen unserer qualitativen Grounded-Theory-Studie konnte gezeigt werden, dass Lebensqualität im Mittelpunkt der Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen steht. Demnach werden pflegerische Handlungen maßgeblich durch das Wohn- und Hilfsumfeld, z. B. stationäres oder ambulantes Wohnen, sowie intervenierende Bedingungen, z. B. das Ausmaß der Akzeptanz einer vorhandenen Körperbehinderung, beeinflusst. Pflegerische Maßnahmen können dann die Veränderung der Wohnform oder die positive Beeinflussung von Verarbeitungsprozessen sein, jedoch immer mit dem Ziel, dass Menschen mit Körperbehinderung selbst über die eigene Lebensqualität entscheiden.
The care of people with physical disabilities has so far only marginally been considered in nursing science discourses. Insights into the care of this target group are necessary, as their physical characteristics can make it necessary to seek nursing assistance. Within the framework of our qualitative grounded theory study, we were able to show that the care of people with physical disabilities is focused on quality of life. Accordingly, nursing actions are significantly influenced by the living and support arrangements, e.g. whether the people in need of care live at home, in a nursing home or in special forms of housing, as well as intervening conditions, e.g. the extent to which they accept their physical disability. Nursing measures can then mean a change of the form of living or a positive influence on their assimilation process, but always with the aim of enabling people with physical disabilities to decide for themselves about their own quality of life.
1 Einleitung und Zielsetzung
Zum Ende des Jahres 2019 lebten in Deutschland 7,9 Mio. Menschen mit einer Schwerbehinderung. Ca. 58 % von ihnen weisen eine Körperbehinderung auf (Destatis Statistisches Bundesamt 2020). Körperbehinderungen sind die häufigste Form einer Behinderung. Bei ca. 25 % der Menschen mit Körperbehinderungen sind die inneren Organe bzw. Organsysteme betroffen, bei rund 11 % sind Arme und/oder Beine in ihrer Funktion eingeschränkt. Etwa 10 % weisen eine Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes auf (Destatis Statistisches Bundesamt 2021). Mit 89,4 % sind Krankheiten ursächlich für eine Behinderung, bei 3,3 % ist die Behinderung angeboren und bei 1,4 % wurde die Behinderung durch einen Unfall verursacht. Die Zahl der schwerbehinderten Menschen steigt sowohl in Deutschland als auch weltweit an (Destatis Statistisches Bundesamt 2021; World Health Organization 2020). Infolge einer Körperbehinderung können Betroffene auf Hilfestellungen angewiesen sein. Die Lebens- und Versorgungssituation von Menschen mit Körperbehinderung wird unter anderem durch Leistungen der Eingliederungshilfe und durch Pflegeleistungen geprägt. Latteck und Weber (2018) weisen darauf hin, dass sich Pflege und Eingliederungshilfe unabhängig voneinander entwickelt haben, was sich an der rechtlichen Verortung in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern zeige. Die Autorinnen führen aus, dass sich Zielsetzungen und theoretische Bezüge der Eingliederungshilfe und der Pflege voneinander unterscheiden. Eingliederungshilfeleistungen verstehen sich als Hilfeleistungen, in denen Teilhabe und Selbstbestimmung als Maxime eines Normalisierungsprinzips an oberster Stelle stehen, während pflegerische Hilfestellungen unterstützend, anleitend und begleitend sind (Latteck und Weber 2018). Sowohl Eingliederungshilfe als auch Pflegeleistungen prägen die Versorgungslandschaft von Menschen mit Körperbehinderungen.
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird Behinderung, angelehnt an die Grundgedanken der Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, in Wechselwirkung mit gesellschaftlicher Teilhabe betrachtet:
Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können (§ 2 Abs. 1 SGB IX).
In der Folge können pädagogische und pflegerische Hilfestellungen notwendig sein. Pflege umfasst gemäß der Definition des International Council of Nurses die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung von Menschen aller Altersgruppen in allen Lebenssituationen. Die Pflege von Menschen mit Behinderungen wird eindeutig mit aufgeführt (ICN – International Council of Nurses 2022). Angelehnt an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wird das Ausmaß eines gegebenen Pflegebedarfs ausgehend vom vorhandenen Grad der Selbstständigkeit innerhalb der Gestaltung von Lebensbereichen festgestellt (Büscher und Wingenfeld 2018).
Hedderich (2006, S. 24) beschreibt Körperbehinderung aus Sicht der Pädagogik als ursächlich für eine eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe:
Köperbehinderung ist ein Beschreibungsmerkmal für einen Menschen, der infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungsapparates, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Erkrankung in seiner Bewegungsfähigkeit und der Durchführung von Aktivitäten dauerhaft oder unüberwindbar beeinträchtigt ist, so dass die Teilhabe an Lebensbereichen bzw. -situationen als erschwert erlebt wird.
Wechselwirkungen aus Körperbehinderung und Teilhabe finden sich auf einer theoretischen Ebene in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) wieder (World Health Organization 2005). Die ICF bildet eine Synthese aus medizinischem und sozialem Behinderungsmodell: den biopsychosozialen Ansatz. Behinderung ist damit ein Prozess aus Wechselwirkungen, an denen die körperlichen Funktionen und Strukturen, Aktivitäten sowie die Teilhabe an der Gesellschaft beteiligt sind (Forstner 2019). Das medizinische Modell sieht Behinderung als Resultat körperlicher Voraussetzungen, d. h. als individuelles Schicksal in einem Ursache-Wirkungs-Verhältnis. Das medizinische Modell ist kein festgeschriebenes und explizit definiertes Modell; vielmehr ist es eine Sichtweise auf Behinderung, die aufgrund gemachter Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen selbst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist (Egen 2020). Als Antwort darauf wurde das soziale Modell von Behinderung (vgl. u. a. Hughes und Paterson 1997) formuliert. Dieser Ansatz sieht die Ursachen von Behinderung nicht im Einzelnen, sondern in der Konsequenz einer ungenügenden gesellschaftlichen Umwelt, z. B. durch künstlich erschaffene Barrieren wie Treppen oder Randsteine, die Menschen behindern (Kastl 2016).
Die praktische Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen ist komplex: Unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe führen zu unterschiedlichen Wohn- und Hilfsformen. Diese sind in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern verortet. Als mögliche Versorgungsformen kommen bei Menschen mit Körperbehinderungen stationäres Wohnen (stationäre Altenpflege oder besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe), ambulante Pflege- und/oder Assistenzdienste (Einzelwohnung oder WG bzw. mit oder ohne Angehörige) oder auch das persönliche Budget als Arbeitgebermodell in Betracht. Grundgedanken wie Autonomie und Selbstbestimmung und der Wunsch von Menschen mit Körperbehinderungen, Entscheidungen selbst zu treffen, können dem Angewiesensein auf Hilfe gegenüberstehen, Spannungsfelder können sich bilden. Pflegerische Hilfestellungen stehen im Zusammenhang mit der Qualität eines guten Lebens. Bartholomeyczik (2022) spricht in diesem Zusammenhang davon, trotz Abhängigkeit von Pflege eine gute Lebensqualität zu haben. Lebensqualität wird in verschiedenen Disziplinen und unterschiedlichen wissenstheoretischen Kontexten diskutiert (Weidekamp-Maicher 2018). Vielmehr kann Lebensqualität als Metathema betrachtet werden, das vielschichtig, interpretationsoffen und historisch aufgeladen ist. Der Begriff beinhaltet unterschiedliche Konzepte wie Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit sowie Glück und trägt gleichermaßen eine ressourcenorientierte Sicht, einen qualitativen Status sowie eine prospektive Entwicklung in sich (Staats 2022). Innerhalb von Pflege wird Lebensqualität gemeinsam mit den Menschen entwickelt, die auf pflegerische Hilfestellungen angewiesen sind. Gleichzeitig sind qualitativ hochwertige pflegerische Hilfestellungen nicht die einzige Einflussgröße auf die Lebensqualität (Bartholomeyczik 2022).
Konzepte und Theorien von Lebensqualität sind für Pflegefachpersonen als Leitperspektive pflegerischen Handelns unerlässlich, um die Qualität erbrachter Hilfestellungen zu beurteilen und ggf. zu verbessern. Durch gezielte pflegerische Hilfestellungen sowie das Wissen um beeinflussende Faktoren kann die Lebensqualität bei Pflegebedürftigen gesteigert werden (McDonald 2016). Im Rahmen einer von den Verfassenden durchgeführten Grounded-Theory-Studie zeigte sich, dass Lebensqualität bei Menschen mit Körperbehinderung eine zentrale Bedeutung hat. Die Grounded Theory ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung, die die Theoriebildung verfolgt und hierzu Daten zeitgleich erhebt und auswertet. Somit entsteht die Theorie „gegenstandsorientiert“. Gleichzeitig wird die Zielgruppe im Rahmen der pflegewissenschaftlichen Diskussion bisher kaum berücksichtigt (Behrens et al. 2012)
Dieser Beitrag verfolgt das Ziel, die Bedeutung von Lebensqualität für Menschen mit Körperbehinderungen und einem damit einhergehenden Bedarf an pflegerischen Hilfestellungen aufzuzeigen. Auftretende Spannungsfelder werden dargestellt und Lösungsansätze diskutiert. Im nächsten Abschnitt wird der Status quo der Versorgungssituation betrachtet.
2 Status quo der Versorgungssituation von Menschen mit Körperbehinderungen
Die Versorgung von Menschen mit Körperbehinderungen kann individualisiert durch Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflegeversicherung erfolgen. Die Menschen selbst sehen ihren Hilfebedarf als originär körperlich, d. h. als Ersatz für fehlende Funktionsfähigkeit von Händen und/oder Beinen. Sprachliche Fähigkeiten sowie das benötigte sprachliche Ausdrucksvermögen sind vorhanden, sodass Wünsche und Anforderungen an pflegerische Hilfestellungen verbal oder mittels Technikunterstützung kommuniziert werden können.
Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen, wenn sie aufgrund einer Behinderung wesentlich eingeschränkt oder von Behinderung bedroht sind (siehe hierzu § 2 SGB IX). Die Eingliederungshilfe übernimmt nach individuellem Bedarf therapeutische, pädagogische oder sonstige Fachleistungen. Leistungen der Eingliederungshilfe sind vielfältig. Es existieren Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (siehe hierzu § 102 SGB IX). Aufgabe der Eingliederungshilfe ist, eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Im Vordergrund stehen die selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensplanung und -führung (siehe hierzu § 90 SGB IX).
Pflegeleistungen resultieren aus einer gesundheitlich bedingten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen können dazu führen, dass ein Hilfebedarf entsteht, dem durch pflegerische Hilfestellungen begegnet werden kann (siehe hierzu § 14 SGB XI). Beide Leistungen können nebeneinander in Anspruch genommen werden. Pflegeleistungen verfolgen das Ziel, dass Menschen mit Körperbehinderung ihre körperlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten wiedergewinnen oder diese erhalten werden. Die Eingliederungshilfe hingegen ermöglicht eine individuelle Lebensführung und soll eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft fördern (Fix 2017).
In Anbetracht des weltweit wachsenden Anteils von Menschen mit Behinderungen steigt die Bedeutung der Pflege (Büker 2014) sowie die Bedeutung des pflegerischen Einflusses auf die Steigerung der Lebensqualität. Unterschiedliche Wohn-, Hilfs-, und Versorgungformen geben Menschen mit Körperbehinderungen die Möglichkeit zur individuellen Entfaltung sowie zur Kompensation vorhandener Bedarfe. Das Wunsch- und Wahlrecht (§ 104 SGB IX) stellt sicher, dass die Vorstellungen der betroffenen Personen berücksichtigt werden. Zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung gehört das Recht, jederzeit den Aufenthaltsort frei zu wählen. Der Wohnraum muss den Bedürfnissen des behinderten Menschen entsprechen, etwa durch die Ausgestaltung von Dienstleistungen, zudem muss er barrierefrei sein (Maetzel et al. 2021).
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurden aus den ehemals stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe sog. besondere Wohnformen. Stationäre Einrichtungen wurden bis Ende 2019 pauschal finanziert, d. h. Miete für den Wohnraum, Kosten für Verpflegung (existenzsichernde Leistungen) und Kosten für Pflege und Pädagogik (Fachleistung) wurden gemeinsam abgegolten. Durch das BTHG und die Aufhebung der formalen Trennung existenzsichernder und Fachleistungen werden Hilfen personenzentriert und damit unabhängig von strukturellen Begebenheiten erbracht (Lebenshilfe 2021; Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz 2021). In den besonderen Wohnformen werden Leistungen der Pflegeversicherung mit 15 % der pauschal vereinbarten Vergütung, jedoch mit max. 266 €/Monat abgegolten (vgl. hierzu § 43a SGB XI). Begründet wird diese pauschale Finanzierung der Pflege i. d. R. mit dem Auftrag der Einrichtung, da der Schwerpunkt auf der Eingliederungshilfe liegt und damit auf die Teilhabe gerichtet wird. Die benötigten Leistungen werden von einem Pool an Mitarbeitenden erbracht.
Neben besonderen Wohnformen existieren klassische Altenpflegeheime im Sinne des § 43 SGB XI, in denen Menschen mit einer Körperbehinderung leben und pflegerisch versorgt werden. Der Begriff der Altenpflege legt nahe, dass in diesem Setting vorwiegend ältere Menschen mit einem Pflegebedarf versorgt werden. Unter dem Slogan wie z. B. „Junge Pflege“ leben auch Menschen unter 60 Jahren dort, unter anderem Personen mit Körperbehinderungen. Bedürfnisse und Tagesabläufe dieser jungen Menschen mit Hilfebedarf unterscheiden sich von denen der älteren Zielgruppe und führen zu Herausforderungen in der Versorgung. Schmitt und Homfeldt (2020) beschäftigen sich in ihrer Publikation mit den Bedürfnissen junger Pflegebedürftiger und konstatieren, dass sich junge Menschen mit Behinderungen unter anderem in die strukturellen Besonderheiten der pflegerischen Versorgung einbringen wollen, hierdurch Teilhabe an der Gesellschaft erfahren und sich eingebunden fühlen. Besonders die Zielgruppe der jungen Menschen unter 60 Jahren mit einer Pflegebedürftigkeit wird im pflegerischen Diskurs oft vernachlässigt.
Eine weitere Wohn- und Hilfsmöglichkeit ist die ambulante Versorgung nach § 71 SGB XI. Die Betroffenen wohnen einer angemieteten Wohnung oder Wohngemeinschaft; die benötigten Leistungen werden bei Pflege- und/oder Assistenzdiensten gebucht und individuell erbracht. Grundlegendes Ziel ambulanter Pflege besteht darin, Menschen trotz Pflegebedürftigkeit den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Die grundsätzlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen führen zu festgelegten Abrechnungsmodalitäten mit den Pflegekassen. Voraussetzung für die Zulassung als Pflegedienst ist ein Versorgungsvertrag (Büscher und Krebs 2018). Eine weitere Möglichkeit – ohne Einbindung von Versorgungsverträgen und Pflegediensten – sind Arbeitgebermodelle für Menschen mit Körperbehinderungen. Auch hier bewegt sich die Versorgungsform unter ambulanten Rahmenbedingungen, d. h. in der eigenen Häuslichkeit. Durch das persönliche Budget ist es möglich, als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin tätig zu werden und nach individuellem Bedarf selbst Personen sozialversicherungspflichtig einzustellen, die aufkommende Bedarfe kompensieren. Je nach Qualifikation werden die Mitarbeitenden als Assistenten bzw. Assistentinnen bezeichnet. Abhängig von Art und Schwere des Hilfebedarfs kann bis zu 24 h am Tag eine Assistenz anwesend sein. Die Assistenz übernimmt hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Freizeitbegleitung, Studiums- oder Arbeitsassistenz und pflegerische Hilfestellungen. Die Finanzierung erfolgt durch verschiedene Träger (z. B. Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung), jedoch mit dem Unterschied, dass der Mensch mit Behinderung als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin die Gelder verwaltet, Mitarbeitende eigenverantwortlich anstellt und die Löhne überweist (Millich 2016).
Ältere und neuere Publikationen weisen darauf hin, dass pflegewissenschaftliche Annäherungen an Menschen mit Behinderung rar sind. Bereits 2003 formulierte Tiesmeyer, dass aufgrund stark pädagogisch orientierter Ansätze in der Behindertenhilfe den pflegerischen Aufgaben und Arbeitsinhalte wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird (Tiesmeyer 2003). Menschen mit Behinderungen haben einen spezifischen Bedarf an pflegerischer Unterstützung (Latteck und Weber 2018). Die Agenda Pflegeforschung möchte durch das Aufgreifen relevanter Aspekte für Pflegeforschung und Lehre eine qualitativ hochwertige Pflege erreichen. Es werden Zielgruppen vorgestellt und spezifische Aspekte innerhalb der Pflegeforschung beschrieben, die aufgrund fehlender wissenschaftlicher Grundlagen zu Versorgungsproblemen führen. In der Agenda wird als prioritäres Thema die Pflege von Menschen mit Behinderungen aufgerufen; die Pflege dieser Zielgruppe wird als bedeutsame gesellschaftliche Aufgabe beschrieben. Dabei wird betont, dass Behinderung keine Krankheit ist und damit weder der Pflege chronisch kranker Menschen noch der Altenpflege zugeordnet werden kann. Selbstbestimmung und Partizipation sind zentrale Ziele der Pflege bei vorhandenen Behinderungen (Behrens et al. 2012) Auch Büker (2014) weist darauf hin, dass dem Thema Behinderung in der Pflegewissenschaft eine höhere Priorität einzuräumen sei.
Die Pflege in der Häuslichkeit unterscheidet sich von der Pflege im Krankenhaus dahingehend, dass sie sich an der Lebenswelt der Betroffenen orientiert. Der Pflegebedarf ist individuell; die Förderung der Selbstständigkeit, die Stärkung der Unabhängigkeit sowie die Steigerung des Wohlbefindens stehen dabei im Vordergrund pflegerischer Interaktionen. Ein Scoping Review ergab, dass sich die nationale und internationale Literatur vorwiegend mit Übergängen zwischen Versorgungssettings, pflegenden Angehörigen sowie der Verbesserung von Selbstständigkeit befasst (Helbig et al. 2022). Eine Annäherung aus der Perspektive von Menschen mit Körperbehinderung selbst sowie der Pflegefachpersonen, die in die Pflege eingebunden sind, blieb bisher aus. Die Beteiligung der betreffenden Menschen selbst ist jedoch nicht nur in der Diskussion um mehr Teilhabe und Selbstbestimmung unerlässlich.
3 Methodik
Um darzustellen, wie Menschen mit Körperbehinderungen pflegerische Hilfestellungen erleben, führten wir ein qualitatives Forschungsprojekt durch. Da die Zielgruppe im Rahmen der Pflegewissenschaft weitestgehend unbeachtet ist, eignete sich der explorative und interpretative Ansatz der Grounded Theory (Strauss und Corbin 2010). Die Ethik-Kommission der Universität Witten/Herdecke erteilte die Erlaubnis, die Studie durchzuführen (Antrag Nr. 22/2019).
Zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage im Projekt „Wie wird die Pflege von Menschen mit Körperbehinderung von Pflegefachkräften gestaltet?“ wurden 27 Menschen mit einer Körperbehinderung mittels problemzentrierter Interviews (Witzel 2000) befragt. Aufgrund der Vielfalt von Körperbehinderungen und der Wohnmöglichkeiten wählten wir Personen aus, die in besonderen Wohnformen (n = 5), ambulanten Wohnformen (n = 22), davon in Wohngemeinschaften (n = 1) oder im Rahmen eines Arbeitgebermodells (n = 4) versorgt wurden. Außerdem haben wir sowohl Menschen mit erworbenen (n = 10) als auch solche mit angeborenen (n = 17) Körperbehinderungen befragt. Weiter wurden die Erfahrungen mit den in Anspruch genommenen professionellen pflegerischen Hilfestellungen berücksichtigt. So wählten wir bewusst sowohl Menschen aus, die zum ersten Mal professionelle Hilfestellungen erhielten, als auch Personen, die bereits über Jahrzehnte derlei Hilfe in Anspruch genommen hatten. Das Alter der Befragten reichte von 21 bis 60 Jahre (Mittelwert 42). 15 Teilnehmende bezeichneten sich als männlich, 12 als weiblich. Der Behinderungsgrad betrug im Mittel 99,6 (Modalwert 100). Der mittlere Pflegegrad betrug 4,04 (Modalwert 5).
4 Ergebnisse
Ziel einer jeder Grounded-Theory-Studie ist die Identifikation eines Kernphänomens. Dieses Phänomen steht in Mittelpunkt der Datenauswertung und hat Bezüge zu allen weiteren identifizierten Phänomenen. Das Kernphänomen der Studie lautet „Lebensqualität mit Hilfestellungen selbst beeinflussen“. Lebensqualität steht damit aus der Perspektive der Betroffenen im Mittelpunkt der Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen. Diese kann auf einem hohen oder auch niedrigen Niveau ausgestaltet sein. Die Einordnung ist abhängig davon, wie die Betroffenen die erhaltenen pflegerischen Hilfestellungen im Abgleich mit ihren Wünschen und Anforderungen an die benötigten Hilfestellungen subjektiv bewerten. Diese Bewertung ist wiederum die Grundlage für die Einordnung von Lebensqualität. Als positive Konsequenz wahrgenommener Lebensqualität kann sich ein Zustand des Wohlfühlens bzw. Unwohlfühlens entwickeln (Helbig et al. 2022). In diesem Beitrag wird der Schwerpunkt auf Kontext, Hauptphänomen sowie damit einhergehende pflegerische Interventionsmöglichkeit gelegt.
4.1 Kontext: Art der Wohn- und Hilfsform
Jedes Phänomen tritt in einem spezifischen Set an Bedingungen auf. Diese sind Zeit, Ort, Dauer, soziales oder kulturelles Umfeld. Dieses Set an Bedingungen wird in der Grounded Theory Kontext genannt. Die Phänomene sind damit nicht isoliert zu betrachten, sondern stehen in einem direkten Zusammenhang zum Kontext und erlangen hierdurch eine spezifische Bedeutung. Eine Voraussetzung für ein Leben nach eigenen Vorstellungen und damit die Ermöglichung von Lebensqualität ist die richtige Wohn- und Hilfsform, die zu den gegebenen Bedürfnissen und Bedarfen passt. Jede Möglichkeit des Wohnens hat spezifische Vor- und Nachteile. Die Wahl des Wohnortes erfolgt unter Abwägung von individuell gesetzten Mindestanforderungen, Erwartungen und Wünschen. Nicht zuletzt hat die Verfügbarkeit einen großen Einfluss.
Die Verfügbarkeit von Wohnmöglichkeiten variiert stark. Stationäre Wohnplätze sind im Vergleich zu ambulanten Wohnformen schneller verfügbar, da der Genehmigungsprozess aufgrund geringerer Kosten unkomplizierter ist. Diese Wohnform zeichnet sich durch eine hohe Versorgungssicherheit bis zu 24 h am Tag aus. Es besteht ein Komplettpaket aus barrierefreiem Wohnraum und pflegerischen Hilfestellungen, die durch einen Pool an Mitarbeitenden im Drei-Schicht-System erbracht werden.
Für ambulante Hilfestellungen wird barrierefreier Wohnraum benötigt, der zumeist in älteren Wohnungen nicht vorhanden ist und erst allmählich in Neubauten standardisiert wird. Außerdem müssen bei den verschiedenen Kostenträgern (z. B. Eingliederungshilfeträger, Pflegeversicherung) Bewilligungen eingeholt werden. Bei einer notwendigen Eins-zu-Eins-Betreuung im ambulanten Umfeld ist zudem die Sicherheit der Leistungserbringung durch mögliche Ausfälle der Mitarbeitenden ein fragiles Konstrukt. In dieser Wohnform besteht jedoch mehr Flexibilität durch höhere individuelle Zeitkontingente.
Vor dem Leben außerhalb dieser Anstalten stehen jedoch hohe Hürden: Man braucht eine barrierefreie Wohnung, in der auch Assistenten eine Rückzugsmöglichkeit haben. Man braucht ein Assistenzteam. Man braucht eine Kostenübernahmezusage eines Kostenträgers. Und das alles punktgenau zum selben Zeitpunkt. Klappt auch nur ein Parameter nicht, fällt das gesamte Kartenhaus in sich zusammen (IP 17).
Die pflegerischen Hilfestellungen können von grundpflegerischen Tätigkeiten, hauswirtschaftlicher Unterstützung, Behandlungspflege bis hin zur Freizeitbegleitung und Alltagsunterstützungen variieren. Die Durchführung von Hilfestellungen lebt von der Qualität der Beziehung zwischen den Menschen mit einer Körperbehinderung und den Helfenden; Interaktionen gelingen besser, wenn jede Seite ihre Persönlichkeit einbringen kann. Die Beziehung sollte sich keineswegs einseitig gestalten im Sinne eines Roboters, der ausschließlich Befehle ausführt. Sympathie und gemeinsam Spaß zu haben lockert die Atmosphäre auf und trägt zu mehr wahrgenommener Lebensqualität bei. Bei hoher Sympathie und häufigen gemeinsamen Interaktionen entsteht ein Vertrauensverhältnis, das die Beziehungsqualität stärkt. Fehlt die Sympathie, wird lediglich das Notwendigste besprochen, unpersönliche und distanzierte Beziehungen mit Helfenden und ein damit verbundenes hierarchisches Gefälle können entstehen. Die gewünschte Augenhöhe geht verloren.
Wenn du die Personen irgendwann öfters siehst, baust du tatsächlich auch eine persönliche Beziehung zu denen auf. Das ist so. Also sie sind mir dann in dem Sinne nicht egal, sie sind nicht anonym und dadurch entwickle ich natürlich auch ein Interesse an den Personen und die durchaus – denke ich – auch an mir, wie es mir geht (IP 6).
4.2 Kernphänomen: Lebensqualität mit Hilfestellungen selbst beeinflussen
Die Studie zeigt, dass das Kernphänomen „Lebensqualität mit Hilfestellungen selbst beeinflussen“ für Menschen mit Körperbehinderung als Betroffene im Mittelpunkt steht. Lebensqualität und sich Wohlfühlen haben für Menschen mit Körperbehinderungen die höchste Bedeutung. Lebensqualität steht für eine hohe Zufriedenheit mit den einhergehenden und notwendigen Hilfestellungen sowie für eine entspannte atmosphärische Grundstimmung, während die Hilfestellungen gegeben werden. Entspannung und ein Gefühl von Sicherheit entstehen. Lebensqualität ist subjektiv gestaltbar. Wünsche an das eigene Leben sowie Wünsche und Anforderungen an zu erbringende Hilfestellungen prägen Erwartungen an pflegerische Hilfestellungen und gleichsam einen Standard, der innerhalb der Versorgung erreicht werden soll. Hierzu gehört beispielsweise, dass Wünsche im Rahmen der Körperpflege von den Pflegepersonen umgesetzt werden. Werden Vorlieben berücksichtigt, hat das wiederum einen direkten Einfluss auf das Wohlfühlen.
Da geht es um eine Harmonie, um eine Zufriedenheit, um, ja, eine Geborgenheit vielleicht auch. Zu Hause möchte ich mich ja geborgen und zufrieden fühlen und möchte nicht gegen irgendetwas kämpfen. Ich überspitze das immer so ein bisschen. Und, ja, da ist Harmonie und Runterkommen und Entspannen vom Alltag und so weiter; sind da, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte (IP 15).
Erhaltene Hilfestellungen werden mit den vorhandenen Wünschen und Anforderungen abgeglichen. Liegen Anforderungen an und Erhalt von Hilfestellungen nah beieinander, entsteht ein Wohlgefühl und die Lebensqualität wird als hoch beschrieben. Bei Unstimmigkeiten entsteht ein Unwohlsein. Drei Interventionsmöglichkeiten konnten innerhalb unserer Studie identifiziert werden:
Die erste Möglichkeit ist die Veränderung des Kontextes der Wohn- und Hilfsform; er kann die individuelle Entfaltung durch strukturelle Gegebenheiten (Wohnraum, vorhandene Zeit für Hilfe) einschränken. Infolgedessen kann ein Umzug oder ein Wechsel der Hilfsform angestrebt werden.
Immer wieder dreht sich das im Kopf. So und so will ich das haben. So und so wird das dann sein. Das ist schwer. Da dreht man sich ewig im Kreis. Und das wollte ich irgendwann. Da wird man unzufrieden. Da staut sich etwas in einem auf. Und das ist dann schwer. Und das kommt dann meistens in den ungünstigen Situationen zum Ausbruch. (…). Und das wollte ich einfach nicht mehr und deshalb habe ich gesagt: „Ich muss raus“ (IP 29).
Die zweite Möglichkeit beschreibt die Reflexion und ggf. Anpassung intervenierender Bedingungen. Durch Reflexion der eigenen Wünsche an die Hilfestellungen, Auseinandersetzung mit und Akzeptanz der Körperbehinderung bzw. bewusste Reflexion von Erfahrungen sowie aktive Einflussnahme auf die Durchführung von pflegerischen Hilfestellungen kann deren Durchführung direkt sowie in der Konsequenz auch die Lebensqualität angepasst werden.
Also ich kann ja selbst sagen, also wie ich gerne was hätte, wie man mich waschen soll. Oder, dass ich selbst in den Rollstuhl klettere und nicht geliftet werden möchte. Das kann ich ja alles frei selbst entscheiden. Ob ich überhaupt duschen möchte oder nicht. Ob ich auf Toilette muss oder nicht (IP 12).
Die dritte Interventionsmöglichkeit ist passiv. Menschen mit Körperbehinderung können im Beeinflussen von Lebensqualität scheitern und dann keine hohe Lebensqualität erreichen. Sie verharren im „Sich-Unwohlfühlen“, ohne Handlungsabsichten zu verspüren. Auf die Frage an einen Interviewteilnehmer aus dem stationären Kontext, was ihm zum Wohlfühlen fehlt, antwortet er:
Vertrauen zu den Pflegekräften vielleicht. Einfach mal rausgehen können und nicht immer sagen, „nein, ich kann gerade nicht“. Weil, ich war vorher jeden Tag draußen. Ich habe jeden Tag was Neues erlebt. Und das fehlt mir hier (IP 33).
Obwohl er seine Bedürfnisse klar wahrnimmt und es potenzielle Lösungsmöglichkeiten gibt, verspürt der Interviewteilnehmer keinen Wunsch umzuziehen und die Wohn- und Hilfsform zu wechseln. Infolgedessen verharrt er im Unwohlsein.
4.3 Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen innerhalb der Pflege
Im Rahmen der durchgeführten Grounded-Theory-Studie fiel auf, dass viele Berufsgruppen sich auf unterschiedliche Weise mit Menschen mit einer Körperbehinderung und den damit einhergehenden Bedarfen befassen.
Der Einbezug verschiedener Berufsgruppen kann verschiedene Funktion erfüllen: Sich abzusichern, Probleme zu klären sowie sich im Team gegenseitig zu unterstützen. Die Zusammenarbeit hat einen hohen Einfluss darauf, Klarheit zu gewinnen. Verschiedene Situationen werden kommunikativ und kollegial reflektiert. Dies kann einerseits im eigenen Team erfolgen, beispielsweise unter allen Mitarbeitenden einer Wohneinrichtung oder auch im erweiterten Team unter Einbezug des Hausarztes und der Therapeutinnen und Therapeuten. Eine erfolgreiche multiprofessionelle Zusammenarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Sicht jeder einzelnen Berufsgruppe durch eine gemeinsame Betrachtungsweise unterschiedlicher Berufsgruppen ergänzt wird.
Ja, ich glaube schon, dass man da auch vielmehr zusammenarbeiten sollte, weil manchmal die Einseitigkeit einer Berufsgruppe und die Einzigartigkeit der anderen Berufsgruppe, wenn man die in einen Topf wirft, doch so wundervolle Dinge hervorbringt (IP 7).
Da Körperbehinderungen individuell sind, sind auch die gegebenen Herausforderungen breit gefächert. Ein Austausch mit den Teamkollegen hilft, Individualität der pflegerischen Versorgung sowie Sicherheit für das eigene Handeln herzustellen:
Und wenn man die Lösung selbst nicht findet, dann fragt man bei seinen Teamkollegen nach, wie machst du das denn eigentlich? Und ja, das macht den Beruf ja auch ein Stück weit aus, dass man halt nicht die Schulbuch-Patienten hat, bei denen man Schema F durchführt, sondern dass man halt seine eigenen Lösungsstrategien auch ein Stück weit finden muss (IP 09).
Nicht zuletzt ist es von hoher Bedeutung, das erweiterte Team zu kennen, d. h. auch mit Namen. Durch den persönlichen Kontakt und kurze Gespräche über die Therapieinhalte können die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte miteinander abgestimmt, reflektiert und kontinuierlich verbessert werden. Dadurch kann sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit ergeben:
Es kann nur Vorteile haben mit den Therapeuten zusammenzuarbeiten, denn nur ein Zusammenarbeiten erbringt Erfolge. (…) Unser Job ist es halt dann auch zu fragen was haben Sie gemacht? Was können wir als Pflegepersonal verbessern? Wie können wir besser zusammenarbeiten? Was können wir noch übernehmen? (IP 10)
5 Diskussion der Ergebnisse und Lösungsansätze
Lebensqualität trotz der Notwendigkeit pflegerischer Hilfestellungen selbst zu beeinflussen steht im Mittelpunkt der pflegerischen Versorgung von Menschen mit Körperbehinderungen. Wir konnten zeigen, dass Lebensqualität aus der Bewertung in Anspruch genommener pflegerischer Hilfestellung im Abgleich mit den Vorstellungen des pflegebedürftigen Menschen resultiert. Wenn die Lebensqualität als gering beschrieben wird, kann der Kontext des Wohnens verändert oder an intervenierenden Bedingungen wie z. B. der Reflexion gegebener Wünsche gearbeitet werden.
Die erste dargestellte Interventionsmöglichkeit zeigt, dass der Kontext der Wohnform und damit einhergehende strukturelle Bedingungen die Lebensqualität beeinflussen können. Die vorhandenen Sozialgesetze und unterschiedlichen Wege der Finanzierung und Antragstellung sind komplex; ohne ausreichendes Fachwissen sind solche Hürden schwer zu überwinden. Außerdem erscheinen die Grenzen zwischen stationärem und ambulantem Wohnen zu hart – es gibt kaum Möglichkeiten des Ausprobierens. Auch ist bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum rar. Hier sind politische Reformen notwendig, die bezahlbare Wohnformen sowie innovative Versorgungsformen möglich machen.
Um die Lebensqualität durch die Veränderung des Kontextes zu erhöhen, sollte die multiprofessionelle Zusammenarbeit verstärkt werden. Multiprofessionell bzw. multidisziplinär bedeutet, dass mehrere Berufsgruppen unabhängig voneinander tätig sind und sich jede Profession auf ihre eigenen Aufgaben fokussiert (Jakobsen 2011). Die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen im Sozial- und Gesundheitswesen wird immer wichtiger und ist en vogue (Oppermann und Schröder 2020). Das Ziel liegt in einer qualitativ hochwertigen, patientenorientierten und reibungslosen Patientenversorgung (Mahler et al. 2014). Menschen mit einer Körperbehinderung profitieren unter anderem von Pflege, Therapie, sozialer Arbeit und Medizin. Dabei hat jede Berufsgruppe bestimmte Aufgaben und Ziele, die wiederum einzelne Teile innerhalb der Gesamtversorgung widerspiegeln. Jakobsen (2011) führt aus, dass innerhalb der Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen jeweils eigene berufliche Kernkompetenzen entstehen. Ausgebildete Pflegefachkräfte sind beratend und durchführend tätig. Sie erheben den Pflegebedarf, schreiben Pflegeplanungen, überwachen den Pflegeprozess, führen Schulungen und Anleitungen von Mitarbeitenden ohne pflegerische Ausbildung durch. Nicht zuletzt beraten sie Menschen mit Behinderungen in pflegefachlichen und gesundheitlichen Fragestellungen oder entwickeln und implementieren pflegefachliche Konzepte (Uhl 2017). Unter persönlicher Assistenz wird eine umsetzende Hilfsform für Menschen mit Behinderungen verstanden, mit der sie ein selbstbestimmtes Leben im Alltag führen können. Die Hilfen können über pflegerische, hauswirtschaftliche oder begleitende Tätigkeiten verschiedene Inhalte aufweisen (Mohr 2006). Auch die soziale Arbeit sieht Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe des Handelns (Rohrmann 2018). Die Hauptaufgabe liegt gemäß Röh (2011) darin, die Zusammenhänge zwischen Person und Umwelt mittels spezifischer Methoden und Einsatzgebieten zu ergründen. Unter anderem durch Einzelfallhilfen, Beratung, Kompetenzförderung soll personenzentrierte Unterstützung angeboten werden. Pflegefachpersonen sollten die Veränderungen von Kontexten begleiten und durch gezieltes Empowerment unterstützen. Durch ein vertieftes Wissen ist es ihnen möglich, die multiprofessionelle Zusammenarbeit beteiligter Berufsgruppen zu unterstützen. In der Praxis kann die Zusammenarbeit im Rahmen übergreifender Fallkonferenzen erfolgen, immer in Anwesenheit der betreffenden Menschen. Eine einheitliche und gemeinsame Dokumentation erleichtert die Transparenz über abgesprochene Ziele und Hilfestellungen.
Die bewusste Reflexion von intervenierenden Bedingungen und damit einhergehenden Denkhaltungen hat ebenfalls einen Einfluss auf die Lebensqualität. Das Identifizieren von Wünschen, Klären von Prioritäten und notwendige Anpassungen sowie das Arbeiten an der Akzeptanz gegebener Funktionseinschränkungen können Aufgaben einer erweiterten Pflegepraxis sein. Pflegewissenschaftliche Konzepte wie Advanced Nursing Practice (ANP) können die Versorgungsqualität von Menschen mit Körperbehinderung verbessern. Unter ANP wird eine erweiterte und wirksame Pflege auf Masterebene verstanden. Spezialisierung und Praxiserfahrungen sind damit einhergehend notwendig (Spirig und De Geest 2004). Die Arbeit an intervenierenden Bedingungen zur Verbesserung von Lebensqualität kann das pflegerische Aufgabenfeld erweitern. Advanced Nursing Practice innerhalb der Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen sollte über Pilotprojekte ausprobiert und wissenschaftlich ausgewertet werden.
Wenn Menschen mit einer Körperbehinderung sich entscheiden, in einem Unwohlsein zu verbleiben, sollten Erkrankungen wie z. B. eine Depression zwingend ausgeschlossen werden. Auch wenn diese Entscheidungen akzeptiert werden müssen, sollten die Pflegenden regelmäßige Gespräche und Hilfe anbieten. Ohne Druck können Angebote aufgezeigt und Unterstützungsmöglichkeiten offeriert werden. Instrumente wie die motivierende Gesprächsführung können nützlich sein. Unterstützt durch Assessmentinstrumente kann auch hier die Versorgungsqualität gesteigert werden.
Durch unser Forschungsprojekt konnten der blinde Fleck der Pflege von Menschen mit Körperbehinderungen erhellt und neue Bedarfslagen identifizieren werden. Menschen mit Körperbehinderungen sind eine gering beachtete Zielgruppe im pflegewissenschaftlichen Diskurs, obwohl spezifische Versorgungsbedarfe gegeben sind: Variierende Altersspannen von jung bis älter, Unterschiede der Körperbehinderung aufgrund erworbener oder angeborener Behinderungen und eines veränderten Körpers, unterschiedliche Wohn-, Hilfs- und Versorgungsformen. Dringend geboten sind Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Evidenzlage der Versorgungsqualität. Auch moderne Konzepte für die Praxis, in denen Teilhabe und Pflege einander näher gebracht werden, sind notwendig. So können Lücken zwischen Autonomiebestrebungen der Menschen mit Körperbehinderungen und professionellem Verantwortungsbewusstsein aufgrund einer Fürsorgepflicht der Pflegefachpersonen geschlossen werden.
Literatur
Bartholomeyczik S (2022) Das Konzept Lebensqualität in der Pflege und der Pflegewissenschaft. In: Staats M (Hrsg) Lebensqualität. Ein Metathema, 1. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim Basel, S 263–280
Behrens J, Görres S, Schaeffer D, Bartholomeyczik S, Stemmer R (2012) Agenda Pflegeforschung für Deutschland. https://www.printfriendly.com/p/g/PT9KV3. Zugegriffen: 27. Jan. 2022
Büker C (2014) Pflege von Menschen mit Behinderungen. In: Schaeffer D, Wingenfeld K (Hrsg) Handbuch Pflegewissenschaft. Studienausgabe, 1. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim Basel, S 385–404
Büscher A, Krebs M (2018) Qualität in der ambulanten Pflege. In: Jacobs K, Kuhlmey A, Greß S, Klauber J, Schwinger A (Hrsg) Pflege-Report 2018. Springer, Berlin Heidelberg, S 127–134 https://doi.org/10.1007/978-3-662-56822-4_11
Büscher A, Wingenfeld K (2018) Die Entwicklung des neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit und des Begutachtungsinstruments. In: Meißner A (Hrsg) Begutachtung von Pflegebedürftigkeit. Praxishandbuch zur Pflegeeinschätzung bei Erwachsenen, 1. Aufl. Hogrefe, Bern, S 71–90
Statistisches Bundesamt (2020) Pressemitteilung Nr. 230 vom 24. Juni 2020. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_230_227.html. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Statistisches Bundesamt (2021) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen 2019. Fachserie 13, Reihe 5.1. https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-13.html. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Egen C (2020) Was ist Behinderung? Abwertung und Ausgrenzung von Menschen mit Funktionseinschränkungen vom Mittelalter bis zur Postmoderne Bd. 7. transcript, Bielefeld
Fix E (2017) Die Schnittstelle Eingliederungshilfe – Pflege im Lichte der gesetzlichen Regelungen des Bundesteilhabegesetzes und des Pflegestärkungsgesetzes III. https://www.reha-recht.de/fileadmin/user_upload/RehaRecht/Diskussionsforen/Forum_D/2017/D11-2017_Schnittstelle_Eingliederungshilfe_Pflege_im_Lichte_von_BTHG_und_PSG_III.pdf. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Forstner M (2019) ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. DISTA Disability Studies Austria/Forschung zu Behinderung, Österreich. https://dista.uniability.org/glossar/icf-internationalen-klassifikation-der-funktionsfaehigkeit-behinderung-und-gesundheit/. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Hedderich I (2006) Einführung in die Körperbehindertenpädagogik, 2. Aufl. Reinhardt, München Basel
Helbig R, Metzing S, Latteck ÄD (2022) Shaping quality of life with nursing assistance. A grounded theory approach to nursing care for people with physical disabilities and interactions with carers in long-term care. J Long Term Care. https://doi.org/10.31389/jltc.114
Hughes B, Paterson K (1997) The social model of disability and the disappearing body: towards a sociology of impairment. Disabil Soc 12:325–340. https://doi.org/10.1080/09687599727209
ICN – International Council of Nurses (2022) Nursing definitions. https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Jakobsen F (2011) Learning with, from and about each other: Outcomes from an interprofessional training unit. PhD dissertation, Aarhus University. https://www.fysio.dk/globalassets/documents/fafo/afhandlinger/phd/2011/ph.d._flemming_jakobsen_2011.pdf. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Kastl JM (2016) Einführung in die Soziologie der Behinderung, 2. Aufl. Springer VS, Wiesbaden
Latteck ÄD, Weber P (2018) Die Einschätzung des pflegerischen Unterstützungsbedarfs bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: Meißner A (Hrsg) Begutachtung von Pflegebedürftigkeit. Praxishandbuch zur Pflegeeinschätzung bei Erwachsenen, 1. Aufl. Hogrefe, Bern, S 143–162
Lebenshilfe (2021) Recht der Eingliederungshilfe – Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz. https://www.lebenshilfe.de/eingliederungshilfe-und-das-bundesteilhabegesetz. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Maetzel J, Heimer A, Braukmann J, Frankenbach P, Ludwig L, Schmutz S (2021) Dritter Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-teilhabebericht.pdf;jsessionid=E5C645339441648721A3D76F68B40453.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5. Zugegriffen: 18. Dez. 2021
Mahler C, Gutmann T, Karstens S, Joos S (2014) Begrifflichkeiten für die Zusammenarbeit in den Gesundheitsberufen. Definition und gängige Praxis. GMS Z Med Ausbild 3:1–10
McDonald T (2016) Supporting the pillars of life quality in long-term care. J Religion Spiritual Aging 28:167–183. https://doi.org/10.1080/15528030.2016.1143906
Millich N (2016) Arbeitgebermodell. „So kann ich trotz Handicap Selbstbestimmung leben“. https://www.bibliomed-pflege.de/news/29344-so-kann-ich-trotz-handicap-selbstbestimmt-leben. Zugegriffen: 16. Dez. 2021
Mohr L (2006) Was bedeutet „Assistenz“? Schweizerische Z Heilpädagogik 11:18–23
Oppermann C, Schröder J (2020) „Nicht ohne uns“: Soziale Arbeit und Adressat_innen im multiprofessionellen Feld der Altenpflege. Soz Extra 44:126–130. https://doi.org/10.1007/s12054-020-00275-6
Röh D (2011) Soziale Arbeit mit behinderten Menschen. In: Bieker R, Floerecke P (Hrsg) Träger, Arbeitsfelder und Zielgruppen der Sozialen Arbeit. Kohlhammer, Stuttgart, S 317–332
Rohrmann A (2018) Behinderung. In: Graßhoff G, Renker A, Schröer W (Hrsg) Soziale Arbeit. Eine elementare Einführung. Springer VS, Wiesbaden, S 55–68
Schmitt C, Homfeldt HG (2020) Das hier ist wirklich am Abstellgleis. Toter als tot. Neue Prax 50:231–249
Spirig R, De Geest S (2004) „Advanced Nursing Practice“ lohnt sich! Pflege 17:233–236. https://doi.org/10.1024/1012-5302.17.4.233
Staats M (2022) Lebensqualität. Ein Metathema. In: Staats M (Hrsg) Ein Metathema, 1. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim Basel, S 13–28
Strauss AL, Corbin JM (2010) Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Psychologie Verlags Union, Weinheim
Tiesmeyer K (2003) Selbstverständnis und Stellenwert der Pflege in der Lebensbegleitung von Menschen mit schwerer Behinderung (Nr. P03-123; Veröffentlichungsreihe des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld). https://uni-bielefeld.de/fakultaeten/gesundheitswissenschaften/ag/ipw/downloads/ipw-123.pdf. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
Uhl A (2017) Multiprofessionelle Teams gefragt. Pflegefachkräfte zur Betreuung und Unterstützung in der Behindertenhilfe. Blätter der Wohlfahrtspflege, Bd. 3, S 116–117
Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz (2021) Änderungen im Einzelnen. Was ändert sich durch das BTHG? https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/aenderungen-im-einzelnen/?hlres=besondere+wohnform. Zugegriffen: 18. Dez. 2021
Weidekamp-Maicher (2018) Messung von Lebensqualität im Kontext stationärer Pflege. In: Jacobs K, Kuhlmey A, Greß S, Klauber J, Schwinger A (Hrsg) Pflege-Report 2018. Springer, Berlin Heidelberg, S 71–83 https://doi.org/10.1007/978-3-662-56822-4_8
Witzel A (2000) Das problemzentrierte Interview. Forum Qual Sozialforsch Forum Qual Soc Res 1:1–13
World Health Organization (2005) Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/. Zugegriffen: 28. Jan. 2022
World Health Organization (2020) Disability and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health. Zugegriffen: 18.2021
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Helbig, R., Latteck, ÄD. (2022). Lebensqualität im Mittelpunkt der Langzeitpflege von Menschen mit Körperbehinderungen. In: Jacobs, K., Kuhlmey, A., Greß, S., Klauber, J., Schwinger, A. (eds) Pflege-Report 2022. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65204-6_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-65204-6_7
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-65203-9
Online ISBN: 978-3-662-65204-6
eBook Packages: Medicine (German Language)