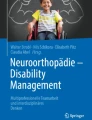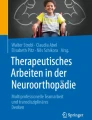Zusammenfassung
Vielfalt ist das Resultat einer sich dynamisch wandelnden Gesellschaft. Das hat auch Auswirkungen auf die pflegerische Versorgung in der Häuslichkeit, wo der Großteil der Menschen mit Pflegebedarf von Angehörigen oder Personen aus Freundeskreis und Nachbarschaft versorgt werden. Anhand von vier Bevölkerungsgruppen gibt der Beitrag einen exemplarischen Einblick in jeweils unterschiedliche Lebenslagen, -geschichten und Herausforderungen, die im Zusammenhang mit einer Pflegesituation einhergehen können. Der Artikel stellt häusliche Pflegesettings bei Menschen mit Migrationsgeschichte, bei Familien mit einem pflegebedürftigen Kind, bei Menschen aus dem Spektrum der sexuellen Vielfalt (LSBTI*) und bei pflegenden Kindern und Jugendlichen in den Focus. Die den Betrachtungen zugrundeliegende These lautet, dass zwar im Hinblick auf die Zusammensetzung der Gesellschaft Vielfalt Normalität ist, diese aber mitunter im Pflegesystem und der Pflegepraxis noch immer nicht umfassend wahrgenommen und gelebt wird. In der Folge stehen viele Bevölkerungsgruppen im Schatten der Öffentlichkeit. Aufgrund der fehlenden Wahrnehmung fehlen wichtige Unterstützungsleistungen. Die im Beitrag dargestellten jeweiligen Rahmenbedingungen sollen für die spezifischen Bedürfnisse dieser Gruppen sensibilisieren. Die dargestellten Handlungsempfehlungen sollen zum weiteren Nachdenken und zur Diskussion um eine achtsame pflegerische Versorgung von allen Menschen mit Pflegebedarf und zur besseren Unterstützung der sie primär versorgenden pflegenden Angehörigen anregen. Die stärkere Sensibilisierung von Fachkräften zu den jeweiligen Gruppen stellt dabei eine wiederkehrende Forderung dar, die auch als übergeordnete Forderung nach einer umfassenden diversitätssensiblen Ausrichtung der Pflege verstanden werden kann. Für den Beitrag wurde der Austausch mit verschiedenen Fachstellen gesucht, deren inhaltlicher Arbeitsschwerpunkt in den jeweiligen Themengebieten liegt. So soll eine praxisnahe Perspektive zum Thema vermittelt werden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Vielfalt ist das Resultat einer sich dynamisch wandelnden Gesellschaft. Das hat auch Auswirkungen auf die pflegerische Versorgung in der Häuslichkeit, wo der Großteil der Menschen mit Pflegebedarf von Angehörigen oder Personen aus Freundeskreis und Nachbarschaft versorgt werden. Anhand von vier Bevölkerungsgruppen gibt der Beitrag einen exemplarischen Einblick in jeweils unterschiedliche Lebenslagen, -geschichten und Herausforderungen, die im Zusammenhang mit einer Pflegesituation einhergehen können. Der Artikel stellt häusliche Pflegesettings bei Menschen mit Migrationsgeschichte, bei Familien mit einem pflegebedürftigen Kind, bei Menschen aus dem Spektrum der sexuellen Vielfalt (LSBTI*) und bei pflegenden Kindern und Jugendlichen in den Focus. Die den Betrachtungen zugrundeliegende These lautet, dass zwar im Hinblick auf die Zusammensetzung der Gesellschaft Vielfalt Normalität ist, diese aber mitunter im Pflegesystem und der Pflegepraxis noch immer nicht umfassend wahrgenommen und gelebt wird. In der Folge stehen viele Bevölkerungsgruppen im Schatten der Öffentlichkeit. Aufgrund der fehlenden Wahrnehmung fehlen wichtige Unterstützungsleistungen. Die im Beitrag dargestellten jeweiligen Rahmenbedingungen sollen für die spezifischen Bedürfnisse dieser Gruppen sensibilisieren. Die dargestellten Handlungsempfehlungen sollen zum weiteren Nachdenken und zur Diskussion um eine achtsame pflegerische Versorgung von allen Menschen mit Pflegebedarf und zur besseren Unterstützung der sie primär versorgenden pflegenden Angehörigen anregen. Die stärkere Sensibilisierung von Fachkräften zu den jeweiligen Gruppen stellt dabei eine wiederkehrende Forderung dar, die auch als übergeordnete Forderung nach einer umfassenden diversitätssensiblen Ausrichtung der Pflege verstanden werden kann. Für den Beitrag wurde der Austausch mit verschiedenen Fachstellen gesucht, deren inhaltlicher Arbeitsschwerpunkt in den jeweiligen Themengebieten liegt. So soll eine praxisnahe Perspektive zum Thema vermittelt werden.
Diversity is the result of a dynamically changing society. This also has an impact on the majority of people with care needs who are cared for at home by relatives, friends and neighbors. Based on four population groups, the article provides an exemplary insight into different situations, histories and challenges that can arise in connection with a care situation. The authors focus on home care settings for people with a migration history, for families with a child in need of care, for people from the sexual diversity spectrum (LGBTI*), and for children and adolescents as caregivers. They assume that although diversity is normal in terms of the make-up of society, it is still not fully recognized and practiced in the care system and care practice. As a result, many groups of the population are not perceived by the public, so that important support services are missing. The framework conditions described in this article are intended to raise awareness of the specific needs of these groups. The recommendations for action presented are intended to stimulate further reflection and discussion about mindful nursing care for all people in need of care and better support for the family caregivers. Making professionals more aware of the respective groups represents a recurring demand in this context, which can also be understood as a demand for a comprehensive diversity-sensitive orientation of care. For this article, the authors sought exchange with various specialised agencies with a focus in the respective fields in order to convey a practical perspective on the topic.
1 Einleitung
Mehr als 80 % der Pflegebedürftigen in Deutschland werden in der eigenen Häuslichkeit gepflegt.Footnote 1 Seit 2009 (69 % häusliche PflegeFootnote 2) ist dieser Pflegebereich damit stark wachsend. In den zehn Jahren zwischen 2009 und 2019 wurden kontinuierlich etwa zwei Drittel der häuslich Gepflegten ausschließlich von pflegenden Nahestehenden ohne Unterstützung durch ambulante Pflegedienste versorgt. Die häuslich pflegenden NahestehendenFootnote 3, in der Folge pflegende Angehörige genannt, sind damit die am stärksten wachsende Gruppe, die zur Sicherung pflegerischer Aufgaben in unserer Gesellschaft beiträgt. Dies macht die Relevanz der häuslichen Versorgung durch pflegende Angehörige für das deutsche Pflegesystem überdeutlich. Aber gibt es das eine Pflegesetting durch und für pflegende Angehörige, das sich durch standardisierte Maßnahmen entlasten lässt? Lassen sich die Bedarfe für die Sicherung einer bedürfnisorientierten und angemessenen häuslichen Versorgung und die dafür nötige Unterstützung generell oder sogar pauschal beschreiben?
Dieser Beitrag richtet den Blick auf Bevölkerungsgruppen, die im Gesundheits- und Pflegesystem, somit auch im Kontext der häuslichen Pflege, bislang nur wenig Beachtung finden. Dabei ist ihre Lebens- und Pflegesituation auf unterschiedliche Art und Weise besonders. Jede dieser im Folgenden beschriebenen Gruppen ist von hoher Relevanz für das Pflegesystem in Deutschland. Jede hat aus unterschiedlichen Gründen eigene Bedürfnisse und eigene Probleme in der Sicherstellung einer angemessenen häuslichen Versorgung der ihnen anvertrauten Pflegebedürftigen.
Ziel des Beitrags ist es, einen achtsamen Blick auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft und damit in der Konsequenz auf die Vielfalt unseres Pflegesystems zu vermitteln und zu stärken. Er macht deutlich, wie wichtig eine Flexibilisierung vorhandener pflegebezogener Unterstützungsangebote zur Sicherstellung einer personenorientierten Pflegeversorgung in allen Bevölkerungsgruppen ist. Dafür müssen die im Weiteren beschriebenen Erkenntnisse konsequent auf die Sicherung dieses größten Bereichs im Pflegesystem übertragen und angewendet werden. Das gelingt in der Praxis bereits an einigen Stellen gut und kann manchmal durch Best Practice belegt werden. Dennoch gibt es nach wie vor einen großen Handlungsbedarf. Das gilt gleichermaßen für die Pflegepraxis wie die Pflegepolitik.
Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag exemplarisch auf vier Gruppen: pflegende Angehörige von jungen Menschen mit Pflegebedarf, von Menschen mit speziellen kulturellen Bedürfnissen durch Migrationsgeschichte oder Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*Footnote 4 (LSBTI*) sowie Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung. Wir werden jeweils einige Hintergründe zu den Zielgruppen skizzieren und mit Handlungsempfehlungen für die Pflegepraxis und Politik schließen. Diese Skizze der Themenfelder im Rahmen dieses Pflege-Reports dient dazu, den Blick auf diese Gruppen zu lenken, zu fokussieren und zur weiteren Auseinandersetzung anzuregen. Sie dient nicht dazu, jeden Bereich für sich genommen in der ihm gebührenden Ausführlichkeit und Tiefe zu behandeln und auszuleuchten.
Zu den jeweiligen Themenfeldern gibt es in Deutschland ausgewiesene Fachleute und Fachstellen. Mit einem Teil von ihnen konnten wir zur Entwicklung des Beitrags sehr wertvolle Diskussionen führen und auf diesem Weg, das ist zumindest unsere Hoffnung, die Perspektive der Praxis und der Zielgruppen stärken. Besonders möchten wir uns herzlich bei dem Projekt echt unersetzlich, der Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege, MenschenKind – Fachstelle für die Versorgung chronisch kranker und pflegebedürftiger Kinder und bei den Mitgliedern von wir pflegen e. V. – Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger bedanken.
2 Pflege altersübergreifend: junge Menschen mit Pflegebedarf
In Deutschland haben rund 161.000 Kinder und Jugendliche (im Alter von 0 bis 14 Jahren) einen Pflegegrad. Etwa 95 % der Kinder und Jugendlichen werden ausschließlich von ihren Angehörigen versorgt.Footnote 5 Zumeist sind die Mütter die Hauptpflegepersonen, die in der Regel noch im erwerbsfähigen Alter sind. Gerade in diesen Familien ist eine Unterstützung des Pflegesettings somit auch eine Frage der Gendergerechtigkeit. Im Pflegesystem werden diese Familien und ihre Bedarfe häufig übersehen. Dabei sind die Herausforderungen im Alltag für sie besonders vielfältig und schwierig.
Eine Studie von Bücker und Pietsch zeigt, dass sich die Pflege eines Kindes deutlich auf die Gesundheit der Mütter auswirkt. Zu den zentralen Belastungsfaktoren gehören große körperliche Anstrengungen (insbesondere bei Immobilität der Kinder), ein Hilfebedarf der Kinder „rund um die Uhr“ und auch Zukunftsängste bezogen auf die perspektivische Betreuung und Pflege des Kindes. Die Verfassenden kommen zu dem Ergebnis, „(…) dass pflegende Mütter erhebliche Einschränkungen ihrer Gesundheit und gesundheitsbezogenen Lebensqualität erfahren und zu einer Risikogruppe für gesundheitliche Beeinträchtigungen gehören“ (Büker und Pietsch 2019, S. 2).
Die Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung wir pflegen e. V. hat ein Positionspapier zu der Situation, den Bedarfen und Forderungen pflegender Eltern entwickelt.Footnote 6 Die pflegenden Eltern betonen darin, dass sich ihre Pflege- und Lebenssituation von der Pflege älterer Menschen unterscheidet und dass ihre spezifischen Leistungen in der Gesellschaft nicht ausreichend wertgeschätzt werden.Footnote 7 Ein wesentlicher Unterschied besteht für die Eltern in der fortdauernden Pflege- und Lebenssituation: Während sich die Pflege älterer Menschen auf einen bestimmten Lebensabschnitt zeitlich begrenzt, verläuft die Begleitung eines Kindes in den meisten Fällen über Jahrzehnte. Die Herausforderungen verändern sich dabei im Lebensverlauf und variieren in Abhängigkeit vom Grad der Behinderung oder der chronischen Erkrankung. Sie reichen von der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Bildungseinrichtungen, der Vereinbarkeit von Pflege und Bildung bzw. Beruf der pflegenden Angehörigen (s. auch pflegende Kinder und Jugendliche), der Suche nach bedarfsgerechten Wohnformen für die gesamte Familie oder im Weiteren auch den pflegebedürftigen jungen Erwachsenen über bedarfsgerechte Entlastungsleistungen wie beispielsweise Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit pädagogischer Kompetenz bis hin zur bedarfsgerechten Hospizversorgung.
Zusätzlich kritisieren viele pflegende Eltern den hohen bürokratischen Aufwand im Pflegealltag (z. B. die wiederkehrende Beantragungspflicht von Leistungen, obwohl eine chronische Erkrankung mit fortlaufendem Hilfebedarf besteht) und auch Konflikte mit Behörden und Pflegekassen (z. B. bei der Beantragung eines Pflegegrades oder der Höherstufung und bei der Genehmigung von Hilfsmitteln).
Häufig besteht eine Nachweispflicht pflegender Eltern gegenüber den Kostenträgern zur Bewilligung von Spezialhilfsmitteln, ohne dass es niedrigschwellige Anlaufstellen gibt, um diese Nachweise zu erbringen. So entsteht ein Tauziehen um für die Sicherstellung der Pflege notwendige Hilfsmittel, die nicht selten erst nach mehrfachen Widerspruchsverfahren bewilligt werden. Eine Beweislastumkehr wäre hier eine sinnvolle Maßnahme zur bürokratischen Entlastung der Familien. Erschwerend kommt für die Familien (und oft auch die Kostenträger selber) die Vielfalt der gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese Gruppe von Pflegebedürftigen hinzu.
Pflegebedürftige Kinder sind in vielen Fällen behindert und haben damit über ihre Ansprüche aus dem Pflegeversicherungsgesetz SGB XI hinaus weitere Rechtsansprüche, die sich aus dem SGB IX, dem Gesetz zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung ergeben. Bereits hier gibt es Überschneidungen, die es den Familien erschweren, ein angemessenes, individuelles Pflegesetting zu organisieren, bei dem klar ersichtlich ist, welcher Kostenträger für welche Leistung einsteht.
Diese Schnittstellenproblematik wird dadurch potenziert, dass sich im Falle einer möglicherweise erforderlichen medizinischen Versorgung weitere Leistungsansprüche aus dem SGB V, der gesetzlichen Krankenversicherung, ergeben können. Auch hier gibt es Schnittmengen zum SGB XI und SGB IX, zum Beispiel im Bereich der Hilfsmittelversorgung.
Sind die erforderlichen Pflegeleistungen durch Dritte (zum Beispiel externe Pflege- oder Betreuungsdienstleister) in einer Höhe erforderlich, die über die Pflegesachleistung hinausgeht, und/oder ist das Familieneinkommen z. B. aufgrund der zu Gunsten der häuslichen Pflege reduzierten Erwerbsarbeit so gering, dass es für die Haushaltsführung nicht ausreichend ist, bestehen weitere Ansprüche nach dem SGB XII, dem Sozialhilferecht. Diese wiederum müssen zunächst mit den Ansprüchen aus dem SGB IX und SGB XI abgeglichen werden.
Um den erforderlichen bürokratischen Aufwand für diese Familien noch deutlicher zu machen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich für die pflegebedürftigen (minderjährigen) Kinder weitere Ansprüche aus dem Gesetz für die Kinder- und Jugendhilfe, dem SGB VIII, ergeben. Hier geht es unter anderem um das Recht und die Verpflichtung zur schulischen Bildung und die dafür notwendigen Rechtsansprüche.
Ein Beispiel aus der Praxis: Meist ist den Familien unklar, wer letztlich die Verantwortung dafür hat, eine evtl. notwendige behandlungspflegerische Maßnahme wie eine Injektion oder eine Einmalkatheterisierung während der Zeit sicherzustellen, in der das Kind in der Schule weilt. Ist dies die Aufgabe der Schule, um dem Kind die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, oder trägt für die Sicherstellung der notwendigen medizinischen Behandlung die Krankenkasse die Verantwortung?
Die Rechtsansprüche, die sich aus dem SGB VIII ergeben, fallen allerdings im Regelfall mit dem Erreichen der Volljährigkeit weg, was für die Familien nicht selten ein völlig neues Pflege- und Betreuungssetting erfordert.
Um diesen kaum zu durchdringenden Gesetzesdschungel zu beherrschen, fehlt es in der Regel an niedrigschwelligen Anlauf- und Beratungsstellen für die Familien mit pflegebedürftigen jungen Familienmitgliedern. Gefragt ist hier ein echtes Case- und Care-Management, also Berater*innen mit einer breiten Fachexpertise im Sozialversicherungsrecht, um die schwer belasteten Familien vom Bürokratismus zu entlasten. Good-Practice-Beispiele sind einzelne spezialisierte (durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte) Angebote der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“Footnote 8 (EUTB), wie die Beratungsstelle NESSt des KinderpflegenetzwerksFootnote 9 oder die Kinderbeauftragten der Berliner Pflegestützpunkte in der Trägerschaft der AOK Nordost.
Insgesamt werden Kinder und Jugendliche mit Pflegebedarf und ihre Eltern beim Ausbau und bei der Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und Leistungsansprüchen nicht ausreichend berücksichtigt. Viele pflegende Eltern verweisen zum Beispiel auf einen hohen Bedarf an spezialisierter Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege, um wenigstens teilweise berufstätig sein zu können. Da es fast keine alters- und zielgruppengerechten sowie wohnortnahen Angebote gibt, können die vorhandenen Leistungsansprüche der Pflegeversicherung häufig nicht genutzt werden.
Die mangelnde Wahrnehmung der Zielgruppen spiegelt sich auch in der bereits skizzierten Problematik wider, dass die pflegerische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen oft auf individuellen (Not-)Lösungen basiert. Nicht selten übernehmen die Eltern oder das Kita- bzw. Schulpersonal die Versorgung und sind damit häufig überfordert. Besonders schwierig ist die Situation für Kinder, die während des Schulbesuchs eine Behandlungspflege benötigen, die nur von Pflegefachkräften oder den Eltern durchgeführt werden darf. Auch hier ist der Fachkräftemangel in der Pflege eine Ursache dafür, dass pflegende Eltern ihre Berufstätigkeit oft aufgeben oder stark einschränken müssen. Schul- oder Gemeindekrankenschwestern gibt es kaum noch. Für externe Dienstleister wie ambulante Pflegedienste ist der Aufwand der Versorgung in einer Bildungseinrichtung aufgrund strenger zeitlicher Vorgaben (Pausen) und des hohen logistischen Aufwands im Zusammenhang mit der Pflegetätigkeit in einer Bildungseinrichtung wirtschaftlich unattraktiv.
Die Herausforderungen für Familien mit pflegbedürftigen Kindern sind erheblich und die Liste notwendiger Anpassungen im Unterstützungssystem für diese Pflegesettings ist lang. Wir geben hier Handlungsempfehlungen wieder, die sich z. B. auch im Positionspapier der Interessenvertretung wir pflegen e. V. wiederfinden:
Handlungsempfehlungen
Die Einrichtungen der Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege müssen auch für die Zielgruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Pflegebedarf ausgebaut werden, nicht zuletzt zur besseren Unterstützung von alleinerziehenden Eltern. Des Weiteren sollte die Antragstellung für die Heil- und Hilfsmittelversorgung mit Unterstützung durch quartiersnahe Clearingstellen entbürokratisiert werden, damit kurzfristige und unbürokratische Entscheidungen getroffen werden können und eine bedarfsgerechte Versorgung gewährleistet ist. Dahingehend benötigt die Zielgruppe auch auf Quartiersebene verfügbare Case- und Care-Managementstellen. Berufstätige pflegende Eltern benötigen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice und einen besseren Kündigungsschutz. Für alle pflegenden Angehörigen sollte über die Einführung eines „Care-Gehalts“ (Lohnersatz) die finanzielle Absicherung verbessert werden.
3 Pflege interkulturell: Menschen mit Migrationsgeschichte und Pflegebedarf
Leonid, ein Migrant aus dem Donbas, der sich ehrenamtlich u. a. als Demenzlotse in Berlin für seine Community engagiert, sagte kürzlich auf einem Fachtag: „Die Deutschen haben im Grunde die gleichen Probleme. Nur bei Menschen mit Migrationsgeschichte fallen sie viel akuter aus.“ (Lange 2022)
Der Ehrenamtliche spricht aus eigener Erfahrung. Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland sind weder eine homogene Gruppe noch lassen sich bestimmte Pflegebedarfe speziell und in Gänze lediglich Menschen mit Pflegebedarf und ihren Angehörigen mit Migrationsgeschichte zuordnen. Doch die Hürden, die Angehörige mit Migrationsgeschichte zu nehmen haben, um Leistungsansprüche der Pflegeversicherung zu nutzen, Selbsthilfeangebote anzunehmen, selbstbestimmt und achtsam mit sich selbst in der Pflegesituation umzugehen, sind oft höher als für Einheimische. Dabei ist die Vielfältigkeit der Sprachen nur ein Teil der Barrieren. Vielmehr gibt es eine erhebliche Diversität in der Sichtweise auf und den Umgang mit Erkrankung oder Behinderung in den einzelnen Kulturen. Deshalb ist eine reine Sprachmittlung zur Erschließung des Pflegesystems für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige mit Migrationsgeschichte nur ein Teil der Lösung und eine Kulturmittlung, die die Sozialisierung und die konkrete Lebenswelt der Betroffenen berücksichtigt, zwingend erforderlich.
Deutschland ist ein Einwanderungsland mit einer pluralen Gesellschaftsstruktur. Den Grundstein dafür legte das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei aus dem Jahre 1961. 2020 registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 21,9 Mio. Menschen in deutschen Privathaushalten, „die selbst oder bei denen mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht seit Geburt besitzt“. Damit stellen Menschen mit Migrationshintergrund inzwischen 26,7 % der Bevölkerung (BAMF 2021).Footnote 10 1,4 Mio. von ihnen sind über 65 Jahre alt. Bis zum Jahr 2030 wird sich diese Zahl verdoppeln. Ältere Menschen mit Migrationshintergrund gehören damit zu einer der am stärksten wachsenden Bevölkerungsgruppen.Footnote 11
Dennoch gibt es kaum zuverlässige bundesweite statistische Daten zur Pflegebedürftigkeit unter migrantischen Communities. Einzelne Studien geben zumindest Einblicke.
Die Menschen aus den ersten Einwanderungswellen sind in höherem und in stärkerem Maße als die deutschstämmige Bevölkerung von Pflegebedürftigkeit betroffen. Das Durchschnittsalter von Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund beträgt 62,1 Jahre, in der restlichen Bevölkerung liegt das Durchschnittsalter bei 72,2 Jahren. Der durchschnittlich ermittelte Pflegegrad liegt bei Ersteren ebenfalls signifikant höher (Tezcan-Güntekin 2018). Zu den Ursachen gehören die schwereren Arbeits- und Lebensbedingungen, niedrigere Einkommen, weniger Gesundheitsvorsorge, höhere Altersarmut, schlechter ausgestattete Wohnungen und nicht zuletzt Diskriminierungserfahrungen. Während deutschlandweit ca. 80 % der Pflegeleistungen zu Hause von Angehörigen erbracht werden, liegt zum Beispiel der Anteil in der türkischen Community bei 98 % (Tezcan-Güntekin 2021). Es sind also unterschiedliche Diversitätsmerkmale zu betrachten und zu verknüpfen, von denen die kulturelle Identität nur ein Merkmal ist, um die individuellen Bedürfnisse Pflegebedürftiger mit Migrationsgeschichte und ihrer Angehörigen zu erfassen. Eine Reduktion des Kulturbegriffs auf Herkunft, Sprache und Religion greift somit zu kurz.
Pflegende Angehörige mit Migrationsgeschichte geraten nicht selten in Rollenkonflikte mit der „eigenen“ Kultur und sind im Vergleich mit pflegenden Angehörigen ohne Migrationsgeschichte stärker psychisch belastet (Wolter und Stellmacher 2019; Klaus und Baykara-Krumme 2017; Tezcan-Güntekin und Razum 2015; Kücük 2010).
Die Gründe für die häufige Nichtinanspruchnahme von Pflegesettings durch diese keinesfalls homogenen Personengruppen sind vielfältig. Sie reichen von ungenügender Kenntnis der eigenen Leistungsansprüche aus der Pflegeversicherung über z. T. fehlendes Verständnis für das deutsche Pflegesystem und Unzufriedenheit mit der professionellen Pflege bis zu auf sprachliche Barrieren und Diskriminierungserfahrungen zurückzuführende Hemmungen und Misstrauen, Pflegeberatungs- und Selbsthilfeangebote überhaupt anzunehmen. Kulturell und religiös bedingte Tabus sowie Schamgefühle, Pflegebedarf und bestimmte Krankheitsbilder wie Demenz anzuerkennen können die Barrieren weiter erhöhen. Die Pflegebegutachtung durch den Medizinischen Dienst ist zum Teil angstbesetzt wie auch eventuelle Kostenfallen, die die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen mit sich bringen könnten. Bürokratische Hürden scheinen für viele unüberwindbar. Fallstudien verweisen schließlich auf den hohen Grad an körperlicher und psychosozialer Belastung für meist weibliche Pflegende und zunehmende Fremdbestimmung. Sie leiden vielfach unter Erschöpfungszuständen, Ratlosigkeit, Schuldgefühlen und mangelnden Zeitreserven (Wolter und Stellmacher 2019; Klaus und Baykara-Krumme 2017).
Andererseits fehlt auch bei Beratungsstellen, Leistungs- und Kostenträgern oft noch ein grundlegendes Verständnis für die Biographien, Lebenswelten und Bedarfe von Menschen mit Migrationsgeschichte, woraus Sprach- und Hilflosigkeit seitens der professionell Pflegenden resultieren können (Sahin und Tezcan-Güntekin 2020).
Handlungsempfehlungen
Wir empfehlen deshalb die interkulturelle Öffnung der Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und weiterer unterstützender Angebote als bewusst gestalteten Prozess. Dies umfasst unter anderem, die kulturelle Vielfalt und Expertise über das Personal selbst abzubilden und dieses einzubinden. Darüber hinaus sollten fortlaufende diversitätssensible Schulungen als Qualitätsstandard für alle Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen von Beratungs- und Selbsthilfestellen sowie professionellen Pflegeangeboten eingeführt werden. Auch für medizinisches Personal sind solche Schulungen anzustreben.
Wir empfehlen weiterhin den Abbau von Barrieren beim Zugang zum Pflegesystem. Besonders wichtig sind die Bereitstellung professioneller kultursensibler Sprachmittlungsangebote wie beispielsweise der Interkulturellen BrückenbauerInnen in der PflegeFootnote 12, zielgruppenorientierte, niedrigschwellige und mehrsprachige Information sowie die Entwicklung und Unterstützung aufsuchender Formen (Geh-Struktur) zur Vermittlung konkreter Kompetenzen im Pflegealltag und zur psychosozialen Entlastung in den Familien und in Migrantenselbstorganisationen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte die Förderung intersektionaler Zusammenarbeit und multiprofessioneller Netzwerkarbeit bei aktiver Teilhabe der Betroffenen erfahren, um nachhaltige Lösungen zu finden. Darüber hinaus ist es wichtig, weitere quantitative und qualitative Erhebungen sowie interdisziplinäre Forschungsprojekte zur Situation familiärer Pflege in Familien mit Migrationsgeschichte zu initiieren, um Bedürfnisse sicher zu erfassen, Versorgungslücken zu identifizieren und die richtigen Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungslandschaft ziehen zu können. Nicht zuletzt braucht Best-Practice-Expertise mehr Multiplikation.
4 Pflege in Vielfalt: LSBTI* mit Pflegebedarf
Rund 10 % der Bevölkerung identifizieren sich als LSBTI*. Dennoch sind sie in der Pflege eine oft übersehene Gruppe. Das Akronym LSBTI* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*Footnote 13 und somit für geschlechtliche, sexuelle Vielfalt und Körperlichkeit. Dieser Vielfalt steht auch in der Pflege eine Heteronormativität gegenüber, also die ausschließliche oder primäre Fokussierung auf eine binäre Geschlechterteilung (Mann/Frau) und Heterosexualität (Schwulenberatung Berlin 2020; Andreé 2021).
Die LSBTI*-Community konnte in den letzten Jahrzehnten wichtige Erfolge beim Abbau von Diskriminierungen erzielen, wie die Streichung des § 175 StGB, der in bestimmten Fällen noch bis 1994 homosexuelle Handlungen unter Männern und Frauen unter Strafe stellte. Ein Schritt in Richtung mehr Diversität in der Gesellschaft ist auch das 2021 eingeführte Recht auf körperliche Unversehrtheit für intergeschlechtlich geborene Kinder.Footnote 14 Für viele Inter*Aktivist*innen ist jedoch auch mit dem Gesetz die medizinische Pathologisierung von Inter*-Menschen, und damit die Grundsatzfrage der körperlichen Unversehrtheit, nicht gelöst.Footnote 15 Auch weitere LSBTI*-Gruppen empfinden bestehende Regelungen als diskriminierend, wie zum Beispiel die Hämotherapierichtlinie, die bei der Blutspende schwule und bisexuelle Männer im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen ungleich behandelt.Footnote 16
Diskriminierung macht somit vor dem Gesundheits- und Pflegesystem nicht halt. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt für Berlin, dass 70 % der LSBTI* Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen gemacht haben. Diese zeigen sich auch in vermeintlich unscheinbaren Verhaltensweisen: Die Lebenssituation von LSBTI* wird nicht ernst genommen oder belächelt oder es fehlt an Wissen über geschlechtliche und sexuelle Identität, weswegen auch die Behandlung und Versorgung oft den Bedarfen der Patient*innen und Pflegebedürftigen nicht entspricht. Rund ein Viertel der in der Studie Befragten verweist auf das Erleben von psychischer Gewalt und 8 % auf Zwangsbehandlungen, physische und sexualisierte Gewalt. Trans*- und nicht-binäre Menschen sind dabei unter den LSBTI*-Gruppen häufiger Opfer von Diskriminierungen (Schwulenberatung Berlin 2019).Footnote 17
Zur Situation und den Bedarfen von LSBTI* in der Langzeitpflege existieren bislang nur wenige Studien. Praxisberichte und -erfahrungen zeigen jedoch, dass LSBTI* gerade im Alter und bei Pflegebedarf Angst vor erneuten Diskriminierungen und vor Fremdbestimmung haben. Zum Teil werden sogar Leistungsansprüche aus der Pflegeversicherung (wie Pflegesachleistungen, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege) trotz Pflege- und Unterstützungsbedarf nicht genutzt.
Nicht nur im Hinblick auf die häusliche Versorgung ist von Bedeutung, dass das soziale Netzwerk von LSBTI*-Senior*innen häufig anders aufgebaut ist, was wiederum Auswirkungen auf die Unterstützung im Alter hat. Während heterosexuelle Menschen mit Pflegebedarf zumeist über Familienangehörige versorgt und begleitet werden, werden LSBTI* primär von Freund*innen bzw. von der „Wahlfamilie“ unterstützt. Denn viele LSBTI* sind kinderlos und alleinlebend. Nicht wenige haben aufgrund ihres Coming-outs negative Erfahrungen mit der biologischen Familie machen müssen. Wenn es gelingen soll, wahlfamiliale Beziehungen in die Pflege und Betreuung einzubinden, muss die „Angehörigenarbeit“ entsprechend gestaltet und der Kontakt zum Beispiel zu schwulen oder lesbischen Lebenswelten und Netzwerken aufrechterhalten werden (Lottmann 2018). Dies ist eine wesentliche Bedingung für Vielfalt und Selbstbestimmung im Alter und betrifft alle pflegerischen Versorgungsbereiche.
Das Thema LSBTI* wird in vielen Diensten und Einrichtungen der Pflege noch nicht ausreichend wahrgenommen und im Kontext einer diversitätssensiblen Pflege reflektiert. Somit fehlt häufig ein grundlegendes Verständnis und Bewusstsein für die Biographien, Lebenswelten und Bedarfe von LSBTI*. Dahingehend hat in Berlin die „Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege“ wichtige Handlungsansätze und -empfehlungen für die Praxis entwickelt und bietet mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ein Qualifizierungsprogramm u. a. für Krankenhäuser, Pflegedienste und -einrichtungen an.
Handlungsempfehlungen
In allen Bundesländern sollten koordinierende und impulsgebende Fachstellen zum Themenkomplex LSBTI*, Altern und Pflege aufgebaut werden. Hier sollte die Sensibilisierung von Fachkräften in den Diensten, Einrichtungen und Beratungsstellen der Pflege ein Arbeitsschwerpunkt sein. Eine wichtige Maßnahme wären flächendeckend verfügbare Schulungsangebote zu LSBTI* und diversitätssensibler Pflege.
Sensibilisierungsprogramme müssen sich auch auf die Einrichtungen und Dienste in Gänze beziehen, wie zum Beispiel beim Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“. Eine obligatorische Maßnahme ist die Einführung eines Diversity- und Antidiskriminierungsmanagements, um das subjektive Sicherheitsempfinden der Nutzer*innen der Angebote zu erhöhen und den Begriff der Willkommenskultur mit Leben zu füllen.
5 Pflege in jungen Jahren: Young Carers
In Deutschland pflegen rund 480.000 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 19 Jahren einen Angehörigen (Metzing 2018; siehe auch Chap. 12 in diesem Band). In dieser Altersgruppe entspricht dies 6,1 % aller Jugendlichen und durchschnittlich ein bis zwei Schüler*innen pro Schulklasse.Footnote 18
In einer Umfrage unter 649 Schüler*innen in Berlin lebte im Jahr 2017 ein Drittel mit einem chronisch erkrankten oder behinderten Familienmitglied im näheren sozialen Umfeld.Footnote 19 Auch in dieser Stichprobe konnten 6,8 % Young Carers identifiziert werden. Die Young Carers trugen in ihren Familien die wesentliche Verantwortung für die Sicherstellung der Versorgung eines Angehörigen. Dabei übernahmen Mädchen diese Aufgabe etwas häufiger als Jungen. Laut der Berliner Studie lebten zudem viele Young Carers nur mit einem Elternteil zusammen und ihre Familien verfügten insgesamt über ein eher niedriges Haushaltseinkommen.Footnote 20
Im Vergleich zu Gleichaltrigen sind Young Carers deutlich höher belastet. Durch die zusätzlichen Aufgaben, die sie übernehmen, sind sie oft zusätzlichem Stress ausgesetzt. Das betrifft insbesondere die Bereiche körperliche und psychische Gesundheit, Bildungschancen und Sozialleben. Die Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit werden von den betroffenen Kindern und Jugendlichen am stärksten empfunden und negativ beurteilt. Die Angst, offen über ihre Situation zu sprechen, verstärkt das Problem zusätzlich (Nagl-Cupal et al. 2015).
Viele Familienangehörige mit Unterstützungsbedarf nehmen ihre Kinder nicht als „pflegende Angehörige“ oder „Betreuungsperson“ wahr. Auch die meisten Kinder und Jugendlichen bezeichnen sich selbst nicht als „Young Carer“ oder „pflegende Angehörige“ und identifizieren sich nicht mit dieser Rolle.
Gleichwohl übernehmen pflegende Jugendliche und Kinder diese Pflegeversorgung oft gerne, da sie aus ihr Bestätigung und Anerkennung von den von Pflegebedürftigkeit Betroffenen und deren Umfeld ziehen können. Und sie lernen eine Form sozialer Kompetenz, die Gleichaltrige in der Regel nicht mitbringen. Dadurch entsteht nicht selten eine Art symbiotischer Pflegebeziehung, und die mit der Pflege verbundene Belastung sowie der Verzicht auf eine altersentsprechende Entwicklung mit Schule, Freizeit und Freund*innen werden von den Jugendlichen nur punktuell wahrgenommen.
Dennoch öffnen sich gerade pflegende Minderjährige nicht ihrem weiteren Umfeld, zum Beispiel in der Schule, da sie hier häufig auf Unverständnis stoßen. Sorgeverantwortliche, wie Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen oder auch Pflegekräfte, halten die Pflegebelastung – nicht zu Unrecht – oft in dem Alter für unangemessen und artikulieren dies auch gegenüber den jungen Menschen, wenn sie davon erfahren. Hieraus entstehen bei den Young Carers Ängste, dass evtl. eingeschaltete Ordnungsbehörden wie etwa das Jugendamt für eine Trennung der Pflegebeziehung oder sogar des Familiengefüges sorgen könnten. Dabei hat die Aufrechterhaltung des Familiengefüges für Young Carers die oberste Priorität.
Nicht zuletzt dadurch bleiben ihre Probleme und Herausforderungen auch in der Gesellschaft und Öffentlichkeit meist im Verborgenen. Sie führen ein „Schattendasein“. Somit sind auch viele Fachkräfte, wie Pfleger*innen, Hausärzt*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, über Young Carers kaum informiert oder gar geschult.
Wenn eine Person in der Familie chronisch erkrankt, richtet sich zudem ein Großteil der Aufmerksamkeit innerhalb des familiären Gefüges auf das kranke Familienmitglied und lässt in der Folge andere Familienmitglieder in den Hintergrund treten. In vielen Fällen werden die Auswirkungen, die das auf die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern hat, und die neue Verantwortung für die Pflege als selbstverständlich wahrgenommen und nicht innerhalb der Familie diskutiert.
Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen erforderlich, die dabei helfen, das Risiko von Belastung, Überforderung und Verzicht auf eine kind- bzw. jugendgerechte Entwicklung zu begrenzen und andere negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Young Carers zu reduzieren.
Handlungsempfehlungen
Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie Plakataktionen und Social-Media-Marketing sollte die Wahrnehmung von Young Carers gesteigert werden. Dies muss mit einem parallelen Auf- und Ausbau von Angeboten der Beratung, Selbsthilfe und Freizeitangeboten für die Zielgruppe verbunden werden (z. B. spezifische Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, die Austauschtreffen in einem sicheren Rahmen ermöglichen). Dahingehend braucht es auch mehr Angebote für die betroffenen Familien, die in einem ganzheitlichen Ansatz zur familieninternen Kommunikation und Zusammenarbeit anregen (z. B. Familiengespräche oder Familienworkshops).
Wie bei den Zielgruppen in den vorherigen Abschnitten sollten die Beschäftigten im Pflege- und Bildungsbereich auch zur Situation von Young Carers mittels Informationsmaterialien und Schulungsangeboten sensibilisiert werden.
6 Fazit
Der hier skizzierte Blick auf die vier genannten Gruppen und deren Lebenswelten zeigt, dass diversitätssensible Pflege kein Modethema ist, sondern zwingend ein Qualitätskriterium für eine bedarfsgerechte, selbstbestimmte und teilhabeorientierte pflegerische Versorgung.
Dabei darf der Blick auf spezielle Merkmale und Eigenschaften von Menschen in der Pflege die Wahrnehmung nicht verzerren und allgemeingültige Merkmale und Eigenschaften verdecken. Eine gewisse Fokussierung auf spezielle Merkmale kann jedoch unter anderem gesellschaftspolitisch hilfreich sein: In den Diskussionen mit den Fachleuten und Fachstellen ist sehr deutlich geworden, dass es mehr Aufmerksamkeit für jede der genannten Gruppen braucht. Dies lässt sich nur mit einer entsprechenden Sensibilisierung der Öffentlichkeit und nicht zuletzt der Fachkräfte in allen Versorgungsbereichen der Pflege erreichen.
Die acht Artikel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen tragen das Verständnis einer diversitätssensiblen Pflege im Kern mit sich. Bereits zu Anfang der Präambel wird diese Haltung betont:
„Jeder Mensch hat uneingeschränkten Anspruch darauf, dass seine Würde und Einzigartigkeit respektiert werden. Menschen, die Hilfe und Pflege benötigen, haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen. Sie dürfen in ihrer besonderen Lebenssituation in keiner Weise benachteiligt werden.“ (BMFSFJ 2020)Footnote 21
Diese Leitlinie sollte in Gesellschaft und Politik sowie in der konkreten Pflegepraxis beherzigt werden. Zur besseren Unterstützung braucht es mehr wissenschaftliche Auseinandersetzung und Forschung zu den genannten Zielgruppen. So existieren zwar gute, aber nur wenige wissenschaftliche Studien, die zu einem tieferen fachlichen Verständnis hinleiten. Dabei wäre es wichtig, die spezifischen Versorgungsbedarfe im Kontext der einzelnen pflegerischen Versorgungsbereiche zu betrachten und die dortigen Rahmenbedingungen in die Analyse einzubinden.
Nicht zuletzt müssen in all diesen Prozessen die Menschen mit Pflegebedarf und ihre pflegenden Angehörigen und „Wahlfamilien“ in wichtige Entscheidungen auf Augenhöhe eingebunden werden und mitbestimmen können. Denn sie sind die fundiertesten Expert*innen für ihre Lebens- und Pflegesituation. Dies ist eine zentrale Form der Wertschätzung und Anerkennung von pflegenden Angehörigen und der Menschen mit Pflegebedarf.
Nähere Informationen zu den genannten Fachstellen und Projekten
Echt unersetzlich (Ein Projekt von Pflege in Not): https://www.echt-unersetzlich.de/
Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege: https://schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/fachstelle-lsbti-altern-und-pflege/
MenschenKind – Fachstelle für die Versorgung chronisch kranker und pflegebedürftiger Kinder: https://humanistisch.de/menschenkind
Notes
- 1.
Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung; Deutschlandergebnisse – Pflegestatistik 2019, Statistisches Bundesamt (Destatis) 2020, erschienen 15.12.2020.
- 2.
Pflegestatistik 2009 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung; Deutschlandergebnisse Statistisches Bundesamt (Destatis) 2011, erschienen Februar 2011.
- 3.
Unter häuslich pflegenden Nahestehenden verstehen die Verfassenden familiäre Angehörige und vergleichbar nahestehende Personen wie Freund*innen (sog. Wahlfamilie), die Pflegeaufgaben in der Häuslichkeit erbringen.
- 4.
Das * steht für die Vielfältigkeit im Bereich der Trans- und Inter-Personen und wird teilweise auch durch das Kürzel Q für „Queer“ ergänzt.
- 5.
Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamts. www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=ergebnistabelleUmfang&levelindex=1&levelid=1641372333906&downloadname=22421-0001#abreadcrumb. Zugegriffen: 14. Januar 2022.
- 6.
Das Positionspapier wurde den Autor*innen bereits vor der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Daher kann an dieser Stelle noch keine genaue Quelle angeführt werden. Das Positionspapier können Interessierte ab März 2022 auf der Webseite des Vereins finden (www.wir-pflegen.net).
- 7.
Eine Grundlage des Papiers ist eine Umfrage, an der sich über 80 Familien mit einem pflegebedürftigen Kind beteiligt haben.
- 8.
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabeberatungsverordnung.html, Zugriff am 20. Januar 2022.
- 9.
http://www.kinderpflegenetzwerk.de/de/angebote/Beratung.php, Zugriff am 20. Januar 2022.
- 10.
Erhoben wird der sogenannte Migrationshintergrund, der sowohl Ausländer als auch zum Teil Deutsche einbezieht, jedoch gelebtes Leben weitgehend ausspart. Bezogen auf die hier dargestellte Gruppe halten wir den Begriff der Migrationsgeschichte, der Lebensrealitäten einbezieht, für treffender. Die Begriffe sind also nicht deckungsgleich. Verwertbare statistische Daten auf Bundesebene zu Menschen mit Migrationsgeschichte liegen nicht vor.
- 11.
https://www.diakonie-kennenlernen.de/projekt/interkulturelle-brueckenbauerinnen-in-der-pflege/ Zugegriffen: 20. Januar 2022.
- 12.
https://www.diakonie-stadtmitte.de/senioren-pflege/interkulturelle-brueckenbauerinnen-in-der-pflege-ibip/ueber-das-projekt. Zugegriffen: 20. Januar 2022.
- 13.
Das * steht für die Vielfältigkeit im Bereich der Trans- und Inter-Personen und wird teilweise auch durch das Kürzel Q für „Queer“ ergänzt.
- 14.
Deutscher Bundestag (2021) Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Drucksache 19/24686.
- 15.
Zum Beispiel: https://taz.de/Aktivist_innen-ueber-Intergeschlechtlichkeit/!5809299/. Zugegriffen: 14. Januar 2022.
- 16.
Siehe: www.aidshilfe.de/diskriminierung-schwulen-bisexuellen-maennern-blutspende. Zugegriffen: 04. Januar 2021.
- 17.
Für nähere Informationen zur Situation von Trans*-Senior*innen in Berlin sei auf eine sehr gelungene Studie von Max Nicolai Appenroth verwiesen: Trans* Senior*innen in Berlin – Wo stehen wir heute und wo soll es hingehen? Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege (2021).
- 18.
Die Bezeichnung Young Carers ist ein Synonym für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Pflegeverantwortung und Sorgearbeit für einen nahen Angehörigen (häufig ein Elternteil) leisten. „Young Carers“ wird im Hilfesystem auch gerne für eine zielgruppengerechte Ansprache verwendet.
- 19.
Die Erhebung wurde von der Fachstelle für pflegende Angehörige im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin durchgeführt.
- 20.
Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse kann auf der Webseite der Fachstelle für pflegende Angehörige eingesehen werden: www.angehoerigenpflege.berlin.
- 21.
Vgl. Pflege-Charta: www.wege-zur-pflege.de/pflege-charta/praeambel. Zugegriffen: 14. Januar 2022.
Literatur
Andreé L (2021) Die neue Zielgruppe der LSBTIQ. CAREkonkret 15:2
BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020) Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin
Büker C, Pietsch S (2019) Abschlussbericht des Forschungsprojekts Gesundheitsbezogene Lebensqualität von Müttern mit einem pflegebedürftigen Kind (GesuLeM). Berichte aus Forschung und Lehre Nr. 46. Bielefeld. Copyright: Prof. Dr. Christa Büker, Severin Pietsch, M.A.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021) Migrationsbericht 2020. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2020.html?nn=1018856. Zugegriffen: 14. Jan. 2022
Klaus D, Baykara-Krumme H (2017) Die Lebenssituation von Personen in der zweiten Lebenshälfte mit und ohne Migrationshintergrund. In: Mahne K, Tesch-Römer C, Wolff JK, Simonson J (Hrsg) Altern im Wandel: Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS). Springer VS, Wiesbaden, S 359–379
Kücük F (2010) Die Situation pflegender Familienangehöriger von an Demenz erkrankten türkischen MigrantInnen in Berlin. Eine qualitative Studie zur Versorgung im häuslichen Umfeld. PflWiss 6:334–341
Lange K (2022) Fachaustausch zu interkulturellen Schulungen für pflegende Angehörige. Wenn Menschen vierfach fremd sind. In: Regionale ArbeitsGemeinschaft Alten- und Angehörigenberatung (Hrsg) Angebote für pflegende Angehörige 2022. Regionale ArbeitsGemeinschaft Alten- und Angehörigenberatung, Berlin, S 106–107
Lottmann R (2018) LSBT*I-Senior_innen in der Pflege: Zu Relevanz und Besonderheiten sozialer Netzwerke und der Arbeit mit Angehörigen. Pflege Ges 03:228–245
Metzing S (2018) Abschlussbericht zum Projekt „Die Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige“. Universität Witten/Herdecke, Witten
Nagl-Cupal M, Daniel M, Kainbacher M, Koller M, Mayer H (2015) Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige. Einsicht in die Situation gegenwärtiger und ehemaliger Kinder in Österreich. In: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Österreich (Hrsg) Sozialpolitische Studienreihe: Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Österreich, Wien
Sahin F, Tezcan-Güntekin H (2020) Diversitätssensible Altenhilfe. Eine Orientierungshilfe für die ambulante pflegerische Versorgung einer vielfältigen Gesellschaft, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, LV Baden-Württemberg e V, Stuttgart. https://paritaet-bw.de/node/13227#no-back. Zugegriffen: 14. Febr. 2022
Schwulenberatung Berlin (2019) „Wo werde ich eigentlich nicht diskriminiert?“ Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter* und Queers* (LSBTIQ*) im Gesundheitswesen in Berlin. Schwulenberatung, Berlin (Studie zur Erfassung von Diskriminierungserfahrungen von LSBTIQ* im Berliner Gesundheitssystem)
Schwulenberatung Berlin (2020) Weil ich so bin, wie ich bin – Vielfalt in der Pflege, Ein Praxis-Leitfaden für stationäre und ambulante Dienste. Schwulenberatung, Berlin. Printversion erhältlich über die Schwulenberatung Berlin gGmbH oder unter: https://schwulenberatungberlin.de/wp-content/uploads/2021/05/5f58ce231ff7fca7045dce38_SchwuBe_Leitfaden_Online.pdf
Statistisches Bundesamt (2011) Pflegestatistik 2009 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse. Destatis, Wiesbaden
Statistisches Bundesamt (2020) Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse – Pflegestatistik 2019. Destatis, Wiesbaden
Tezcan-Güntekin H (2018) Stärkung von Selbstmanagement-Kompetenzen pflegender Angehöriger türkeistämmiger Menschen mit Demenz. Dissertation, Univ. Bielefeld. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2932147/2932148/Dissertation. Zugegriffen: 14. Jan. 2022
Tezcan-Güntekin H (2021) Wie kann interkulturelle Öffnung von Demenz-Schulungsangeboten in Berlin gelingen? PPP auf dem Online-Fachaustausch „Kultursensible Demenz- und Palliative Care-Schulungen“. f.schumann@diakonie-stadtmitte.de (Erstellt: 1. Dez. 2021)
Tezcan-Güntekin H, Razum O (2015) Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund: Spezifische Bedürfnisse erkennen. https://www.aerzteblatt.de/archiv/172279/Pflege-von-Menschen-mit-Migrationshintergrund-Spezifische-Beduerfnisse-erkennen. Zugegriffen: 14. Jan. 2022
Wolter B, Stellmacher T (2019) Gesundheitsbezogene Angebote für ältere Menschen mit Migrationshintergrund, ihre Bedürfnisse und Bedarfe sowie ihre Inanspruchnahme der Angebote in den Bezirken Neukölln und Lichtenberg (GABI) – Eine Bedarfsanalyse, Institut für Gerontologische Forschung e V. https://igfberlin.de/images/downloads/20191031_Bericht_IGF_GABI.pdf. Zugegriffen: 14. Febr. 2022
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Schumann, F., Pälmke, C., Lange, K. (2022). „Aus dem Schatten ins Rampenlicht“: Versorgungssettings und Unterstützungsbedarfe in der häuslichen Pflege durch Angehörige sind vielfältig. In: Jacobs, K., Kuhlmey, A., Greß, S., Klauber, J., Schwinger, A. (eds) Pflege-Report 2022. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65204-6_15
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-65204-6_15
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-65203-9
Online ISBN: 978-3-662-65204-6
eBook Packages: Medicine (German Language)