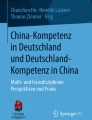Zusammenfassung
Im Beitrag werden repräsentative Daten aus 43 Mittel- und Berufsschulen im Jangtse-Delta (Stadt Shanghai und Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui) erhoben, um eine Bestandsaufnahme der „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Schulen anhand dreier Komponenten einschließlich des Deutschunterrichts, der Deutschland betreffenden Kenntnisse und des Austauschs mit Deutschland zu ermitteln. Zum Schluss werden auf der Grundlage des Status quo und der bestehenden Probleme Vorschläge zur Verbesserung der „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Schulen formuliert.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Schulen
- Deutschunterricht
- Deutschland betreffende Kenntnisse
- Austausch mit Deutschland
1 Entstehung, Bezugsrahmen und Umsetzungsstand
Diese Untersuchung beruht auf drei Gründen bzw. Bezugsrahmen, die vorgestellt werden wie folgt:
Erstens veröffentlichte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2015 seine China-Strategie (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2015), in der es den Auf- und Ausbau einer für eine erfolgreiche Kooperation mit China erforderlichen „China-Kompetenz“ an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen fordert. Zu ihr zählten Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz ebenso wie das Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie politischer, wirtschaftlicher, kultureller und historischer Zusammenhänge.Footnote 1 In der Folge haben einige deutsche Hochschulen sich für mehr „China-Kompetenz“ eingesetzt, und mehr als 80 Hochschulen haben entsprechende Anträge beim BMBF eingereicht.Footnote 2 Nach dem Start der Pilotförderung im Jahr 2018 haben nach gegenwärtigem Stand elf deutsche Hochschulen für ihre „China-Zentren“ eine dreijährige Förderung des Bundes für den Zeitraum 2017–2022 erhalten.Footnote 3 Außerdem wurde der Verbund der Chinazentren an Deutschen Hochschulen (VCdH) gegründet. Diese Entwicklung hat in China wie in Deutschland zu einer verstärkten Befassung mit der gegenseitigen „Kompetenz“ geführt. In Deutschland erfolgt der Aufbau von „China-Kompetenz“ dabei auch in Grund- und Mittelschulen: Neben dem BMBF sind hierfür die Ständige Kultusministerkonferenz der Länder (KMK), die für die Ausbildung an Primar- und Sekundarschulen zuständig ist, und das Auswärtige Amt (AA) beteiligt (Deutscher Bundestag 2019, S. 139).
Zweitens hat das Erlernen der deutschen Sprache an chinesischen Mittelschulen, die in der Regel die Klassen 7 bis 12 umfassen, in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. 2017 hat das chinesische Bildungsministerium den Lehrplan für Deutschunterricht in der Oberstufe der allgemeinen Mittelschulen (Abk.: Kebiao)Footnote 4 erlassen. Danach ist Deutsch gemeinsam mit Französisch und Spanisch ebenso wie Englisch, Japanisch und Russisch eine der Fremdsprachen, in der die allgemeine Hochschulaufnahmeprüfung abgelegt werden kann.
Drittens hat die deutsche Stiftung Mercator im Oktober 2019 den Forschungsbericht Der weite Weg nach China – Herausforderungen und Potentiale des deutsch-chinesischen Schüler- und JugendaustauschsFootnote 5 veröffentlicht. Er enthält eine umfassende und detaillierte Analyse des Zustands und der Probleme in Bezug auf den Austausch mit China, den Chinesischunterricht und den Aufbau von „China-Kompetenz“ an deutschen Mittelschulen und legt Vorschläge zur Verbesserung vor. Auch pflegen deutsche Forscher einen engen akademischen Austausch mit den Verfassern dieses Beitrags.
Aus diesen Gründen kamen die Verfasser zu dem Ergebnis, dass es Bedarf zur Untersuchung der gegenwärtigen „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Schulen gibt. Das ursprüngliche Forschungskonzept war Folgendes: „Deutschland-Kompetenz“ an Grundschulen (Klassen 1 bis 6) und Mittelschulen (Klassen 7 bis 12) wird definiert als „die für fruchtbaren Austausch und Zusammenarbeit mit Deutschland bei Lehrkräften, Schülern, Verwaltungsangestellten und Schulen in der Grund- und Sekundarstufe erforderlichen Fähigkeiten“. Dazu gehören deutsche Sprachkenntnisse, deutsche Landeskunde und Kenntnisse der Zusammenarbeit mit Deutschland. Mithilfe von Textanalyse und Interviews sollten folgende Fragen untersucht werden: Welche Erfahrungen wurden in der Praxis beim Deutschunterricht gesammelt? Welche Hindernisse und Schwierigkeiten gibt es ggf.? Bestehen regional bedingte Unterschiede? Welche konkreten Auswirkungen hat die Umsetzung des Kebiao an den Schulen? Welche Anforderungen stellen Lehrer, Schüler und Verwaltungsangestellte an Grund- und Mittelschulen? Gibt es praktische Möglichkeiten, diese Forderungen zu verwirklichen?
Während der Untersuchung stellten wir fest, dass die Erteilung von Deutschunterricht und der Aufbau von „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Grundschulen möglicherweise auf allzu idealistischen Annahmen beruht. Und auch soweit es sie gäbe, wäre es schwer, repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Daher wurde die Untersuchung neu ausgerichtet; sie konzentriert sich nun auf die „Deutschland-Kompetenz“ an Mittelschulen (einschließlich der Unterstufe von Klassen 7 bis 9 und der Oberstufe von Klassen 10 bis 12).
Dies entspricht auch dem dritten Bezugsrahmen der Untersuchung, nämlich der Forschung in Deutschland. Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hatte unvorhergesehene Auswirkungen auf die Schulen in allen Stufen, auf Universitäten sowie auch auf die Forschungsarbeit, insbesondere die Interviews vor Ort. Deswegen haben die Verfasser beide Forschungsphasen (2020 und 2021) neugestaltet und im Jahr 2020 eine Vorstudie zur „Deutschland-Kompetenz“ an Mittelschulen im Jangtse-Delta, d. h. in der Stadt Shanghai und den Provinzen Zhejiang, Jiangsu und Anhui, abgeschlossen. Schulen, an denen Deutschunterricht und der Austausch mit Schulen in Deutschland betrieben wird, findet man vornehmlich in dieser Region. Im Dezember 2020 wurde ein Teil der Ergebnisse in einem Konferenzbeitrag auf dem Seminar on the Demand and Collaborative Prospect of Chinese Teaching Programmes in EuropeFootnote 6 vorgestellt, das vom Center for Language Education and Cooperation pandemiebedingt virtuell organisiert wurde. Wissenschaftler aus China und mehreren Ländern in Europa haben sich seither mit den Verfassern ausgetauscht, es ist ein positiver Dialog entstanden.
2 Untersuchungsinhalt Teil I: Datenerhebung
Um möglichst umfassende Informationen aus erster Hand zu erhalten, wurde die Untersuchung in zwei Teilen durchgeführt: zunächst die Erhebung von Daten und dann Interviews in Schulen.
Die Datenerhebung erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Mit Unterstützung des Bildungsministeriums wandten die Verfasser sich schriftlich an die Bildungskommissionen der genannten vier Gebietskörperschaften im Jangtse-Delta und erbaten Informationen über den Deutschunterricht an Mittelschulen und den Schüleraustausch mit Deutschland. Folgende Themen wurden abgefragt:
-
1)
Deutschunterricht
Schulkategorie:
Öffentlich oder privat; Unter- oder Oberstufe der Mittelschule.
Lehre:
Klasse; Unterrichtsstunden; Pflichtkurs, Wahlpflichtkurs oder außerschulisch; mit oder ohne Lehrplan; Anzahl der Teilnehmer; Niveau (Stufe); Lehrbücher und Lernmaterialien (Titel der Bücher, Verlag, Auflage); Zweck des Unterrichts und angestrebte Lernziele; Zahlenverhältnis Lehrer-Schüler; Ausbildung der Lehrkräfte (akademische Qualifikation, Erfahrung in Deutschland); Deutschland betreffende Inhalte in Lehrbüchern für andere Fächer (wenn ja, welches Fach).
-
2)
Austausch mit Deutschland
Name der Schule oder Bildungseinrichtung.
Schulkategorie:
öffentlich oder privat; Unter- oder Oberstufe der Mittelschule. PASCH-SchuleFootnote 7 oder nicht, ggf. Jahr des Beitritts zu PASCH.
Beziehungen mit deutschen Schulen:
Bestehende Partnerschaft; keine Partnerschaft, aber regelmäßige Austauschprogramme; nur gelegentlicher Austausch.
Austausch:
Jahr des Beginns; Häufigkeit; zweiseitiger oder einseitiger Austausch; Format; Anzahl der beteiligten Schüler und Lehrkräfte (jeweils/insgesamt); werden Fördermittel der Behörden oder von Dritten gewährt.
-
3)
Probleme und Perspektiven
Ergänzend wurde ein vorläufiger Vergleich zwischen öffentlich zugänglichen deutschen Daten, nämlich der Liste der deutschen Teilnehmer am PASCH-Programm (insgesamt 126 Schulen, davon 43 DSD-SchulenFootnote 8 und 83 FIT-SchulenFootnote 9), und den von den Verfassern erhobenen Daten vorgenommen. Die fünf deutschen Auslandsschulen (DAS) in China wurden nicht einbezogen (Abb. 1).
Die Untersuchung zeigte allgemeine Probleme mit der Herstellung von Kontakten zu Deutschland oder Ausland in der Mittelschule auf. Vor allem stellte sich heraus, dass die Herstellung von Kontakten zum Ausland oder Deutschland für die chinesischen Bildungsbehörden keinen Arbeitsschwerpunkt bildet. Die befragten Bildungskommissionen oder -abteilungen waren nicht in der Lage, ausreichende Informationen über den Schüleraustausch oder den Deutschunterricht an den Mittelschulen zur Verfügung zu stellen. Sie mussten die Bildungsbehörden der Bezirke oder Kreise befragen, die sich ihrerseits an die Schulen wandten, um Informationen zu erhalten. Möglicherweise gingen die Informationen auch nicht rechtzeitig bei den Bildungsbehörden ein, oder die Schulen bzw. Befragten waren aus verschiedenen Gründen nicht bereit, Informationen zur Verfügung zu stellen. Nachstehend folgen die Informationen, die die Verfasser erhalten konnten:
Die Erhebung der Daten in den Provinzen Zhejiang, Jiangsu und Anhui wurde im Dezember 2020 bei Forschern in diesen Provinzen in Auftrag gegeben; die Informationen wurden bis Ende Dezember 2020 übermittelt. Die angegebene Anzahl von zwei Schulen in der Provinz Jiangsu stimmt nicht mit den von deutscher Seite vorgelegten Daten überein, nach denen es dort mindestens 10 PASCH-Schulen gibt. Erfahrungsgemäß ist die Anzahl der Schulen, die Deutschunterricht anbieten bzw. Austausch mit Deutschland pflegen, größer als die der im PASCH-Programm erfassten Schulen. Vier Schulen in der Provinz Anhui und 13 Schulen in der Provinz Zhejiang übermittelten die erforderlichen Informationen. Die Internationale Abteilung der städtischen Bildungskommission Shanghai hat die Bildungsbüros der 16 Bezirke der Stadt um Unterstützung gebeten. Nach eingehender Nachverfolgung gaben elf Bildungsbüros eine Rückmeldung. Von ihnen legten neun Bezirke eine Rückmeldung über den Deutschunterricht und den Austausch mit Deutschland vor. Insgesamt waren 24 Schulen (einschl. Mittel- und Berufsschulen) beteiligt. Zwei Bezirke gaben an, dass sie keinen Deutschunterricht oder Austausch mit Deutschland anbieten. Die Bildungsbüros von fünf Bezirken gaben keine Rückmeldung.
Daher können die Ergebnisse dieser Untersuchung nur eine vorläufige Bestandsaufnahme über den Deutschunterricht und den Austausch mit Deutschland an Mittelschulen im Jangtse-Delta geben. Die sich hierauf stützenden Analysen, Schlussfolgerungen und Vorschläge beruhen auf einer eher begrenzten Datenmenge.
3 Analyse des Zustands des Deutschunterrichts, der Deutschkenntnisse und des Austauschs mit Deutschland in den Mittelschulen im Jangtse-Delta
Auf der Grundlage der bisher vorliegenden Daten lässt sich der Stand des Deutschunterrichts an Mittelschulen im Jangtse-Delta in Jiangsu, Zhejiang, Shanghai und Anhui wie folgt zusammenfassen:
-
1)
Beteiligte Klassen und Zahl der Unterrichtsstunden:
Deutsch wird sowohl in der Unter- als auch in der Oberstufe unterrichtet. Abgesehen von spezialisierten Fremdsprachenschulen findet der Deutschunterricht in der Unterstufe vor allem in Form von freiwillig und zusätzlich zum im Rahmen des Curriculums vorgesehenen Unterricht statt, vergleichbar mit den ,,Arbeitsgruppen“ (AGs) an deutschen Schulen. Angeboten werden dabei in den unteren Klassen etwa 2–4 Wochenstunden. Deutschkurse in der Oberstufe sind mehr Pflicht- als Wahlpflichtfächer und führen oft auf eine Deutschprüfung hin (einschl. des DSD, der Deutschprüfung für die Hochschulaufnahmeprüfung oder an internationalen Schulen). Unterrichtet wird mit einer entsprechend hohen Stundenzahl, insbesondere in der 12. Klasse.
-
2)
Kursinhalt:
Der Schwerpunkt liegt auf der deutschen Sprache. Es gibt Schulen, die Deutsch in Verbindung mit dem Fach Mathematik mit dem Ziel des DSD-Zertifikats anbieten, und Berufsschulen, die berufsbezogenen Deutschunterricht anbieten.
-
3)
Ziel des Deutschunterrichts:
Deutsch wird zum Teil als erste Fremdsprache zur Förderung der Fremdsprachenkenntnisse in Vorbereitung auf ein Auslandsstudium oder eine weiterführende Ausbildung angeboten. Deutsch wird auch als Zweitsprache angeboten, die besonderen Interessen entspricht, den allgemeinen Horizont erweitert, Fremdsprachenkenntnisse verbessert, die zukünftige akademische Karriere fördert, dem kulturellen Austausch dient, das interkulturelle Verständnis erleichtert und die Zukunftschancen der Schüler verbessert.
-
4)
Lehrplan und Lehrmaterial:
Die untersuchten Schulen sind in der Regel nicht an einen einheitlichen Lehrplan gebunden und haben keine einheitlichen Lehrbücher. Sowohl importierte als auch in China verfasste Lehrbücher sowie Schulbücher werden verwendet.
-
5)
Angestrebter Abschluss:
Die meisten Wahl- oder Interessenkurse führen zur Prüfung für das Goethe-Zertifikat A; Pflichtkurse führen zur Prüfung für das Goethe-Zertifikat B1 oder B2.
-
6)
Lehrkräfte:
Das Zahlenverhältnis Lehrer-Schüler variiert von Schule zu Schule erheblich. Im Allgemeinen unterrichtet ein Lehrer 20 bis 30 Schüler. Es gibt aber auch Schulen, in denen für 210 Schüler nur ein Lehrer zur Verfügung steht. Die Qualifikation der Lehrer besteht überwiegend in einem Masterabschluss, mehr als die Hälfte der Lehrer hat Erfahrungen in Deutschland oder anderen deutschsprachigen Ländern gesammelt. Einige wenige Schulen haben ausländische Lehrkräfte (1–3 Personen).
-
7)
Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie:
Einige Schulen sind auf Deutschlehrer aus deutschsprachigen Ländern angewiesen, die wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie keinen Deutschunterricht vor Ort anbieten konnten.
Die befragten Schulen berichteten, dass es neben dem Deutschunterricht keinen speziellen Deutschlandfokussierten Unterricht in Landeskunde gibt und dass der Inhalt der Lehrbücher für Deutschunterricht die Landeskunde abdeckt. Darüber hinaus wird das Wissen über Deutschland in der Unter- und Oberstufe hauptsächlich im Geografie- und Geschichtsunterricht vermittelt. Daher ist eine Evaluierung der von People’s Education Press herausgegebenen Schulbücher angezeigt. Nachstehend folgt eine Zusammenfassung zum Wissen über Deutschland in Lehrbüchern.
-
A.
Geographie-Lehrbücher
-
1)
Deutschland betreffendes Wissen im zufälligen Kontext:
Bestimmte Phänomene oder Prinzipien stehen einmalig im Zusammenhang mit Deutschland oder Deutschen, z. B. die „Kontinentaldrift“ des deutschen Wissenschaftlers Alfred Wegener (FEZG 2012a, S. 39), die „Klimaklassifikation“ des berühmten Meteorologen und Klimatologen Peter Köppen (FEZG 2012a, S. 62), die „Gutenberg-Diskontinuität“ der Erde (FEZG 2019a, S. 21) etc.
-
2)
Deutschland betreffendes Wissen im notwendigen Kontext:
Europa und Deutschland in ihrer kulturellen und sozialen Vielfalt müssen Gegenstand des Unterrichts sein, notwendig sind z. B. Kenntnisse der Länder und Regionen der Welt (Abschnitt „Westeuropa“, FEZG 2012b, S. 52) und die Verteilung der Weltbevölkerung (FEZG 2019b, S. 3).
-
3)
Deutschland betreffendes Wissen im strukturellen Kontext:
Aus chinesischer Sicht ist Deutschland ein hochentwickeltes kapitalistisches Land, von dessen sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung man lernen kann. Deshalb enthält z. B. das Geografie-Lehrbuch Beispiele von Erfahrungen, die Deutschland im Prozess der Modernisierung gemacht hat. Dazu gehören Themen wie etwa „Analyse von Maßnahmen zur Verhinderung und Kontrolle der Wasserverschmutzung im Rheineinzugsgebiet“ (FEZG 2020a, S. 65), das in Deutschland entwickelte „Passivhaus“ (FEZG 2020b, S. 96) etc. Das Buch enthält auch Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland, angeführt wird z. B. der neu erschlossene Logistikroute „China-Europe Railway Express“ (FEZG 2020a, S. 87).
-
B.
Geschichtslehrbücher
-
1)
Deutschland betreffendes Wissen im zufälligen Kontext:
Manche historischen Ereignisse haben zufällig mit Deutschland oder Deutschen zu tun, wie z. B. die Geburt Beethovens im 18. Jahrhundert (Chinesisches Bildungsministerium 2018c, S. 30), das erste Auftreten der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (Chinesisches Bildungsministerium 2020b, S. 43), der Bau der ersten Autobahn der Welt in den 1930er Jahren (Chinesisches Bildungsministerium 2020b, S. 74), die Theorie von der „Achsenzeit“ des Philosophen Karl Jaspers, die auch die chinesische Zivilisation und den Konfuzianismus umfasst (Chinesisches Bildungsministerium 2019b, S. 6), etc.
-
2)
Deutschland betreffendes Wissen im notwendigen Kontext:
In der europäischen und deutschen Geschichte (einschl. der Entwicklungen Europas vom Ende des Kalten Krieges bis zur Gegenwart im 21. Jahrhundert) und der Geschichte der chinesisch-deutschen Beziehungen gibt es notwendiges Wissen über Deutschland. Insbesondere ist die Geschichte seit der Neuzeit ein wesentlicher Teil der Weltgeschichte ebenso wie der chinesischen Geschichte. Dieses Geschichtswissen wird vertieft ermittelt, es umfasst Einzelheiten wie z. B. die Entwicklung des Sozialversicherungssystems in Deutschland in 1880er Jahren (Chinesisches Bildungsministerium 2020a, S. 106). Bei der Behandlung der Belagerung des Pekinger Gesandtschaftsviertels werden die Beobachtungen des deutschen Befehlshabers Waldersee über China und die Chinesen zitiert (Chinesisches Bildungsministerium 2017a, S. 36). Das Lehrbuch stellt auch dar, wie das KettelerFootnote 10-Denkmal in Peking zum „Tor für den Triumph der Gerechtigkeit“ und schließlich zum „Tor für die Verteidigung des Friedens“ verwandelt wurde (Chinesisches Bildungsministerium 2019a, S. 104). Bei der Behandlung des Massakers von Nanjing wird aus den Tagebüchern des damaligen Siemens-Vertreters in Nanjing, John Rabe – des „guten Menschen von Nanking“ – zitiert (Chinesisches Bildungsministerium 2019a, S. 136).
-
3)
Deutschland betreffendes Wissen im strukturellen Kontext:
Der historische Materialismus ist die methodische Grundlage der Geschichtslehrbücher der Mittelschulen. Neben einer ausführlichen Einführung in die Entstehung des Marxismus und der internationalen kommunistischen Bewegung (Chinesisches Bildungsministerium 2018b, S. 98 ff.) enthält das Lehrbuch zahlreiche und vielfältige Bezüge zu den klassischen Diskursen von Karl Marx und Friedrich Engels. Wenn es z. B. um die mittelalterlichen englischen Pachtbetriebe geht, wird auf die Lehre von Marx Bezug genommen (Chinesisches Bildungsministerium 2018b, S. 61). Die Beobachtungen von Marx und Engels zur industriellen Revolution werden als erweiterte Lernmaterialien für die Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse verwendet (Chinesisches Bildungsministerium 2020b, S. 26–28). Im Kapitel „Neue Veränderungen in kapitalistischen Ländern“ lesen die Schüler auch die Vorrede von Zur Kritik der politischen Ökonomie (Chinesisches Bildungsministerium 2019b, S. 119).
Die Analyse der Daten zeigt folgende Merkmale des Austauschs mit Deutschland:
-
1)
Erfasste Schulen:
Der Austausch mit Deutschland erfolgt in der Unter- und Oberstufe, wobei der Schwerpunkt auf der Oberstufe liegt. Die Hälfte der Schulen, die einen Austausch mit Deutschland haben, sind PASCH-Partner.
-
2)
Partnerschulen:
Die Hälfte der Schulen, die einen Austausch mit Deutschland pflegen, hat Partnerschaften mit entsprechenden deutschen Schulen, hauptsächlich mit Gymnasien und Berufsschulen. Einige Schulen haben keine Partnerschaften, führen aber gleichwohl einen regelmäßigen Austausch. In den Schulen der Unterstufe gibt es mehr Ad-hoc-Austausch.
-
3)
Geschichte des Austauschs:
Abgesehen von einigen Fremdsprachenschulen, deren Austausch bis in die 1980er Jahre zurückreicht, sind die meisten Austauschbeziehungen ab 2009 entstanden.
-
4)
Häufigkeit, Form und Inhalt:
Meist erfolgt der Austausch in beide Richtungen, es gibt aber auch einen einseitigen Austausch auf der deutschen Seite. Der Austausch findet meist einmal pro Jahr oder jedes zweite Jahr statt, in einigen Fällen zwei- bis dreimal pro Jahr oder einmal alle zwei bis drei Jahre. Die Anzahl der Schüler bei einem Besuch liegt bei ca. 20. Im Rahmen des Austauschs finden Besuche, Seminare, Projekte, kulturelle Veranstaltungen, Homestay etc. statt.
-
5)
Finanzierung:
Der größte Teil des Austauschs wird von den Schülern selbst finanziert, einige Projekte werden durch die lokalen Behörden oder durch deutsche Fördermittel z. B. der Stiftung Mercator oder PASCH-Projekte unterstützt. Im Jahr 2020 ist der Austausch aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen.
4 Untersuchungsinhalt Teil II: Interviews in den Schulen
Der zweite Teil der Untersuchung erfolgte in Form von Interviews in den Schulen, die gleichzeitig mit dem ersten Teil zusammen durchgeführt wurden. Infolge der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konzentrierten die Verfasser sich auf die Stadt Shanghai. Dort wurden fünf Mittelschulen mit jeweils eigenen – aber gleichwohl repräsentativen – Besonderheiten, ausgewählt. Die Interviews mit den Schulleitern, den Verantwortlichen für Deutschunterricht und Austausch mit Deutschland und Deutschlehrern, die hier alle anonym gehalten werden, dauerten jeweils ca. eine Stunde. Relevant für die Untersuchung sind folgende Informationen:
-
1)
Schule A (öffentliche Oberstufe mit Deutschunterricht):
Ziel ist, dass die Schüler das DSD1 und das DSD2 erwerben. Die Schule hat eine Partnerschaft mit zwei deutschen Schulen. Der Austausch erfolgt in Form von Gruppen- oder Einzelreisen. Schüler aus Shanghai reisen zum Sprachunterricht nach Deutschland. Deutsche Schüler kommen zu kulturellen Aktivitäten nach Shanghai.
-
2)
Schule B (öffentliche Mittelschule, auch Fremdsprachenschule mit fakultativem Deutschunterricht in der Unterstufe und Deutschunterricht als Pflichtkurs in der Oberstufe):
Ziel ist, dass die Schüler das DSD2 erwerben und Aufnahmeprüfungen mit Deutsch als Prüfungsfach bestehen. Die Schule pflegt Partnerschaften mit deutschen Schulen. Der Austausch erfolgt in Form einer Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten.
-
3)
Schule C (öffentliche Oberstufe ohne Deutschunterricht):
Die Partnerschaft mit einer deutschen Schule führt auf einen Physikkurs zurück, der nach deutschem Modell, allerdings in englischer Sprache gegeben wurde. Der Austausch in englischer Sprache erfolgt hauptsächlich durch gegenseitige Besuche, begleitenden Unterricht etc. und dient der Erweiterung des Horizonts der Schüler.
-
4)
Schule D (private internationale Schule mit Deutsch-AGs in der Unterstufe und Deutschunterricht in der Oberstufe):
Der Deutschunterricht in der Oberstufe ist ein fakultativer Kurs im Rahmen des IBO (International Baccalaureate Organization)-Systems. Die Schule bereitet mit einem breiten Angebot an internationalen Austauschprogrammen auf das Studium vorwiegend an britischen und amerikanischen Universitäten vor. Deutschland ist kein von den Schülern bevorzugtes Studienland.
-
5)
Schule E (Berufsschule mit Deutschunterricht in verschiedenen Fachrichtungen und engem internationalem Austausch mit deutschen Partnerschulen):
Der Austausch erfolgt durch gegenseitige Besuche, Sprachförderung für Chinesisch, interkulturelle Kommunikation etc.
Bestandsaufnahme und Interviews führten zu dem Ergebnis, dass die einzelnen Schulen unterschiedliche Ziele und Formen des Austauschs mit Deutschland verfolgen. Bei allen Unterschieden gibt es aber doch folgende Ähnlichkeiten von Problemen und Perspektiven:
-
1)
Disparität im Austausch:
Es gibt zwischen den chinesischen Schulen und ihren deutschen Austauschpartnern deutliche Unterschiede in Bezug auf die Bereitschaft und die Anzahl der Teilnehmer am Austausch. Auch die Aufnahmekapazitäten sind auf beiden Seiten sehr unterschiedlich.
-
2)
Persönliche Gegebenheiten:
Der Austausch hängt oft von persönlichen Gegebenheiten ab; so kann sich der Wechsel der Schulleitung in der deutschen Partnerschule auf die Qualität der Partnerschaft auswirken.
-
3)
Finanzierung:
Aufgrund knapper finanzieller Mittel und sich aus einschlägigen Vorschriften ergebenden Beschränkungen (begrenzte Anzahl von Plätzen für offizielle Besuche, Schwierigkeiten bei der Projektbeantragung, umständliche Verfahren etc.) haben die chinesischen Schulen Schwierigkeiten, Besuche durchzuführen. Die Zahl der Besuche von chinesischer Seite ist klein und deutlich niedriger als die der Besuche der deutschen Seite.
-
4)
Prüfungsdruck:
Chinesische Schüler stehen unter hohem Prüfungsdruck. Schüler der Oberstufe wohnen überwiegend in der Schule und haben keine Zeit für Besuche oder Homestays.
-
5)
Oberflächlichkeit:
Der Austausch ist oft zu kurz und hat daher nur begrenzte Wirkung. Es sollte versucht werden, durch Online-Medien oder andere Mittel einen Online-Austausch einzuführen.
-
6)
Handreichungen:
Der Austausch ist inhaltlich durchweg monoton. Um den Austausch zu verbessern, sollte daher geprüft werden, ob es möglich ist, entsprechende Kurse zu entwickeln sowie einen Leitfaden für Lehrer und ein Handbuch für Schüler zu erstellen.
-
7)
Queraustausch:
Zwischen chinesischen Schulen, die Deutschunterricht erteilen und/oder einen Austausch mit Deutschland haben, sollten Kontakte aufgebaut werden.
-
8)
Unterstützung durch Behörden:
Mehr finanzielle Mitte und andere Ressourcen sowie weitere Unterstützung der Behörden sind notwendig.
-
9)
Fachkundige Anleitung:
Es bedarf der Anleitung von Experten aus entsprechenden Bereichen.
-
10)
Langfristige Kooperation:
Ebenso bedarf es langfristig angelegter Austauschbeziehungen und kontinuierlicher Zusammenarbeit.
5 Zusammenfassung und Vorschläge
Auf der Grundlage der in den Jahren 2020–2021 vorgenommenen Untersuchungen haben die Verfasser ein sich aus den drei Komponenten – „Deutschunterricht“, „Deutschland betreffende Kenntnisse“ und „Austausch mit Deutschland“ – bestehendes Bild von der „Deutschland-Kompetenz“ in den Mittelschulen der vier Gebietskörperschaften des Jangtse-Deltas gewonnen. Im Ergebnis wird für die Entwicklung der „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Mittelschulen Folgendes vorgeschlagen:
-
1)
Reziprozität und Empathiefähigkeit:
Der Aufbau der „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Mittelschulen sollte verstärkt im Kontext des internationalen Austauschs und der deutsch-chinesischen interkulturellen Kommunikation gesehen und verstanden werden. Es wird daher vorgeschlagen, dass Bildungsbehörden und Schulen in China den Aufbau der „Deutschland-Kompetenz“ in größerem Umfang als bisher gemeinsam mit deutschen Stellen planen. Der Aufbau der „Deutschland-Kompetenz“ in China sollte im Zusammenhang mit dem Aufbau der „China-Kompetenz“ in Deutschland gesehen werden. Durch verstärkte Zusammenarbeit können beide Seiten das gegenseitige Verständnis verbessern und möglicherweise so zur Entwicklung der „Deutschland-Kompetenz“ in chinesischen Mittelschulen beitragen. Aus einem strukturierteren Austausch könnte eine insgesamt substantiellere Arbeit hervorgehen. Einige Schwierigkeiten, die bei der Untersuchung festgestellt wurden wie z. B. dass sich niemand in einigen Bildungsbehörden um den Austausch mit Deutschland kümmert, lassen sich dadurch beheben.
-
2)
Hoher Stellenwert persönlichen Einsatzes:
Die Untersuchung zeigt, dass der chinesische Sprachunterricht in Deutschland ebenso wie der Deutschunterricht in China im Bildungssystem des jeweils anderen Landes eine untergeordnete Rolle spielt. Chinesische und deutsche Schulen betrachten sich in ihren gegenseitigen Austauschbeziehungen nicht als oberste Priorität. Daher kam und kommt dem persönlichen Engagement eine herausragende Bedeutung bei der Einführung und Entwicklung des Sprachunterrichts und der interkulturellen Kommunikation zu. Persönliche Beiträge zum etablierten Austausch sollten daher mehr als bisher – wenn möglich: institutionell – gewürdigt werden.
-
3)
Koexistenz von zwei Arten des Sprachunterrichts:
Die Untersuchung hat gezeigt, dass es an chinesischen Schulen zwei Arten von Fremdsprachenunterricht gibt, nämlich Sprachunterricht zu Leistungszwecken (in der Regel zur Erlangung einer Qualifikation) und Sprachunterricht mit dem Ziel des besseren kulturellen Verständnisses. Es ist davon auszugehen, dass beide Formen geraume Zeit weiterhin nebeneinander bestehen und einander ergänzen werden. Daher wird vorgeschlagen, dass je nach Ausrichtung des Sprachkurses unterschiedliche Vorgaben für Lehrbücher und Lehrerausbildung gemacht werden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass wichtige Teile der Zusammenarbeit in deutscher Hand liegen. Die deutsche Seite leistet gezielt systematische Unterstützung für den Deutschunterricht an ausländischen Sekundarschulen in China. Dies schließt Lehrbücher, Lehrpläne, Prüfungen für Sprachzertifikate, Lehrerausbildung und Freiwilligeneinsätze mit ein. Es wäre wünschenswert, dass das auf chinesischer Seite mehr Beachtung findet.
-
4)
Kontakt mit Ausländern:
Der Kontakt mit Ausländern ist ein wichtiges Mittel, um das kognitive Interesse der Schüler zu steigern, die Sprache des anderen zu lernen und auf diese Weise kulturelle Missverständnisse und -interpretationen zu verringern mit dem Ziel (Sun 2020), Schülern eine umfassendere Sicht auf die Welt zu bieten und ihr Selbstvertrauen zu entwickeln. Doch stößt der Kontakt mit Ausländern in vielerlei Hinsicht auf Schwierigkeiten, so etwa bei der Finanzierung und administrativen Vorgängen. Die Zurückhaltung vieler Schulen bei der Offenlegung von Informationen über ihre Austauschprogramme könnte darauf beruhen, dass eine große Anzahl der Programme von den Schülern selbst finanziert oder über Vermittler durchgeführt und daher nicht vom staatlichen Bildungssystem unterstützt wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass Behörden und private Akteure verstärkt prüfen, wie das Finanzierungsproblem in angemessenerer Art und Weise gelöst werden kann.
-
5)
Errichtung einer Zentralstelle für Informationen:
Die Untersuchung hat ergeben, dass der Aufbau von „Deutschland-Kompetenz“ an den Schulen notwendig ist und einem Bedarf entspricht. So hat z. B. die Shanghai Ganquan Foreign Language High School im Jahr 2019 die Gründung des „Schulbündnisses für den Deutschunterricht in China“Footnote 11 initiiert, das die Verstärkung der Kommunikation mit Deutschland mit dem Ziel zum Gegenstand hat, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu fördern und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Untersuchung hat auch ergeben, dass es an Informationen über Deutschunterricht und an Kommunikation zwischen den Schulen, die Deutschunterricht erteilen, mangelt. Es wird daher vorgeschlagen, eine Zentralstelle für Informationen über Deutschunterricht und den Austausch chinesischer Schulen mit Deutschland in Verbindung mit der Entwicklung einer Datenbank, einer Website und Accounts in sozialen Medien zu schaffen sowie entsprechende Forschungsprojekte zu finanzieren. Auf diese Weise wären interessierte Stellen in der Lage, sich beim Aufbau der „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Schulen gegenseitig zu befruchten.
Die korrespondierende Autorin (KA) ist Zhouming Yu
Aus dem Chinesischen von Junyi Song
Notes
- 1.
- 2.
Siehe: http://chinazentren.de/. Zugegriffen: 2. November 2020.
- 3.
Siehe: https://www.internationales-buero.de/de/china_kompetenz_an_deutschen_hochschulen.php. Zugegriffen: 2. November 2020.
- 4.
Siehe: Chinesisches Bildungsministerium 2018.
- 5.
Stepan und Frenzel 2019b. Für die chinesische Ausgabe siehe: https://www.goethe.de/resources/files/pdf210/201910-3.pdf. Zugegriffen: 10. August 2022.
- 6.
Vgl. Hu 2020.
- 7.
PASCH steht für „Schulen: Partner der Zukunft”, dies ist eine Initiative des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und dem Goethe-Institut. Die Initiative vernetzt weltweit mehr als 2000 Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat.
- 8.
DSD-Schulen bieten in Rahmen des Bildungssystems ihres Landes das Deutsche Sprachdiplom an. Diese Schulen werden von der ZfA betreut.
- 9.
FIT-Schulen bieten in Rahmen des Bildungssystems ihre Landes Deutschunterricht an. Diese Schulen werden vom Goethe-Institut (GI) betreut.
- 10.
Clemens von Ketteler (1853–1900), Diplomat des Deutschen Reiches. Sein Tod mitten im Boxerauftand in Peking gilt als der Auslöser der militärischen Expedition der „Vereinigten acht Staaten“.
- 11.
Siehe: http://www.shpt.gov.cn/jyj/qunei-xinwen/20191029/452317.html. Zugegriffen: 20. Dezember 2020.
Literatur
Bundesministerium für Bildung und Forschung. 2015. China-Strategie des BMBF 2015–2020. Strategischer Rahmen für die Zusammenarbeit mit China in Forschung, Wissenschaft und Bildung. https://www.bmbf.de/pub/China_Strategie_Langfassung.pdf. Zugegriffen: 2. November 2020.
Bundesministerium für Bildung und Forschung. 2016. Bekanntmachung im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung. Richtlinie zur Förderung von „Innovativen Konzepten zum Ausbau der China-Kompetenz an deutschen Hochschulen. https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1276.html. Zugegriffen: 2. November 2020.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2017a. Yiwu jiaoyu jiaokeshu Zhongguo lishi (Chinesische Geschichte, Lehrbuch für Pflichtbildung), Klasse 8, Bd. 1. Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium. 2018a. Putong gaozhong deyu kecheng biaozhun (Lehrplan für Deutschunterricht in der Oberstufe der allgemeinen Mittelschulen). Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2018b. Yiwu jiaoyu jiaokeshu Shijie lishi (Weltgeschichte, Lehrbuch für Pflichtbildung), Klasse 9, Bd. 1. Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2018c. Yiwu jiaoyu jiaokeshu Shijie lishi (Weltgeschichte, Lehrbuch für Pflichtbildung), Klasse 9, Bd. 2. Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2019a. Putong gaozhong jiaokeshu Lishi (Geschichtslehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Pflichtunterricht: Zhong wai lishi gangyao (Grundzüge der chinesischen und ausländischen Geschichte), Bd. 1. Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2019b. Putong gaozhong jiaokeshu Lishi (Geschichtslehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Pflichtunterricht: Zhong wai lishi gangyao (Grundzüge der chinesischen und ausländischen Geschichte), Bd. 2. Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2020a. Putong gaozhong jiaokeshu Lishi (Geschichtslehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Wahlpflichtunterricht 1: Guojia zhidu yu shehui zhili (Staatssystem und Gesellschaftsgovernance). Peking: People’s Education Press.
Chinesisches Bildungsministerium, Hrsg. 2020b. Putong gaozhong jiaokeshu Lishi (Geschichtslehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Wahlpflichtunterricht 2: Jingji yu shehuis henghuo (Wirtschaft und Gesellschaftsleben). Peking: People’s Education Press.
Deutscher Bundestag. 2019. Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung 2017 bis 2018, Drucksache 19/15360 (neu). http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/153/1915360.pdf. Zugegriffen: 2. November 2020.
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geografie-Lehrbuch im Lehrbuchforschungsinstitut, People’s Education Press (Abk.: FEZG), Hrsg. 2012a. Yiwu jiaoyu jiaokeshu Dili (Geografie-Lehrbuch für die Pflichtbildung), Klasse 7, Bd. 1. Peking: People’s Education Press.
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geografie-Lehrbuch im Lehrbuchforschungsinstitut, People’s Education Press (Abk.: FEZG), Hrsg. 2012b. Yiwu jiaoyu jiaokeshu Dili (Geografie-Lehrbuch für die Pflichtbildung), Klasse 7, Bd. 2. Peking: People’s Education Press.
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geografie-Lehrbuch im Lehrbuchforschungsinstitut, People’s Education Press (Abk.: FEZG), Hrsg. 2019a. Putong gaozhong jiaokeshu Dili (Geografie-Lehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Pflichtunterricht, Bd. 1. Peking: People’s Education Press.
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geografie-Lehrbuch im Lehrbuchforschungsinstitut, People’s Education Press (Abk.: FEZG), Hrsg. 2019b. Putong gaozhong jiaokeshu Dili (Geografie-Lehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Pflichtunterricht, Bd. 2. Peking: People’s Education Press.
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geografie-Lehrbuch im Lehrbuchforschungsinstitut, People’s Education Press (Abk.: FEZG), Hrsg. 2020a. Putong gaozhong jiaokeshu Dili (Geografie-Lehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Wahlpflichtunterricht 2: Quyu fazhan (Regionale Entwicklungen). Peking: People’s Education Press.
Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geografie-Lehrbuch im Lehrbuchforschungsinstitut, People’s Education Press (Abk.: FEZG), Hrsg. 2020b. Putong gaozhong jiaokeshu Dili (Geografie-Lehrbuch für die Oberstufe der allgemeinen Mittelschule), Wahlpflichtunterricht 3: Ziyuan, huanjing yu guojia anquan (Ressourcen, Umwelt und Staatssicherheit). Peking: People’s Education Press.
Hu, Chunchun. 2020. Austausch zwischen Schülern in China und Deutschland aus der Perspektiven der chinesisch-deutschen und -europäischen Zusammenarbeit beim Sprachunterricht. Unveröffentlichter Konferenzbeitrag im Seminar on the Demand and Collaborative Prospect of Chinese Teaching Programmes in Europe. 17. Dezember, Peking: Center for Language Education and Cooperation.
Stepan, Matthias, und A. Frenzel. 2019a. Qianghua „Zhongguo nengli“ zhi lujing. In Deguo de „Zhongguo nengli“ yu Zhongguo de „Deguo nengli“ (China-Kompetenz in Deutschland und Deutschland-Kompetenz in China), Hrsg. C. Hu und Z. Yu, 103–125. Peking: Social Sciences Academic Press (China).
Stepan, Matthias, und A. Frenzel. 2019b. Der weite Weg nach China – Herausforderungen und Potentiale des deutsch-chinesischen Schüler- und Jugendaustauschs. Berlin: Mercator Institute for China Studies.
Sun, Yixue. 2020. Zhong wai wenhua hutong shouxian yao bimian wudu (In der kulturellen Kommunikation zwischen China und dem Ausland sollen in erster Linie Missinterpretationen vermieden werden). http://hn.ifeng.com/a/20200818/14435300_0.shtml. Zugegriffen: 2. November 2020.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Hu, C., Yu, Z., Song, J. (2023). „Deutschland-Kompetenz“ an chinesischen Mittelschulen im Jangtse-Delta. Eine Bestandsaufnahme und Vorschläge für die Weiterentwicklung. In: Hu, C., Triebel, O., Zimmer, T. (eds) Im Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdverstehen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_17
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_17
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-40030-9
Online ISBN: 978-3-658-40031-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)