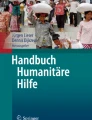Zusammenfassung
Gender ist eine zentrale Analysekategorie zur gesundheitsförderlichen Gestaltung von Interaktionsarbeit. Gender und Geschlecht sind soziale Kategorien, die Wahrnehmungs- Deutungs- und Bewertungsmuster strukturieren, unterschiedliche Erwartungen an Frauen und Männer, Aufgabenzuweisungen sowie Ressourcenausstattung zur Folge haben. In Branchen mit einem hohnen Anteil an Interaktionsarbeit arbeiten überwiegend Frauen, die von einer fehlenden Anerkennung und schlechten Gestaltung von Interaktionsarbeit betroffen sind. Die unterschiedlichen Emotionsregeln in Organisationen nach Geschlecht führen zu spezifischen Bewältigungsmöglichkeiten für Frauen und Männer. Zudem ist Gender Gegenstand der Interaktonsarbeit und erfordert einen reflektierten Umgang z. B. mit den Geschlechtsrollenerwartungen der Klient:innen oder Patient:innen. Für eine gesundheitsförderliche Gestaltung ist Gender theoretisch fundiert als Analysekategorie mitzuführen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- Interaktionsarbeit
- Gender
- Menschengerechte Gestaltung von Interaktionsarbeit
- Partizipatives Gesundheitsmanagement
1 Einleitung
Seit einigen Jahren hat sich in der Arbeitswissenschaft ein neues Forschungsfeld etabliert, die gesundheitsfördernde Gestaltung von Interaktionsarbeit (Böhle et al. 2015; Becke und Bleses 2015). Interaktionsarbeit unterscheidet sich von anderen Arbeitsfeldern insbesondere dadurch, dass das zielgerichtete Handeln in der Interaktionsarbeit auf die Mitwirkung der beteiligten Personen (Klient*innen) angewiesen ist. Klassische Bereiche, in denen Interaktionsarbeit stattfindet, sind Dienstleistungen wie Pflege, Erziehung, Bildung, aber auch Beratung, Einzelhandel und technische Dienstleistungen. Bisher gibt es jedoch wenig Untersuchungen, die die gesundheitsförderliche Gestaltung von Interaktionsarbeit unter Genderaspekten analysieren. Und dies, obwohl einige klassischen Studien zur Interaktionsarbeit dem feministischen Spektrum zuzuordnen sind. Eng mit Interaktionsarbeit verwoben sind Geschlechtsrollenerwartungen, die einen starken Einfluss auf die Anerkennung von Belastungen und Gewährung von Ressourcen haben und die Interaktion zwischen den Beteiligten strukturieren und bisweilen eben auch hierarchisieren. Die Branchen und Tätigkeitsfelder, in denen Dienstleistungsarbeit verrichtet wird, sind selbst geschlechtersegregiert und mit sehr unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet und durch spezifische Belastungen gekennzeichnet. Um gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern, ist eine geschlechtertheoretische Reflexion der Vorgehensweise in der Gesundheitsförderung erforderlich sowie eine entsprechende gesundheitspolitische Gestaltung der jeweiligen Rahmenbedingungen von Interaktionsarbeit.
Der Beitrag skizziert, inwiefern Gender systematisch bei einer gesundheitsfördernden Gestaltung von Interaktionsarbeit berücksichtigt werden sollte. In diesem Zusammenhang wird zuerst die Frage gestellt, welche Bedeutsamkeit Geschlecht als soziale Kategorie bei der Gestaltung von Interaktionsarbeit einnimmt und welche Bedeutung gesellschaftliche Rahmenbedingungen hierbei haben. Daran anschließend soll herausgearbeitet werden, inwieweit Geschlecht eine Dimension in der Interaktionsarbeit darstellt. Abschn. 4 adressiert die Frage der menschengerechten Gestaltung der Interaktionsarbeit, der sich in Abschn. 5 daraus abgeleitete Empfehlungen anschließen.
2 Zum Verständnis von Geschlecht
Geschlecht ist eine soziale Kategorie, die in vielschichtiger Weise Einfluss auf die Verteilung von Belastungen und Ressoucen zwischen den Geschlechtern und somit auf deren Gesundheitschancen nimmt. Soll Interaktionsarbeit gesundheitsförderlich gestaltet werden – gleichermaßen für Frauen und Männer (oder sich divers zuordnenden Personen) – bedarf es eines entsprechenden Verständnisses davon, was „Geschlecht“ eigentlich ist und wie sich soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern erklären lassen. Im Rahmen gleichstellungspolitischer Strategien wie dem Gender Mainstreaming geht es um den gesetzlichen Auftrag, Entscheidungsprozesse, Programme, Gesundheitsförderung etc. für die Gleichstellung der Geschlechter nutzbar zu machen (Stiegler 2000). Dies impliziert, dass die Mechanismen, die zu einer (gesundheitlichen) Ungleichheit zwischen den Geschlechtern führen, untersucht werden. Daran schließt die Frage an, wie in diese Zusammenhänge interveniert werden kann, um Gleichstellung bzw. gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern.
In diesem Abschnitt werden – in geboter Knappheit – zentrale Erkenntnisse der Geschlechterforschung skizziert, die einen analytischen Zugang schaffen.
Gender bzw. Geschlecht sind als soziale Kategorien zu verstehen, entlang derer gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Strukturen, Kontextbedingungen, Werte und Normen) als auch die Interaktion zwischen Menschen strukturiert werden.
Geschlecht als Strukturkategorie
Anhand von Geschlecht kann untersucht werden, wie sich gesellschaftlich wertvolle Güter und Lasten unterschiedlich auf Frauen und Männer verteilen. Geschlecht wird verstanden als eine soziale Unterscheidung, die Personen einer Gruppe zuordnet und damit ggf. benachteiligende Aus- bzw. Abgrenzungen vornimmt, die etwa zu Lohndifferenzen zwischen Frauen und Männern führen. Geschlecht ist in diesem Verständnis, wie oben bereits erwähnt, eine soziale Kategorie, die insbesondere als Positionsanweiser (Krüger 1995) in der Gesellschaft fungiert und Frauen und Männern unterschiedliche Aufgaben zuweist sowie an diese unterschiedliche Rollenerwartungen stellt. An Geschlecht knüpfen gesellschaftliche Regeln und Strukturen an, die das Handeln anleiten und bestehende Geschlechterarrangements stabilisieren (Goffman 2001).
Zu den geschlechtsbezogenen Strukturen zählt z. B. die nach wie vor bestehende Segregation des Arbeitsmarktes nach Geschlecht sowie eine geschlechtliche Arbeitsteilung in der Fürsorgearbeit im Privaten. Damit einher gehen eine nach wie vor bestehende Unterbewertung der überwiegend von Frauen ausgeübten Tätigkeiten und vergleichsweise schlechte Arbeitsbedingungen in frauendominierten Tätigkeitsfeldern. Der bestehende Strukturkonflikt zwischen Erwerbsarbeit und unentgeltlicher Fürsorgearbeit wird überwiegend von Frauen bewältigt, mit entsprechenden gesundheitlichen Belastungen und einem erhöhten Risiko der Altersarmut (RKI 2005).
Will man also gesundheitliche Chancengleichheit nach Geschlecht analysieren, ist zu prüfen, ob Frauen und Männer oder sich als divers einordnende Personen in Bezug auf bestimmte Dimensionen benachteiligt sind.
Gender und doing gender als Prozesskategorie
Gender bezeichnet das soziale Geschlecht. Die aktive Darstellung der Geschlechtszugehörigkeit hingegen wird als doing gender bezeichnet (West und Zimmermann 1987).
Die Darstellung des eigenen Geschlechts vollzieht sich unter Rekurs auf kulturell verankerte Normen, die vermitteln, was angemessene Einstellungen und Aktivitäten für Frauen und Männer sind (Dunkel und Rieder 2003, S. 6). Bei der Analyse von „Unterschieden“ zwischen Frauen und Männern werden also nicht deren männlichen und weiblichen Eigenschaften beobachtet, sondern ihr Verhalten gemäß gesellschaftlicher Konventionen, Normen, Erwartungen, Regeln (Hirschauer 1994). Geschlecht wird in Interaktionen dargestellt und anerkannt. Geschlecht, egal in welcher Ausprägung, ist Teil der Identität, die sich in Auseinandersetzung mit Anderen bildet. Es ist kaum möglich, eine nicht-geschlechtliche Identität auszubilden wenngleich Geschlecht in den Interaktionen aktualisiert werden oder in den Hintergrund treten kann (Hirschauer 1994).
Geschlecht als Dimension der symbolischen Ordnung
Geschlecht ist zudem auf der symbolischen Ebene von Bedeutung. Geschlecht ist mit Wahrnehmungs-, Deutungs- und Bewertungsmustern verflochten. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, Gegenstände sind vergeschlechtlicht und mit Männlichkeit und Weiblichkeit konnotiert. Die Relation der Geschlechter, zwischen Weiblichem und Männlichem, kann egalitär/komplementär sein oder hierarchisch/auf- und abwertend. Insbesondere tragen dichotome Denkmuster (Mann/Frau, hart/weich, rational/emotional) und deren geschlechtliche Konnotation (Frau = emotional, Mann = rational) und die Verknüpfung mit einer Höherbewertung des Männlichen (rational = männlich = wichtiger/besser) zur Aufrechterhaltung der sozialen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bei (vgl. Knapp 1995).
Gender oder Geschlecht in der Analyse und Gestaltung von Interaktionsarbeit zu berücksichtigen bedarf eines theroretischen Zugangs, der Gender und Geschlecht als soziale Konstruktionen begreift und nicht als eine Eigenschaft der Personen. Ein differenztheoretischer Ansatz (vgl. Knapp 2011) reicht zur Analyse der Entstehung sozialer Ungleichheit nicht aus. In der gesundheitsbezogenen Forschung wird Geschlecht oft als eine unabhängige Variable eingeführt, die nach Unterschieden zwischen Männern und Frauen fragt, dies jedoch in einer Eigenschaftslogik verfolgt. So auch in Untersuchungen zur Interaktionsarbeit. Exemplarisch zeigt die Studie von Erickson und Ritter (2001), dass hier erwartet wurde, dass Frauen und Männer anders mit Belastungen durch Interaktionsarbeit umgehen oder unterschiedlich stark dadurch belastet sind – wegen ihres Geschlechts. Die Autor:innen zeigen auf, dass es bei gleicher Konstellation von Belastungen und Ressourcen keinen Unterschied nach Geschlecht gibt. Für gesundheitliche Unterschiede sind demnacht nicht Eigenschaften von Frauen und Männern maßgeblich, sondern Charakteristika der Arbeitssituation.
Ineinandergreifen der verschiedenen Dimensionen von Geschlecht
Die verschiedenen Dimensionen von Geschlecht tragen in ihrer Verknüpfung zum Entstehen und zur Auftrechterhaltung von Ungleichheitsverhältnissen zwischen den Geschlechtern bei. Neben Geschlecht zählen weitere Unterscheidungen und Merkmale zur Ungleichheitsverhältnissen, wie etwa Alter oder Herkunft. Schwinn (2008) argumentiert, dass das Zusammenwirken der einzelnen Merkmale nur durch eine jeweils konkrete Analyse der unterschiedlichen Machtressourcen im jeweiligen Kontext zu verstehen sind. Nach Schwinn (2008) lässt sich so erkennen, dass es zu einer unterschiedlichen Verteilung der Machtressourcen z. B. nach Geschlecht kommt:
-
Distinktions- bzw. Definitionsmacht – Wer bestimmt was relevant ist und was Geltung hat?
-
politische Macht – Wer ist an Entscheidungen beteiligt/trifft sie?
-
ökonomische Macht bzw. Ressourcen – Wer verfügt über welche z. B. finanziellen Mittel?
Je nach konkreter Konstellation, die untersucht wird, können diese Ressourcen sehr unterschiedlich auf die Geschlechter verteilt sein. Bisher lässt sich nach wie vor eine gewisse Homologie beobachten, nach der männlich konnotierte Bereiche der Gesellschaft höher bewertet sind, mit mehr Ressourcen ausgestattet sind und ihre Interessen auch besser durchsetzen können. Hingegen ist der Bereich Pflege ein weiblich dominiertes Feld, finanziell unterausgestattet, was entsprechend schlechte Arbeitsbedingungen zu Folge hat. Gespiegelt wird dies zudem durch die lange betriebene Reprivatisierung von Pflege zu Lasten der Frauen (z. B. Goldmann 2002).
Frauen sind nach wie vor in Entscheidungsfunktionen unterrepräsentiert, was zu einer Marginalisierung der für sie relevanten Themen beiträgt. Dies gilt auch für Ressourcen und Relevanzsetzungen in der Wissenschaft. So orientiert sich der Mainstream der Arbeitsforschung an Kriterien der Arbeitsgestaltung, die an Produktion ausgerichtet sind und damit an den Arbeits- und Lebensrealitäten von Männern. Diese Art der geschlechtsbezogenen Verzerrung wurde als gender bias (Eichler 1998) analysiert und systematisiert.
Geschlecht durchzieht als eine soziale Kategorie alle gesellschaftlichen Bereiche. Um Interaktionsarbeit menschengerecht oder gesundheitsförderlich zu gestalten, ist Geschlecht eine Analysekategorie, die einzubeziehen ist.
Die Befassung mit den Besonderheiten der Interaktionsarbeit und die Entwicklung eigener Gestaltungskriterien (siehe unten) ist in diesem Sinne schon selbst ein großer Beitrag für Geschlechtergerechtigkeit (Aulenbacher 2018), weil nur so das Wesen der Tätigkeit, ihre Rahmenbedingungen und damit verbundene gesundheitliche Auswirkungen, die typisch für von Frauen dominierten Tätigkeiten sind, erfasst werden. Dies ist relevant für die monetäre Bewertung der Tätigkeiten, Ressourcenausstattung als auch für die Entwicklung der Schutzstandards für Interaktionsarbeit (Thorein et al. 2020).
3 Interaktionsarbeit und Gender
In diesem Abschnitt geht es um einen systematischen Zugang zur Bedeutung von Geschlecht (Gender) als eine Dimension in der Interaktionsarbeit. Dunkel und Rieder (2003) verknüpfen doing gender mit dem Konzept von Interaktionsarbeit und sprechen dabei von working gender. Damit bezeichnen sie die interaktive Hervorbringung von Geschlechtlichkeit als Bestandteil der interaktiven Arbeit (Dunkel und Rieder 2003, S. 5). Grundlage ihrer Überlegungen ist das Konzept der Emotionsarbeit nach Hochschild (1979). Interaktionsarbeit unterscheidet sich von Produktionsarbeit vor allem dadurch, dass ihr Gegenstand ein Mensch mit eigenen Interessen und Bedürfnissen ist und Interaktionsarbeit immer Ko-Produktion ist. Das Dienstleistungsergebnis kann nur in Zusammenarbeit mit der Kund:in/der Klient:in erzeugt werden (Böhle 2015, S. 37 f.). Für das Zustandekommen dieser Kooperation ist Interaktionsarbeit als Teil der Dienstleistungsarbeit erforderlich. Die Interaktionsarbeit erfordert die Arbeit sowohl an den eigenen Gefühlen als auch an den Gefühlen der Kund:innen bzw. Klient:innen.
Dabei sind nach Dunkel und Rieder (2003) die eigenen Gefühle eine Bedingung in der Interaktionsarbeit. Diese müssen soweit angepasst werden, dass sie zu den Anforderungen am Arbeitsplatz passen und mit den dort geltenden Gefühlsregeln übereinstimmen. Dauerhaft kann es für die Beschäftigten gesundheitlich belastend sein, wenn die eigenen Gefühle nicht mit den geforderten Gefühlen übereinstimmen.
Gefühle sind gleichzeitig ein Mittel der Interaktionsarbeit, über das die Situation und das Gegenüber erfasst wird, sich die Mitarbeiter:in auf das Gegenüber einstellt und das Arbeitshandeln darauf abstellt.
Darüber hinaus sind Gefühle auch Gegenstand des Arbeitshandelns. Die Bearbeitung der Gefühle andere Personen sind mitunter eine Voraussetzung, um das Arbeitsergebnis zu erreichen.
Analog dazu lässt sich Gender ebenfalls als Bedingung, Mittel und Gegenstand der Interaktionsarbeit begreifen (Dunkel und Rieder 2003).
Gender als Bedingung
Grundsätzlich gilt, dass sich Personen einer sex category zuordnen lassen müssen. Es wird erwartet, dass sie ihre Geschlechtszugehörigkeit situationsangemessen darstellen und dies auch von anderen erwarten. Besonders deutlich wird dies etwa für Bereiche, in denen eine Geschlechtertrennung vorherrscht, wie bei Toiletten oder Herren- und Damenabteilungen. Gender als Bedingung ist Bestandteil von Interaktionen insgesamt und nicht spezifisch für Interaktionsarbeit.
Gender als Mittel
Im Rahmen von working gender, also der Herstellung von Gender/Geschlecht als Teil der beruflichen Tätigkeit/der Interaktionsarbeit, ist doing gender (die Darstellung und Anerkennung von Geschlecht) ein Mittel, das zur Herstellung des Arbeitsergebnisses eingesetzt wird. Hierbei wird die Leitlinie der Kund:innenorientierung als Legitimationsgrundlage verwandt, nach der es darauf ankomme, den Kund:innenwünschen zu entsprechen, die wiederum auch an Geschlechterstereotypen orientiert sind (Dunkel und Rieder 2003, S. 7). So wird von Stewardessen eine freundliche und unterwürfige Haltung erwartet sowie ein attraktives feminines Äußeres als Teil der Dienstleistung. Weiblichkeit ist eng verknüpft mit den Erwartungen an die Dienstleistung. Im Kontrast dazu wird von den Stewards eher erwartet, aggressive Fluggäste zur Räson zu bringen.Footnote 1
Gender als Gegenstand
In der Interaktionsarbeit kommt Gender zum Einsatz, wenn es um die Reproduktion von Geschlecht im Vollzug der Arbeit kommt – als Rückwirkung auf die Identität der Beschäftigten, wenn sie etwa ihre eigene Männlichkeit durch als männlich etikettierte Eigenschaften im Job, wie Durchsetzungsvermögen, Beharrungsvermögen, Toughness, betonen können, um so ihre Arbeitszufriedenheit zu erhöhen.
Im Beispiel der Flugbegleiterinnen wird jedoch auch der Fluggast in seiner Männlichkeit bestätigt, die damit zum Arbeitsgegenstand wird (Dunkel und Rieder 2003, S. 8). Deutlicher wird Gender als Gegenstand von Interaktionsarbeit z. B. bei körperbezogenen Dienstleistungen wie kosmetischen Behandlungen, im Verkauf etc., wenn etwa die Weiblichkeit der Kundin betont werden soll oder entsprechende Schönheitsbilder realisiert werden sollen.
„Es zeigt darüber hinaus, dass interaktive Dienstleistungsarbeit mitunter direkt darauf zielt, das “Doing Gender” der DienstleistungsnehmerInnen zu unterstützen – in diesem Fall über die Anpassung des Körpers an die geschlechtsspezifisch geprägten Erwartungen.“ (Dunkel und Rieder 2003, S. 9)
Es zeigt sich also, dass unterschiedliche Erwartungen an Frauen und Männer gestellt werden und daraus unterschiedliche Verhaltesweisen folgen (sollen). Zudem ist dies mit einer unterschiedlichen Verteilungen von Ressoucen und Belastungen verbunden, worauf im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird. Gleichzeitig tragen die Geschlechternormen zu einer Reproduktion von Ungleichheitsverhältnissen bei.
4 Menschengerechte Gestaltung von Interaktionsarbeit
Böhle et al. (2015) haben darauf hingewiesen, dass sich Interaktionsarbeit in spezifischer Weise von der Arbeit an Objekten unterscheidet und dass die Gestaltungskriterien menschengerechter Arbeit, die an der Produktionsarbeit entwickelt wurden, dem Wesen der Interaktionsarbeit nicht gerecht werden.
-
Bei der Gestaltung der Arbeit müssen sowohl die Belange der Beschäftigten als auch der Kund:innen berücksichtigt werden. Werden die Belange der Kund:innen nicht erfüllt, gefährdet dies die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und stellt den Sinn der Dienstleistung infrage. Die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit wird maßgeblich über die gesellschaftliche Nützlichkeit der Produkte definiert und wird durch Böhle et al. (2015) um den Gebrauchswert der Dienstleistung für die Kund:in ergänzt.
-
Die Vielfältigkeit der Tätigkeit kann zur Belastung werden, wenn Anforderungen der Kund:innen ausufern.
-
Gleichzeitig ist Interaktionsarbeit nur bedingt plan- und kontrollierbar. Das Kriterium der Vollständigkeit der Tätigkeit – Planung, Durchführung und Kontrolle – bildet Unwägbarkeiten und informelles Handeln nur unzureichend ab. Es wäre zu ergänzen um die Möglichkeit, situativ und informell zu handeln.
-
Vermeidung widersprüchlicher Anforderungen: ökonomischer Druck und eine Steuerung über Zielvereinbarungen und Controlling geraten in Widerspruch zu Arbeitshandlungen, die dem Wohl der Klient:innen/Patient:innen dienen.
Die oben erläuterten Kriterien leisten bereits einen Beitrag zu einer geschlechtergerechten Gestaltung der Interaktionsarbeit, indem sie wesentliche Anforderungen und damit einhergehende Belastungen und die zur Bewältigung erforderlichen Ressourcen in der Interaktionsarbeit überhaupt erst sichtbar machen und benennen.
Aus einer Genderperspektive werden Spannungsfelder und Besonderheiten sichtbar, die es in der Gestaltung von Interaktionsarbeit zu berücksichtigen gilt.
Studien zu gender and work oder gendered organizations (Acker 1990, 2010) zeigen, dass Geschlechtsrollenerwartungen sowohl in Arbeitsprozesse eingebettet sind als auch in Arbeitszeitregieme etc. Kleidervorschriften für Frauen, die sie sexualisieren und seitens der Organisation gefordert werden, dürften zu sexistischen und sexualisierten Praktiken beitragen und Grenzüberschreitungen der Kund:innen fördernFootnote 2. Die Abgrenzung dürfte hier schwerfallen, wenn das eigene Management auf „sex sells“ setzt. Die Abgrenzungsmöglichkeiten von Frauen sind gegenüber Männern durch ihren geringeren sozialen Status eingeschränkt (Hochschild 1983).
Geschlechtsbezogene Rollenwartungen stellen eine Anforderung und ggf. eine Belastung für die beteiligten Personen da. Damit sind sowohl gesundheitliche Auswirkungen verbunden, als auch Formen der Geschlechterdiskriminierung, wenn Frauen etwa von Aufstiegspfaden ausgeschlossen sind, weniger verdienen etc. In Bezug auf die Beurteilung von Arbeitsbedingungen und deren gesundheitsförderliche Gestaltung tragen geschlechtsbezogene Erwartungen dazu bei, dass die gestellten beruflichen Anforderungen nicht als solche erkannt und honoriert werden, weil sie z. B. als weibliche Eigenschaften vorausgesetzt und nicht als Arbeitsanforderung definiert werden. Ein anderes Phänomen ist die Bagatellisierung von Anforderungen, etwa die Konfrontation mit Aggressivität in männerdominierten Bereichen. Die geschlechtsbezogenen Rollenerwartungen verstellen den Blick auf vorhandene Belastungen und verhindern damit die Mobilisierung bzw. den Zugang zu Ressourcen, die für die Bewältigung förderlich wären oder schränken entsprechende Maßnahmen der Arbeitsgestaltung ein (Nielbock und Gümbel 2012; Nielbock 2013).
Gleichzeitig lassen sich verinnerlichte gesellschaftliche Vorstellungen über einen angemessenen Umgang der Geschlechter miteinander in der Interaktionsarbeit nicht ignorieren. Einerseits kann kaum gefordert werden, dass Frauen aus Berufen und Tätigkeiten ausgeschlossen werden, weil männliche Kollegen oder Kunden keine Frauen wünschenFootnote 3. Anderseits ist es einsichtig, dass z. B. in der Pflege die persönlichen Wünsche berücksichtigt und die Intimsphäre der pflegebedürftigen Personen gewahrt bleiben (Heusinger und Dummert 2017). Das Geschlecht der pflegenden Person kann aus Sicht der pflegebedürftigen Person problematisch sein (Lottmann 2020), etwa wenn biographische Erfahrungen mit sexueller Gewalt oder Diskriminierungen vorliegen. Von einem Mann oder einer Frau gepflegt werden zu wollen, ist ein legitimer Anspruch. Gender ist also Voraussetzung und Gegenstand der InteraktionsarbeitFootnote 4.
Um eine gendersensible Pflege zu ermöglichen, sind geschützte Räume erforderlich, in denen solche Aspekte überhaupt thematisiert werden können. Die in der Pflege geforderte biographische Arbeit, die eine Grundlage für eine gendersensible Pflege darstellt, erfordert entsprechende Rahmenbedingungen.
Auf der gesellschaftlichen Makroebene ist Geschlecht in die Arbeitsmarktsegregation eingelassen als auch in die Bewertung der einzelnen gesellschaftlichen Sektoren. Pflege als ein weiblich konnotierter Bereich ist deutlich unterbewertet, sowohl in der Vergütung der erbrachten Leistungen des Personals als auch in der Personalausstattung insgesamt. Die für eine angemessene Pflege und damit verbundene Interaktionsarbeit erforderlichen Zeiten stehen jedoch derzeit in der (vollstationären) Pflege nicht zur Verfügung (Rothgang et al. 2020). Insbesondere Zeiten für indirekte Pflege, die für die Dimension der Kooperationsarbeit erforderlich ist, sowie Zeiten zur Reflexion der eigenen Arbeitsbedingungen und Bewältigung der Anforderungen durch Emotionsarbeit, finden bisher bei der Personalbemessung nicht hinreichend Berücksichtigung (Zenz und Becke 2020). Rothgang et al. (2020, S. 324) und Zenz und Becke (2021) empfehlen, systematisch Zeit für Reflexionsräume einzupreisen, die sich einerseits auf die eigenen emotionalen Anforderungen bezieht und zum anderen auf die Rahmenbedingungen zur Erbringung der Versorgungsleistungen.
Die kollektive Befassung mit den Dilemmata in der eigenen Arbeit stellt eine gesundheitsrelevante Ressource dar, da sie die erlebten Unzulänglichkeiten und Verletzungen des Pflegeethos durch schlechte Rahmenbedingungen als solche erkennbar machen, statt diese als persönliches Versagen oder Schuld zu verarbeiten (moral injuries). Letzteres zahlt auch auf das Gestaltungskriterium der Vermeidung widersprüchlicher Anforderungen ein. Insbesondere im Gesundheitssystem sind die Beschäftigten mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert und ‚moral distress‘ (Rennó et al. 2018; Greenberg et al. 2020) ist oft die Folge. Die systematische Unterfinanzierung und Unterbewertung der Pflege bei gleichzeitiger Gewinnorientierung setzt die Pflegekräfte systematisch widersprüchlichen Anforderungen aus.
Gender spielt also sowohl für die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit, Chancengleichheit und Gleichstellung sowie für z. B. die geschlechtergerechte Versorgung der Klient:innen und Patient:innen eine Rolle.
Auf einer strukturellen Ebene sind personennahe Dienstleistungen eine Frauendomäne. Die Sonderauswertung des DGB Index gute Arbeit für Interaktionsarbeit zeigt, dass insbesondere in den Berufen, in denen der Anteil an Interaktionsarbeit sehr hoch ist, überwiegend Frauen arbeiten. Gleichzeitig sind dort die Belastungen und Arbeitsbedingungen im Vergleich zur nicht interaktiver Arbeit erhöht. Einzig die Ressource Sinnhaftigkeit der Tätigkeit liegt hier im Vergleich zur nicht interaktiver Arbeit höher (Roth 2019, S. 25 ff.).
Im Bereich der Interaktionsarbeit zeichnen sich Tendenzen ab (im Folgenden nach Böhle et al. 2015), die einer menschengerechten Gestaltung der Interaktionsarbeit zuwiderlaufen und somit mittelbarFootnote 5 vor allem Frauen treffen.
-
Standardisierung und Entpersonalisierung: Durch tayloristische Standardisierung (McDonaldisierung) und Arbeitsteilung soll die Dienstleistung möglichst der betrieblichen Steuerung und Kontrolle unterworfen werden. Durch eine Entpersonalisierung, bei der die Kund:in die Tätigkeiten selbst übernimmt und die Tätigkeiten der Beschäftigten auf gegenstandsbezogene Tätigkeiten reduziert werden, wird die notwendige Interaktionsarbeit negiert. Dadurch werden die durch Standardisierung auftretenden Probleme verschleiert und entziehen sich der Bearbeitung auf struktureller Ebene, ebenso die damit einhergehenden Belastungen der Beschäftigten.
-
Formalisierung und Objektivierung: unter dem Vorzeichen der indirekten Steuerung und der damit verbundenen Vermarktlichung und Subjektivierung sollen die Beschäftigten zwar eigenverantwortlich handeln, dies jedoch unter der Maßgabe vorgegebener Kennzahlen und Dokumentationspflichten, die ein planmäßig-rationales und objektivierendes Handeln voraussetzen. Subjektivierendes Arbeitshandeln, Gefühls- und Emotionsarbeit lassen sich jedoch nicht durch formale Kategorien und Kriterien dokumentieren. Dies führt dazu, dass die geleistete Interaktionsarbeit nicht wahrgenommen – und somit auch nicht vergütet und anerkannt – wirdFootnote 6. Zumindest im Bereich der Pflege ist mit den Empfehlungen von Rothgang et al. (2020) und der beabsichtigten Anhebung der Personalschlüssel hier eine zentrale Abhilfe in Sicht, die sowohl eine menschengerechte Gestaltung der Interaktionsarbeit ermöglicht als auch Grundlage für eine (gendergerechte) Pflege bildet.
-
Entgrenzung der Interaktionsarbeit und Beschränkung von Ressourcen: Dort wo Kund:innenenorientierung im Mittelpunkt steht, können Beschäftigte trotz hoher Autonomie erhöhten Belastungen durch entgrenzte Erwartungen seitens der Kund:innen ausgesetzt sein. Eine Abgrenzung gegenüber Kund:innen kann als Verweigerung von Kund:innenorientierung durch das Management interpretiert werden (Voswinkel und Korzekwa 2005). Gleichzeitig führen Einsparungen an anderer Stelle zur Einschränkung erforderlicher Ressourcen, die die Bewältigung der Anforderungen unterstützen. So fallen etwa durch Einsparungen von Lagerflächen Rückzugsmöglichkeiten weg, die es den Beschäftigten ermöglichen, sich aus der Interaktion mit dem Kund:innen zurückzuziehen und sich informell unter Kolleg:innen auszutauschen. In der Arbeitsorganisation wäre dementsprechend auf einen Tätigkeitsmix zu achten, der auch Tätigkeiten ohne Kund:innenkontakt beinhaltet sowie eine entsprechende räumliche Ausstattung.
5 Empfehlungen
Um Interaktionsarbeit geschlechtergerecht und gesundheitsförderlich zu gestalten, ist vor allem auf einer übergeordneten (gesundheitspolitischen) Ebene dafür Sorge zu tragen, dass die wesentlichen und tatsächlichen Anforderungen an Interaktionsarbeit mit arbeitsanalytischen Verfahren erfasst und entsprechend monetär bewertet werden. Hier geht es um die Aufwertung von typischerweise von Frauen verrichteten Tätigkeiten. Beispielsweise richtet sich die Aufwertung von Pflegearbeit nicht nur auf die Bezahlung der dort Beschäftigten, sondern auch auf die Personalausstattung und die damit einhergehende Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Zu letzteren würde auch die realistische Einschätzung von Dokumentationsaufwänden zählen, die in die Personalbemessung einfließen müssten. Ebenso sollten die Arbeitsschutznormen, die bisher primär an der Produktion und männerdominierten Tätigkeiten ausgerichtet sind, ein entsprechendes Schutzniveau für Interaktionsarbeit absichern.
Auf der organisationalen Ebene müssten die Kriterien für die menschengerechte Gestaltung von Interaktionsarbeit in die Verfahren und Instrumente des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Eingang finden. Insbesondere die Aspekte „Gebrauchswert für die Kund:in“ und „Vermeidung widersprüchlicher Anforderungen“ sind zunächst Leitlinien, mit denen sich auch das Management und die verschiedenen Führungsebenen auseinandersetzen müssen. Sie sind es, die im Rahmen der Ausgestaltung von Controllingsystemen und Kennzahlen Handlungs- und Entscheidungsspielräume gewähren oder verhindern.
Für die konkrete Ausgestaltung der Interaktionsarbeit sind relevant:
-
Handlungs- und Entscheidungsspielräume
-
Professionelle Autonomie und Selbstverantwortung der Beschäftigten
-
Rückzugsräume, Phasen ohne Kund:innenkontakt
-
Raum für informellen Austausch unter Kolleg:innen.
Das Gesundheitsmanagement selbst sollte partizipativ angelegt sein, um so die Belange und Einschätzungen der Beschäftigten auch zu erfassen und tragfähige Lösungen für den Alltag zu entwickeln. Die Einrichtung von Projektgremien (Lenkungs- Steuerungsgruppen, Projektgruppen, Gesundheitszirkel etc.) sollte eine entsprechende Repräsentanz der Geschlechter und Tätigkeitsgruppen gewährleisten, um Marginalisierungen durch dominante Gruppen zu verhindern und die Unterrepräsentanz von Frauen insbesondere in Entscheidungspositionen auszugleichen.
Insbesondere für den Umgang mit bestehenden widersprüchlichen Anforderungen sind gruppenbezogenen Reflexionsräume eine zentrale gesundheitliche Ressource und dienen der emotionalen Bewältigung (,Schwatz-Rounds‘).
Das Gesundheitsmanagement sollte zudem systematisch Kommunikationsanlässe schaffen, um bestehende Regeln wie Vorgaben zur Emotionsregulation und Gefühlsdarstellung zur Kund:innenorientierung aus gesundheitlicher Perspektive zu reflektieren und anzupassen. Die bestehenden Regeln sollten den Beschäftigten die entsprechenden Spielräume gewähren, um sich gegen ausufernde Ansprüche abgrenzen zu können. Dies kann zudem durch entsprechende Trainings in der Gesprächsführung unterstützt werden. Für den Bereich der Pflege liegen bereits Leitfäden für eine geschlechtersensible Gefährdungsbeurteilung vor, die explizit die Geschlechtsrollenerwartungen integriern (Nielbock und Gümbel 2020).
Zu den widersprüchlichen Anforderungen gehört aus einer Genderperspektive vor allem die Beachtung des bestehenden Strukturkonflikts zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Fürsorgearbeit. Davon sind nach wie vor überwiegend Frauen betroffen. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind dringend angezeigt – institutionelle Kinderbetreuung, Beratung und Unterstützung in der Pflege Angehöriger und eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung. Damit einher geht auch die Möglichkeit für Frauen, Vollzeit zu arbeiten.
Es bleibt zu wünschen, dass diese Form der gesellschaftlichen Organisation von Care- und Interaktionsarbeit im Zuge einer Ausweitung der Dienstleistungsarbeit eine gesellschaftliche Hinterfragung und Reflektion erfährt – und entsprechend aufgewertet wird.
Notes
- 1.
Typische Beispiele, in denen Gender schon früh unter dem Stichwort Sexualisierung von Arbeit oder Sexualität in Organisationen thematisiert wurde, finden sich bei Hochschild (1983) zur Arbeit der Flugbegleiter:innen oder bei Hearn et al. (1989), die sich mit Sexualität in Organisationen auseinandergesetzt haben, ebenso bei Joan Acker, die 1990 das Konzept der gendered organizations einführte.
- 2.
Hanrahan (1997) zeigt anschaulich, wie selbstverständlich sexuelle Belästigung als „Teil des Jobs“ wahrgenommen wird. Krankenschwestern erleben sexuelle Belästigung als Alltagsphänomen und schildern z. B., wie Ärzte sie zu sexuellen Handlungen auffordern. Dies benennen sie als üblich und Teil ihres Jobs.
- 3.
vgl. hierzu im Überblick Gamsjäger 2010 zur Verortung sexueller Belästigung als Form männlicher Dominanz und zur Ausgrenzung von Frauen aus männerdominierten Bereichen und höheren Positionen, als Kompensation von Miderwertigkeitsgefühlen.
- 4.
Wenngleich professionelle Rollen Geschlechterrollen auch neutralisieren oder in den Hintergrund treten lassen können, wie in der Arzt-Patienten-Beziehung, in der z. B. Fragen der Scham suspendiert werden. Auch die Rolle als Patient:in fördert eine Neutralisierung der Geschlechterrollen (Heusinger und Dummert 2017).
- 5.
Als mittelbare Diskriminierung definiert das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine Benachteiligung, die durch scheinbar neutrale Vorschriften, Regeln und Verfahren zustande kommt. Dafür ist es unerheblich, ob dies absichtlich geschieht.
- 6.
Literatur
Acker, Joan. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender & Society 4(2): 139–158.
Acker, Joan. 2010. Geschlecht, Rasse und Klasse in Organisationen – die Untersuchung von Ungleichheit aus der Perspektive der Intersektionalität. Feministische Studien 28 (1): 86–98.
Aulenbacher, Brigitte. 2018. Care und Care Work – Eine neue Stufe ihrer Vergesellschaftung. Feministische Studien – Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung 1:78–91.
Becke, Guido and Peter Bleses (Hrsg.). 2015. Interaktion und Koordination. Wiesbaden: Springer VS. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-658-02460-4.
Böhle, F., Stöger, U. und M. Weihrich. 2015. Wie lässt sich Interaktionsarbeit menschengerecht gestalten? Zur Notwendigkeit einer Neubesimmung. AIS-Studien 1: 37–54. https://doi.org/10.21241/ssoar.64813.
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 2020. Auf den Weg zur Entgeltgleichheit von Frauen und Männern – Daten, Ursachen, Maßnahmen. Berlin. https://www.bmfsfj.de/resource/blob/159872/c10d77c1198719376488fb63e67514c5/auf-dem-weg-zur-entgeltgleichheit-von-frauen-und-maennern-deutsch-data.pdf (Letzter Zugriff 05.04.2021).
Dunkel, Wolfgang und Rieder, Kerstin. 2003. “Working Gender” – Doing Gender als Dimension interaktiver Arbeit. Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. ISF München. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-235507.
Eichler, Margrit. 1998. Offener und verdeckter Sexismus. Methodisch-methodologische Anmerkungen zur Gesundheitsforschung. In Frauen und Gesundheit(en) in Wissenschaft, Praxis und Politik, Hrsg Arbeitskreis Frauen und Gesundheit, 34–49. Bern: Verlag Huber.
Erickson, Rebecca J. and Christian Ritter. 2001. Emotional Labor, Burnout, and Inauthenticity: Does Gender Matter? Social Psychology Quarterly 64, Nr. 2: 146–163.
Finke, Claudia, Dumpert, Florian und Martin Beck. 2017. Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine Ursachenanalyse auf Grundlage der Verdienststrukturerhebung 2014. Hrsg Statistisches Bundesamt, WISTA Nr. 2–2017.
Goffman, Erving. 2001. Das Arrangement der Geschlechter. In Goffman, Erving, Interaktion und Geschlecht, 105–158. Frankfurt/M.: Campus.
Goldmann, Monika 2002. Geschlechtsspezifische Auswirkungen der Globalisierung in den Bereichen Waren und Dienstleistungen, Arbeitsmärkte und Wissens- und Informationsgesellschaft. Dortmund: Deutscher Bundestag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-10180-2_4.
Greenberg, Neel, Docherty, Mary, Gnanapragasam, Sam and Simon Wessely. 2020. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic. BMJ, 368, m1211. https://doi.org/10.1136/bmj.m1211.
Hanrahan, Patricia M. 1997. How Do I Know if I’m Being Harassed or if This Is Part of My Job?? Nurses and Definitions of Sexual Harassment. NWSA Journal 9(2): 43–63. https://www.jstor.org/stable/4316505 (Letzter Zugriff 10.3.2021)
Hausmann, Ann-Christin, Kleinert, Corinna und Kathrin Leuze. 2015. Entwertung von Frauenberufen oder Entwertung von Frauen im Beruf? Eine Längsschnittanalyse zum Zusammenhang von beruflicher Geschlechtersegregation und Lohnentwicklung in Westdeutschland. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 67: 217–242.
Hearn, Jeff, Sheppard, Deborah. L., Tancred-Sheriff, Peta and Burrell, Gibson (Ed.). 1989. The sexuality of Organization. London/Newbury Park/New Delhi: Sage.
Heusinger J., und S. Dummert. 2017. Scham und Nacktheit bei der Körperpflege im Heim. Heilberufe 69(4):16–18. https://doi.org/10.1007/s00058-017-2720-z.
Hirschauer, Stefan. 1994. Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit. Kölner Zeitschrift für Sozialpsychologie 46(4): 668–691.
Hochschild, Arlie Russel. 1979. Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology 85(3): 551–575.
Hochschild, Arlie Russel. 1983. The Managed Heart: commercialization of human feeling. Berkeley: Univ. of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520951853-fm.
Knapp, Gudrun-Axeli. 1995. Unterschiede machen. Zur Sozialpsychologie der Hierarchisierung im Geschlechterverhältnis. In Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften, Hrsg Regina Becker-Schmidt und Gudrun-Axeli Knapp, 163–194. Frankfurt/Main, New York: Campus.
Knapp, Gudrun-Axeli. 2011. Gleichheit, Differenz, Dekonstruktion und Intersektionalität: Vom Nutzen theoretischer Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung für die gleichstellungspolitische Praxis. In: Chancengleichheit durch Personalpolitik: Gleichstellung von Frauen und Männern in Unternehmen und Verwaltungen, Hrsg Gertraude Krell, Renate Ortlieb und Barbara Sieben 14:71–82. Gabler. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6838-8_6
Krüger, Helga. 1995. Dominanzen im Geschlechterverhältnis: Zur Institutionalisierung von Lebensläufen. In Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften, Hrsg Regina Becker-Schmidt und Gudrun-Axeli Knapp (Hrsg.), 195–219. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Lottmann, Ralf. 2020. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Altenhilfe – Intersektionale Perspektiven und die Relevanz von Situationen und Kontexten. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 53(3):216–221. https://doi.org/10.1007/s00391-020-01704-7.
Nielbock, Sonja und Michal Gümbel. 2012. Die Last der Stereotype. Edition der Hans Böckler Stiftung 267. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung.
Nielbock, Sonja. 2013. Geschlechtersensibler Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Altenpflege. http://www.sujet.org/download/20130600_Geschlecht_Arbeits_Gesundheitsschutz.pdf (Letzter Zugriff: 23.3.2022).
Nielbock, Sonja und Michael Gümbl. 2020. Arbeitsbedingungen beurteilen – geschlechtergerecht. https://gender.verdi.de/++file++5df8b9e0f43c87cb92a6d1e4/download/Genderstress_Arbeitsbedingungen-beurteilen_Auflage-01-2020.pdf (accessed: 24. March 2022).
Rennó, Heloiza Maria Siqueira, Ramos Flávia Regina Souza and Maria José Menezes Brito. 2018. Moral distress of nursing undergraduates:Myth or reality? Nursing Ethics 25 (3):304–312. DOI: https://doi.org/10.1177/0969733016643862.
Robert Koch-Institut (RKI). 2005. Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit. Expertise des Robert Koch-Institutes zm 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/Armut.pdf%3F__blob%3DpublicationFile (Letzter Zugriff 21.2.2022).
Roth, Ines. 2019. Arbeit mit Menschen – Interaktionsarbeit. https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++c549a084-62d2-11ea-8e05-52540088cada (Letzter Zugriff: 23.3.2022).
Rothgang, Heinz (Hrsg.). 2020. Abschlussbericht im Projekt Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM). DOI: https://doi.org/10.26092/elib/294.
Schwinn, Thomas. 2008. Zur Analyse multidimensionaler Ungleichheitsverhältnisse. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 1:20–30.
Stiegler, Barbara. 2000. Wie Gender in den Mainstream kommt. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Thorein, Anke, Nadine Müller, und Michael Fischer. 2020. Interaktionsarbeit – Notwendigkeit von Forschung und Gestaltung aus gewerkschaftlicher Sicht. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 74(1): 4–8.
Voswinkel, Stephan, und Anna Korzekwa. 2005. Welche Kundenorientierung? Anerkennung in der Dienstleistungsarbeit. Berlin: Edition Sigma.
West, Candace and Don H. Zimmerman. 1987. Doing Gender. Gender & Society 1, Nr. 2 (1. June): 125–151. doi: https://doi.org/10.1177/0891243287001002002.
Zenz, Cora, und Guido Becke. 2020. „Fertig wird man eigentlich nie“ – Zeitpraktiken und -wünsche von Pflegekräften zur Interaktionsarbeit. Überarbeitete und erweiterte Version des iaw-Projektabschlussberichts zur Personalbemessungsstudie. Schriftenreihe Institut Arbeit und Wirtschaft No. 30, Bremen: Institut Arbeit und Wirtschaft, Universität und Arbeitnehmerkammer Bremen.
Zenz, Cora, und Guido Becke. 2021. Gemeinsam stärker! Betriebliche Unterstützungsstrukturen für Beschäftigte in der Langzeitpflege. Bremen: Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW), Universität und Arbeitnehmerkammer Bremen.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Pieck, N., Koppelin, F. (2023). Gender – eine zentrale Kategorie der gesundheitsfördernden Gestaltung von Interaktionsarbeit. In: Becke, G. (eds) Flexible Dienstleistungsarbeit gesundheitsförderlich gestalten. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37055-8_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-37055-8_12
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-37054-1
Online ISBN: 978-3-658-37055-8
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)