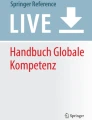Zusammenfassung
Zu ihrem Beginn wurde die Covid-19-Pandemie oft mit historischen Krankheitsausbrüchen verglichen. Im 21. Jahrhundert mit einer weltweiten Seuche konfrontiert zu sein, galt als Anachronismus. Zugleich bezogen sich aktuelle Pandemiepläne auf die Erfahrungen aus der Spanischen Grippe von 1918. Wer historische Seuchenzüge mit heutigen Pandemiegeschehen verglicht, sollte die jeweiligen historischen und ökonomischen Gegebenheiten reflektieren. Maßgeblich ändern sich Sterblichkeit und Morbidität mit den allgemeinen Gesundheitsverhältnissen. Darüber hinaus lässt sich fragen, inwieweit historische Seuchen die Wahrnehmung der darauffolgenden Epidemien und Pandemien prägten, und welche Rolle sie für die initialen Reaktionen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft spielten. Am Beispiel der Pest von 1713 und der Influenza von 1918 diskutiert der Beitrag das Wechselspiel von Ökonomie und Eindämmungsmaßnahmen.
You have full access to this open access chapter, Download conference paper PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- COVID-19
- Spanish Influenza
- Plague
- History of Pandemics and Epidemics
- History of Science
- Historical Epistemology
- Methods of Historical Comparative Research
1 Grenzen des Vergleichs
Eine Pressefrage, die Medizinhistorikerinnen und Medizinhistorikern gerade oft gestellt wird, lautet: „Was lernen wir aus historischen Seuchen?“ Die Frage hat zwei Ebenen: „Was lernen wir als Gesellschaft?“ und „Was lernt die Medizin aus den Seuchen der Vergangenheit?“. Am Ende der Interviews steht für gewöhnlich die Bitte um einen Blick in die Zukunft – verbunden mit der unausgesprochenen Hoffnung, die Antwort werde die baldige Überwindung auch dieser Plage in Aussicht stellen.
Die Befragung von Historikerinnen und Historikern erinnert an den Versuch, die komfortable Position des rückblickenden Beobachters zurück zu erobern, der aus einer sicheren Gegenwart auf die Seuchen der Vergangenheit blickt. Die Facetten einer ähnlichen Perspektive hat Hans Blumenberg in seinem Buch „Schiffbruch mit Zuschauer“ aus dem Blickwinkel der historischen Anthropologie dechiffriert [1]. Die Seuche, als überwundene betrachtet, ist eine das Vertrauen in die moderne Medizin begründende Figur. Die „Rückkehr der Seuche“ (so titelte beispielsweise die Süddeutsche Zeitung im Oktober 2020) erschien als Anachronismus.
Aus medizinischer Sicht ist eine Prognose des aktuellen Geschehens komplex. Neue Mutagene können Übertragungsraten und Pathogenität verändern, welche Impfungen eine sterilisierende Immunität hinterlassen, ist ungewiss und die Akzeptanz der Eindämmungsmaßnahmen variiert. Diese und viele weitere Komponenten können ein vermeintlich gut abschätzbares Geschehen unerwartet beeinflussen. Eine aktuelle Pandemie sollte daher vorsichtshalber nicht so beschrieben werden, als gehöre sie bereits der Vergangenheit an – so sehr selbst Qualitätsmedien die Vorstellung verbreiten, COVID-19 werde nach Einführung einer Impfung verschwinden.
Ebenso führt es oft in die Irre, Seuchenzüge mit heutigen Pandemiegeschehen gleichzusetzen, ohne zugleich die historischen Gegebenheiten zu reflektieren. Veränderte gesellschaftliche und ökonomische Grundlagen, andere diagnostische Nachweismethoden und sogar die statistische Dokumentation können einer Krankheit mit ein und demselben Erreger sehr unterschiedliche Dynamiken verleihen.Footnote 1 Das zeigt bereits ein flüchtiger Blick in die jüngste Vergangenheit. Eine breite Testung mit PCR Direktnachweis wäre vor 30 Jahren aus technischen Gründen nicht – und zur Zeit des ersten Auftretens von SARS aus ökonomischen Zwängen nur sehr eingeschränkt möglich gewesen.Footnote 2 Die Abwesenheit dieses heute gängigen Nachweissystems hätte zu einer komplett anderen Aufzeichnung des aktuellen Pandemiegeschehens geführt: Es ist nicht lange her, als Inzidenzen am zuverlässigsten auf der Basis von Hausarztkontakten von Patienten mit Atemwegsbeschwerden errechnet wurden.Footnote 3 Auch die Entwicklung der im Prinzip seit 120 Jahren verfügbaren Antikörpertests hätte Zeit benötigt. Beispielsweise lagen bei AIDS vier Jahre zwischen der Klärung der Krankheitsentität und der Zulassung des ersten ELISA-Tests auf HIV.
Weitere Beispiele skizzieren die bedingte Vergleichbarkeit der aktuellen Corona-Zeit mit den Jahren der Spanischen Grippe:
Das Thema Vorerkrankungen beherrschte zu Beginn der COVID-19-Pandemie die Debatte über Todesursachen. Vor 100 Jahren waren Patienten ohne Vorerkrankungen selten. Prägnant lässt sich das am Beispiel der Masern verdeutlichen. Glauben wir den Todesursachenstatistiken der 1920er Jahre, starb an den Masern jeder fünfzigste Kranke – heute ist es jeder fünfhundertste Infizierte. Aber heute zeigt eben auch nicht mehr jedes dritte Kind in einer Großstadt bei der Schuleingangsuntersuchung Stigmata der Rachitis, und die Durchseuchung mit Tuberkulose liegt nicht mehr bei über 90 %, wie hierzulande noch 1948. Kam ein solchermaßen geschwächtes Kind in ein Krankenhaus, infizierte es sich fast regelhaft mit den Masern, was oft ein Todesurteil war.
1922 unternahm der Münchener Kinderarzt Rudolf Degkwitz den Versuch, Neuaufnahmen auf seine Station Vollblut gerade genesener Masernpatienten intramuskulär zu spritzen. Das Prinzip des Rekonvaleszenten-Serums immunisierte sie für die Dauer ihres Aufenthalts [7]. Zu einer ähnlichen Methode griffen Medizinerinnen und Mediziner in Wuhan und dann in Bergamo, wo sie im Frühjahr 2020 versuchsweise Rekonvaleszenten-Serum aus China verwendeten. Die Maßnahme erscheint ähnlich hemdsärmelig wie 98 Jahre zuvor, wenn sie eventuell auch nicht so erfolgreich war.
Eine weitere Falle liegt in der Begrifflichkeit. Im Deutschen Reich des Jahres 1918 wurde Richard Pfeiffer (1848–1945), ein Schüler Robert Kochs, als „der Entdecker des Influenzabazillus“ gefeiert [8], den er nach allen Regeln der Koch-Henle‘schen Postulate als Grippeerreger nachgewiesen hatte. Dementsprechend begann 1918 die wissenschaftliche Auseinandersetzung über die „spanischen Krankheit“ mit der Debatte, ob es sich denn wirklich um eine Influenza handele.Footnote 4 Der Kinderarzt Paul Selter (1866–1941) und der Pathologe Walter Kruse (1864–1943) vermuteten früh, dass der Erreger der Grippe zur „Gruppe der filtrierbaren Virus“ gehöre [9]. 1918 stand Latein hoch im Kurs, und die einzige Möglichkeit mithilfe der damaligen Methoden mikrobiologische Strukturen unterhalb der Sichtbarkeitsschwelle der Lichtmikroskopie nachzuweisen, war die Ultrafiltration infizierter Körperflüssigkeiten und der anschließende Versuch einer Infektion von Versuchstieren.
Der eingangs gestellten Frage geht dieser Beitrag nach, indem er am Beispiel der Spanischen Grippe kurz und am Beispiel der Pest von 1712/13 etwas ausführlicher Parallelen und Diskontinuitäten aufzeigt, die wissenschaftliche und öffentliche Auseinandersetzungen mit Seuchen beeinflusst haben. Denn es lässt sich durchaus fragen, inwieweit historische Seuchen die Wahrnehmung der darauffolgenden Epidemien und Pandemien prägten, und welche Bedeutung das für die Reaktionen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft spielte.
2 Spanische Grippe
Lexika und medizinische Publikationen der 1830er Jahre schilderten die in Europa neu aufgetretene „asiatische Cholera“ wie einen Pestzug, der entlang der Handelswege verläuft oder bei Kriegen den Truppenbewegungen folgt.Footnote 5 Die aktuelle COVID-19-Pandemie wird mit der A/H1N1 Influenza in Analogie gesetzt, die in den Jahren 1918 bis 1920 pandemisch war [11].Footnote 6 Das Framing dafür begann bereits vor 15 Jahren mit der genetischen Identifikation des Virus durch Jeffrey Taubenberger am Walter Reed Hospital, der die Influenza von 1918 im Jahr 2006 zur „Mutter aller Pandemien“ erklärte [12]. Tatsächlich wurde die Spanische Grippe zum Modell, insbesondere in Hinblick auf globale Ausbreitungswege, für die Wirkung von Eindämmungsmaßnahmen sowie für das Wissen um den Wechsel von Tier auf Mensch und umgekehrt.
Das führte dazu, dass 100 Jahre alte Erfahrungsberichte den Alltag im Frühjahr 2020 mitbestimmten. Der wissenschaftliche Teil des 2017 zuletzt aktualisierten Pandemieplans des Robert Koch-Instituts bezieht sich explizit auf Daten aus der Zeit der Spanischen Grippe [13]. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dienten die Neuinfektionskurven der Städte St. Louis und Philadelphia (die eine Kommune hatte 1918 Massenvergnügen untersagt, die andere nicht), um Politik und Öffentlichkeit die Effektivität von Eindämmungsmaßnahmen zu erklären. Auch die Prognose einer „zweiten Welle“ bot sich auf Grundlage der historischen Daten an.
Anthony Fauci hatte bereits 2007 gefragt, welche Erkenntnisse die Influenza von 1918 für das 21. Jahrhundert liefern könne. Euphemistisch stellte er in Aussicht, dass ein neues, ebenso pathogenes Virus durch den Einsatz aggressiver Public-Health-Maßnahmen heute deutlich weniger Todesopfer fordern werde.Footnote 7 Auch Fauci konnte nicht in die Zukunft blicken. Zumindest gegen die COVID-19-Pandemie gestattete die politische Realität in den USA den Einsatz effektiver Präventionsmaßnahen auf föderaler Ebene bis Ende Januar 2021 nicht.
Wo das Wissen über die Influenza zur Bändigung der COVID-19-Pandemie beiträgt, und in welchen Nuancen es uns auf falsche Fährten setzt, lässt sich noch nicht abschließend bewerten. Dieser Beitrag muss sich darauf beschränken, die Wahrnehmung von Seuchen in ihrer Zeit darzustellen. Aber er kann Muster offenlegen, die auch der Reflexion der aktuellen Lage dienen.
3 Pest in Hamburg 1712/1713
Als ein Beispiel für die Rolle ökonomischer Erwägungen bei der Eindämmung einer Seuche kann die 1712 und 1713 in Hamburg grassierende Pest dienen. Woran ließe sich das besser verdeutlichen als an einem Geldstück (Abb. 1).
Der abgebildete Portugaleser wurde 1714 nach dem Ende der Pest in Hamburg geprägt [15]. Der Stamm des Baums trägt das Wappen der Stadt, die Hauptäste die Namen der fünf Hamburger Kirchengemeinden. Sie sind angeordnet, wie aus der Perspektive des Hamburger Rathauses betrachtet. Der Tod hat Zweige abgeschnitten, die zu Boden fallen. Nun wendet er sich elbabwärts zum Gehen. Auf der gegenüberliegenden Seite tritt die Bevölkerung wieder hervor. Der lateinische Sinnspruch in der Umschrift ist fatalistisch. Er lautet: praestat pVtarI qVaM ConCIDI – eher gelichtet als gefällt. Die groß geprägten Lettern sollen als lateinische Zahl 1713 ergeben, zur Erinnerung an das Jahr der Todesfälle (Anni funestri memoria).
Im Zentrum der Rückseite stehen zwei umschwirrte Bienenkörbe. Die Umschrift behauptet: VALENT SI VOLENT – Gesund sind sie, wenn sie fliegen. Im Hintergrund ist rechts der geschäftige Hafen, links der Umschlag von Waren an Land zu erkennen. Die Wege wiederhergestellt, blüht der Handel auf und Hamburg erhebt sich, REDDITIS ITINERIBVS COMMERCIO REDINTEGRATO HAMBVRGVM RESVRGENS, sagen die Buchstaben auf dem Altar unter den Bienenkörben.
Aus Chroniken und Verordnungen stellte der Jurist und Münzensammler Johan Paul Langermann 30 Jahre nach Ende der Pest in seiner Heimatstadt eine „historische Erzählung“ zusammen, in der er die auf den Hamburger Münzen dargestellten Themen beschrieb [16]. Für seine Darstellung der Pest stützte er sich auf eine Chronik Hamburger Ereignisse, die Ratsquellen, Zeitungsberichte und Dokumente aller Art in zeitlicher Reihenfolge, aber ohne inhaltlichen Zusammenhang hintereinander aufgelistet hatte. Die Chronik trug den Titel „Versuch einer zuverlässigen Nachricht von dem kirchlichen und politischen Zustande der Stadt Hamburg in den allerneusten Zeiten“ [17]. Diese Quelle hat den Charme, die Ereignisse weitestgehend aus der Zeit heraus zu zeigen; ein wenig so, wie sich die Lage für diejenigen gesellschaftlichen Gruppen darstellten, die zwar des Lesens mächtig waren und sich mit den offiziell zugänglichen Informationen versorgten, die aber nicht über sogenanntes ‚Herrschaftswissen‘ verfügten. Ein weiterer Vorteil: Der Fokus des Chronisten lag nicht auf der Pest, er listete alle Ereignisse auf, die sich in öffentlichen Verlautbarungen niederschlugen. Für die Frage, was wir aus der Seuchengeschichte lernen, kann der Vergleich zwischen der Pestdarstellung in Langermanns Münzen-Katalog und der Darstellung in seiner Hauptquelle erhellend sein. Legt er doch offen, wie sich der Rückblick auf die Krankheit von ihrer Wahrnehmung in der akuten Phase unterschied.
In der Chronik offen zugänglicher Dokumente taucht der Begriff Pest erst spät auf. Von einer „Läusse-Contagion“ ist die Rede, die mit allen Mitteln bekämpft werden soll. Die Aufnahme von Bettlern wird untersagt. Hände werden kontrolliert. Wer das arglos liest, denkt eventuell erst einmal an Scabies. Dann folgt die Order, wegen sommerlicher Hitze Leichen spätestens nach vier Tagen zu bestatten. Jetzt könnte die retrospektive Diagnose auf Fleckfieber lauten.
Lagermann, dessen Vater Hamburger Ratsherr war, hatte Zugang zu nicht-öffentlichen Quellen. Er ordnet, was in der Chronik Contagion genannt wird, der Pest zu. Nach seiner Schilderung traf am 16. März 1712 ein Scheiben Karls VI. ein, um „die Stadt ernstlich zu ermahnen“, das Einreisen des Übels „sowohl durch Waren, als Briefe in das römische Reich“ zu unterbinden.Footnote 8 Es folgte eine Schließung der nach Dänemark gewandten Stadttore und die Anweisung an die Elbschiffer, ab Stade weder Personen noch Waren an Bord zu nehmen. Vor den Stadttoren wurden ein Lazarett für die Erkrankten und die Leichen, und ein Quarantänehaus für Kontaktpersonen errichtet. „Ganz unvermuthet“, so Langermann, legten am 26. August „ihre Majestät von Dänemark […] einige Regimenter um die Stadt“.Footnote 9 In der Chronik stellt sich dieser militärische Cordon Sanitaire als dänische Aggression aus heiterem Himmel dar. Auch die vielen passagären Schließungen der Stadttore, die in dem Versuch einer zuverlässigen Nachricht als Abwehr feindlicher Horden erscheint, sind bei Langermann eindeutig Maßnahmen der Seuchenbekämpfung. In eine Reihe mit einigen, für die Hafenstadt spezifischen, teilweise von außen aufgezwungenen und mit den vielen selbst veranlassten Eindämmungsmaßnahmen stellte Langermann die Gottesdienste. „Und wegen dieser sehr nahen Gefahr, alle Sonntage eine große Menge Menschen sich des Heiligen Abendmahls bedienten, sodass man am 11. Sonntage nach Trinitatis derer 1100 Personen allein in der neuen Michaeliskirche zählte.“Footnote 10
Rechtzeitig für das Heil der Seele im Jenseits zu beten, konnte zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch als gängigste Präventionsmaßnahme zu Seuchenzeiten gelten. Auch für die auf das Überleben gerichtete Prophylaxe, besaßen die Kirchenkanzeln eine wichtige Funktion. Nur ein geringer Teil der Bevölkerung konnte lesen. Die Pastoren verlasen behördliche Anordnungen. Für die meisten Innenministerien der aufgeklärt-absolutistischen protestantischen Staaten galt, dass sie die ihnen unterstehenden Kirchen zur Übermittlung offizieller Informationen nutzten. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts etablierten sich Nützlichkeitspredigten als zentrales Medium für die Implementierung gesundheitspolizeilicher Anordnungen.Footnote 11
Während der Kirchenbesuch bei Lagermann als eine Pest-Präventionsmaßnahme unter vielen erscheint, erfahren die Leser des „Versuchs einer zuverlässigen Nachricht“ (und nach meiner Interpretation auch die meisten Einwohner der Stadt) nun erstmals vom Ernst der Lage. Die Chronik zitiert eine Tafel, die an allen Zugängen der Stadt aufgehängt wurde, und jedem mit Strafe, „an Leib und Leben“ drohte, „wer von Oertern, so wegen der Contagion verdächtig, kommen“, oder die Stadt ohne Pass betrat. Unter dem Pass war kein dauerhaftes Personaldokument zu verstehen. Der Begriff hatte seinen Ursprung in den seuchenpolizeilichen Maßnahmen oberitalienischer Hafenstädte und leitete sich von passa porto her, der Erlaubnis, den Hafen zu verlassen. Ein solcher Passierschein führte den Händler, seine Waren und sein Gesinde auf. Die folgenden Einträge der Chronik berichteten mal von geöffneten, mal von geschlossenen Stadttoren. Gebete waren die erste aktive Maßnahme im Stadtinneren, die für Laien eindeutig der Seuche zuzuordnen war: „Weil sich die Contagion an vielen nahe liegenden Orten hervorthat, so fieng man den 15. Augusti Bet-Stunden zu halten an, und fuhr alle Montage damit fort.“Footnote 12
Der Aspekt der Aufklärung im Sinne eines rationalen, an Beobachtung und Statistik geschulten Gemeinwesens ist im Hamburg der Pestjahre 1712 und 1713 noch nicht besonders hoch zu bewerten. Die Spielart der Moderne, Methoden der Kameralistik auf das Gemeinwesen anzuwenden, wird sich in Deutschland erst langsam im Zuge der Napoleonischen Kriege etablieren.
Nicht nur, dass die Aufrufe, sich in den Kirchen zum Abendmahl einzufinden, als Gegenmaßnahme zur Pest galten; auch die Drangsalierung der Hamburger Juden belegt die Persistenz mittelalterlicher Ressentiments. „Keine Juden, unter welchen Vorgaben es auch sey, sollten in die Stadt herein, noch die Einheimischen ohne Pass hinaus gelassen werden“,Footnote 13 heißt es in einer frühen, bereits 1709 erlassenen Pestverordnung. Für die Hamburger Juden, die von der Krankheit ebenso betroffen waren wie die Gesamtbevölkerung, bedeutete das, ihre Toten nicht mehr auf den bisherigen Begräbnisplätzen in Altona, Ottensen und Wandsbek außerhalb der Stadttore bestatten zu können [19]. Die Anlage des innerhalb der Stadtmauern gelegenen Friedhofs am Grindel stammt aus dieser Zeit.
Der Numismatiker Langermann führte den judenfeindlichen Passus 1753 unkommentiert in seine Liste der Maßnahmen des Hamburger Raths, die er allesamt lobend hervorhebt. Noch 1803 findet sich das unverändert in Nachdrucken. Katholische Schriften attribuierten den Judenhass in Verbindung mit der Pest bereits allein ‚untere‘ Bevölkerungsschichten. So in einer Kirchengeschichte von 1752, die die Kölner Pogrome von 1348 anspricht: „Zu dieser Zeit hatte der Pöbel die Juden in Verdacht, als wenn sie die Brunnen vergiftet und dadurch die Pest in das Land gezogen hätten (…). Diese Wuth wider die Juden erstreckte sich weit in Deutschland, zu Avignon aber war dergleichen nicht zu spüren, denn der Papst ließ deswegen 2 Bullen ergehen.“ [20].
Die erste Bulle verbot die Gewalttaten „bei Straff der Excommunication“, die zweite Bulle interpretierte der Chronist des 18. Jahrhunderts als eine auf Beobachtung basierende Begründung, er schrieb: „Man habe keine Ursache, die Juden zu beschuldigen dass sie die Ursach der Pest wären, die weil sie auch in solchen Ländern zu finden, wo keine Juden zu finden.“Footnote 14
Die Hamburger Goldmünze ist eine eigenständige Quelle. Ungewöhnlich war es nicht, an negative Ereignisse, wie Hungersnöte, Brände, Naturkatastrophen und eben auch Krankheitsausbrüche mit Münzen zu erinnern. Geprägt wurde bisweilen, weil auf die Ereignisse fast immer eine Teuerung folgte, die mit der Beschaffung von Zahlungsmitteln einherging. Die aus Anlass von Hungersnöten entworfen Motive wurden fast immer in billiges Metall geprägt. Offizielles Zahlungsmittel wurden sie nur selten. Doch ihr unübersehbares Motiv, das Fortbestehen der göttlich gegebenen staatlichen Ordnung über die Katastrophe hinweg zu betonen, haben sie mit den offiziellen Münzen gemeinsam.
Der Portugaleser ist eine von mindestens zehn Münzen, die der Hamburger Rat 1713/1714 in Erinnerung an die Pest prägen ließ [21, 22]. Damit machen die Hamburger Münzen ein Drittel der in deutschsprachigen Städten geprägten Pest-Münzen und Medaillen dieser Jahre aus. Der beschriebene Bank-Portugaleser besaß den Charakter eines offiziellen Zahlungsmittels. Sein wertvolles Material stand im Gegensatz zu den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie, die eine Hafenstadt weitaus stärker getroffen haben muss als andere Städte des Reichs. Das Motiv des Todes, der den Baum nur ausschneidet, und der dazugehörige Text „eher gelichet/geordnet als gefällt“ täuscht darüber hinweg, dass die Stadt je nach Schätzung bis zu 15 % seiner Einwohner durch die Seuche verlor. Doch Langermann wies darauf hin, „daß dieses Sterben meistentheils nur geringe Leute betroffen“ habe. Die Umschrift bezog sich also drauf, dass „dadurch niemand aus einem Hochedl. u. Hodiw. Rath, dem Wohlehrw. Predigt-Amte, u. andern bürgerl. Collegiis, aufgerieben worden“ sei.Footnote 15
Wegen der laxen Regeln der Seuchenbekämpfung hatte es der Hamburger Rat schwer, das Ende der Seuche glaubhaft zu machen. Die „benachbarten hohen Potentaten“ schickten regelmäßig Offiziere, Chirurgen und Mediziner nach Hamburg um die Lage zu erkunden.Footnote 16 Daraufhin beschloss der Rat am 27. August 1713, jeden Freitag in jeder Zeitung der Stadt verkünden zu lassen, „wie viel Menschen in der verflossenen Woche gestorben wären.“Footnote 17 Was für ein bemerkenswerter Schritt das war, lässt sich kaum überschätzen: Knapp einhundert Jahre vor der Einführung regulärer Bevölkerungsstatistiken erfasst Hamburg Zahlen zur Sterblichkeit und veröffentlich sie, um seine Rolle als Hafen- und Handelsstadt wieder herzustellen. Auch wenn es so scheint, als habe hier begonnen, was wir heute als tägliche veröffentlichte Corona-Zahlen und Sieben-Tage-Inzidenzen von den Websites deutscher Kommunen kennen – damals geschah die Veröffentlichung nicht als Teil von Eindämmungsmaßnahmen, sondern allein aus wirtschaftlichen Erwägungen. Sie war ebenso eine Werbemaßnahme, wie die prächtige Goldmünze.
Erhalten sind die offiziellen Chroniken und das Goldstück. Sie sicherten denjenigen die Deutungsmacht über den Ablauf der Pest in Hamburg, die beide Quellen geprägt hatten.
Auch der Blick auf die aktuelle Pandemie wird durch diejenigen bestimmt, die sie aufzeichnen. Der Vielfalt publizistischer Zeugnisse stehen die medizinischen Aufzeichnungssysteme gegenüber: Inzidenzen und Kurven, basierend auf PCR- und Antigentests. Innerhalb des ersten Jahres der Pandemie unterlagen auch diese Daten einer beachtlichen Veränderung. Die ermittelte Sterblichkeit korrelierte mit der Verfügbarkeit diagnostischer Tests. Und sie fiel anders aus, wenn Pathologinnen und Pathologen die Todesursache untersuchten. Dass einige Mutationen zuerst aus Großbritannien gemeldet wurden, lag auch daran, dass dort ein nationales Versicherungssystem regelmäßige Extratestungen zu Forschungszwecken begünstigt. Auf dem langen Weg zu einer endemischen Kinderkrankheit wird sich die Wahrnehmung von COVID-19 in Medizin und Gesellschaft weiter verändern. Die anfangs zur Einordnung gezogenen Parallelen zur Influenza werden in den Hintergrund treten.
Notes
- 1.
Exemplarisch für die zeitgenössische Einordnungen historischer Diagnosen steht das Buch [2]. Ein Überblick zur Wahrnehmung und Deutung der Pest im historischen Wandel findet sich bei [3]: Zu den Fallstricken, die sich aus der Übertragung historischer Diagnosen in die Gegenwart ergeben, vergleiche [4].
- 2.
Zur Vorgeschichte der MassTag-PCR vgl. das Kapitel über Szintillationsmaschinen in: [5].
- 3.
Cornelius Borck beschreibt, wie eng auch Unkenntnis mit biomedizinischer Forschung verschränkt ist [6].
- 4.
„Die ‚spanische Krankheit‘ tritt gegenwärtig in Berlin und Umgegend in recht erheblicher Verbreitung auf (…) Einen wesentlichen Unterschied gegenüber der Influenza konnten wir bis jetzt nicht feststellen; das Fehlen von Influenzabazillen ist etwas, was zahlreichen Epidemien ohne starke Bronchitiden eigen war, und die Krankheit noch nicht zu etwas besonderem macht. Doch ist diese Frage noch nicht geklärt“, heißt es beispielsweise in einem Editorial der Klinischen Wochenschrift [8].
- 5.
Eine der ausführlichsten zeitgenössischen Zusammenfassungen findet sich ohne Verfasserangabe in Brüggemanns Lexikon [10].
- 6.
Das Interview wurde am 20. Mai 2020 geführt.
- 7.
„Wenn ein neues Virus, ebenso pathogen wie jenes von 1918 heute zurückkehren würde, könnte potentiell ein substantieller Anteil der potentiell 1,9 Millionen Todesfälle mit aggressiven Public-Health-Maßnahmen und medizinischen Interventionen verhindert werden“ [14].
- 8.
Langermann 1753 [16], S. 256.
- 9.
Langermann 1753 [16], S. 262.
- 10.
Ebendort.
- 11.
So beispielsweise bei der Einführung der Pockenimpfung, vgl. [18].
- 12.
Versuch einer zuverlässigen Nachricht [17], S. 249.
- 13.
Langermann, 1753 [16], S. 252.
- 14.
Plockh, 1742 [20], S. 299.
- 15.
Lagermann 1753 [16], S. 263.
- 16.
Langermann 1753 [16] S. 264.
- 17.
Versuch einer zuverlässigen Nachricht [17], S. 327.
Literatur
Blumenberg, H.: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt a. M. (1979)
Stolberg, M.: Homo patiens. Krankheits- und Körpererfahrung in der Frühen Neuzeit. Köln/Weimar/Wien (2003)
Jankrift, K.P.: Vom Pesthauch zu Yarsinia Pestis. In: Leenen, S., Berner, A.M., Sandra Mölders, D. (Hrsg.) Pest. Eine Spurensuche, S. 20–29. Darmstadt (2019)
Leven, K. H.: Krankheiten: historische Deutung versus retrospektive Diagnose. In: Paul, N., Schlich, T. (Hrsg.) Medizingeschichte: Aufgaben. Probleme. Perspektiven, S. 153–185. Frankfurt a. M. (1998)
Rheinberger, H.-J.: Epistemologie des Konkreten. Studien zur Geschichte der modernen Biologie, S. 245–292. Frankfurt a. M. (2006)
Borck, C.: Vom Unwissen in Zeiten von Corona. Logos. Z. Kulturphilosophie 14(2), 101–110 (2020)
Degkwitz, R.: Ueber Masernschutzserum. Deut. Med. Wochenschr. 48, 6–27 (1922)
Tagesgeschichtliche Notizen. Berl. Klin. Wochenschr. 55, 320 (1918)
Selter, P.: Zur Ätiologie der Influenza. Deut. Med. Wochenschr 44, 932–933 (1919)
Cholera. In: Neuestes Conversationslexikon für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet, Bd. 2, S. 110–116. Leipzig (1833)
Wolters, S.: Die zweite Welle. Auch frühere Pandemien flammten überraschend wieder auf. https://www.zeit.de/video/2020-06/6167741788001/corona-massnahmen-die-zweite-welle. Zugegriffen: 20. Nov 2020
Taubenberger, J.K., Morens, D.M.: 1918 Influenza: The mother of all pandemics. Emerg. Infect. Dis. 12(1), 15–22 (2006)
Robert Koch-Institut (Hrsg.): Nationaler Pandemieplan Teil II – Wissenschaftliche Grundlagen, S. 14 ff. Berlin (2016)
Morens, D.M., Fauci, A.S.: The 1918 influenza pandemic: insights for the 21st century. J. Infect. Dis. 195(7), 1018–1028 (2007)
Wiechmann, R.: Das Ende der Pest in Hamburg. In: Leenen, S., Berner, A., Maus, S., Mölders, D. (Hrsg.) Pest! Eine Spurensuche. 20. September 2019 – 10. Mai 2020, S. 572–573. LWL-Museum für Archäologie, Westfälisches Landesmuseum Herne, Darmstadt (2019)
Langermann, J.P.: Hamburgisches Münz- und Medaillen-Vergnügen oder Abbildung und Beschreibung Hamburgischer Münzen und Medaillen welchem ein Verzeichniß gedruckter Hamburgischer Urkunden, Documente und andere Briefschaften auch nöthige Register beygefüget worden. Hamburg (1753)
Beschluß des Versuchs einer zuverlässigen Nachricht. Von dem kirchlichen und politischen Zustande der Stadt Hamburg in den allerneusten Zeiten, nehmlich von Kaiser Josephs des I. biß auf die Zeiten Kayser Carls des VI. Erste Abtheilung, Hamburg (1739)
Wolff, E.: Einschneidende Maßnahmen. Pockenschutzimpfung und traditionale Gesellschaft in Württemberg des frühen 19. Jahrhunderts (=Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beiheft 10). Stuttgart (1998)
Heckscher, I.: Zur Geschichte Des Grindelfriedhofes in Hamburg. Mitt Jüdischen Volkskunde 22, 43–47 (1907)
Plockh, J.J.: Güldener Denck-Ring, Göttlicher Allmacht und Menschlicher Thaten so lang die Welt stehet. 25. Theil. Augsburg (1742)
Pfeiffer, L., Ruhland, C.: Pestilentia in nummis: Geschichte der grossen Volkskrankheiten in numismatischen Dokumenten. Tübingen (1882)
Kolze, M.: Hamburgs Sieg über den „Schwarzen Tod“. In: Wiechmann, R.; Grolle, J. (Hrsg.) Geprägte Geschichte. Hamburger Medaillen des 17. und 18. Jahrhunderts, S. 258–273. Hamburg (2014)
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die nicht-kommerzielle Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die Lizenz gibt Ihnen nicht das Recht, bearbeitete oder sonst wie umgestaltete Fassungen dieses Werkes zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist auch für die oben aufgeführten nicht-kommerziellen Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2021 Der/die Autor(en)
About this paper
Cite this paper
Osten, P. (2021). Was lernen wir aus historischen Seuchen?. In: Lohse, A.W. (eds) Infektionen und Gesellschaft. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63509-4_8
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-63509-4_8
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-63508-7
Online ISBN: 978-3-662-63509-4
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)