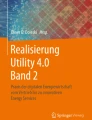Zusammenfassung
Im Projekt Hierda werden Treiber und Barrieren der Arbeit von und in Coworking-Spaces analysiert. In diesem Rahmen konnten vier verschiedene Coworking-Space Arten identifiziert werden, die sich primär im Bereich Betreibende, Geschäftsmodell und somit anvisierte Nutzende unterscheiden. Um diese verschiedenen Arten von Coworking-Space erfolgreich zu betreiben sind unterschiedliche Ausgestaltungen und unterstützende Personen notwendig. In diesem Beitrag wird u. a. aufgezeigt, wie Permeabilität und Gemeinschaft den unterschiedlichen Nutzendengruppen zu besserer Arbeit und zu besseren Arbeitsergebnissen verhelfen. Insgesamt können so durch verbesserte Kommunikation und verstärkten Wissensaustausch Innovationen auf Produkt-, Geschäfts- und Geschäftsmodellebene gezielt erreicht werden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
14.1 Einleitung
Die rasante Entwicklung des Internets und die damit verbundene Digitalisierung haben zu einer Veränderung der heutigen Wirtschaft und Gesellschaft geführt. Die weite Verbreitung sozialer Netzwerke (Goh et al. 2013), veränderte Konsumgewohnheiten (Hamari et al. 2016) und ein fundamentaler Wertewandel auf Seiten der Konsumierenden (Bardhi und Eckhardt 2012) erhöhen den Druck auf Unternehmen und führen die Gesellschaft stückweise in Richtung einer „Sharing Economy“ (Botsman und Rogers 2011).
Ein Phänomen, welches sich in diesem Zusammenhang herauskristallisiert hat, sind Coworking-Spaces (CWS). In solchen CWS teilen sich meistens Start-ups, Entrepreneure, Selbstständige, oder auch Mitarbeitende etablierter Unternehmen einen gemeinsamen Ort zum Arbeiten (Bouncken und Reuschl 2018; Gandini 2015; Spinuzzi 2012). Tatsächlich besteht die Basisleistung eines CWS darin, einen Arbeitsraum inklusive einer Infrastruktur bereitzustellen. Es wäre jedoch falsch, CWS nur darauf zu reduzieren. Neben dem Angebot eines professionellen Arbeitsraums definieren sich CWS-Anbietende auch über die Verfügbarkeit von sozialen Interaktionsräumen, und einer Gemeinschaft durch die Nutzenden (Capdevila 2013; Moriset 2014; Pohler 2012; Spinuzzi 2012). Mit diesem Angebot werden CWS verstärkt zum Arbeitsplatz von morgen.
Als Phänomen aus der Praxis und ohne einvernehmliche Standards differieren jedoch die existierenden CWS in ihren Ausprägungen enorm. Manche CWS sind beliebt und erfolgreich, andere hingegen haben Existenzprobleme. Doch worin unterscheiden sie sich, und was beeinflusst den Erfolg der Coworking-Spaces? Was sind Treiber und Barrieren für den Erfolg von Coworking-Spaces und für die Arbeit der CWS-Nutzenden? Mit welchen unterstützenden Maßnahmen kann die Arbeit von und in CWS verbessert werden? Diesen und ähnlichen Fragen wird im Projekt „Humanisierung digitaler Arbeit durch Coworking-Spaces (Hierda)“ nachgegangen.
Da die Auswertung im Rahmen von wissenschaftlichen Publikationen in peer-reviewed Zeitschriften noch aussteht, sind in den folgenden Kapiteln ein paar Unvollständigkeiten unvermeidbar.
14.2 Theoretischer Hintergrund
Getrieben durch technologische (Belk 2014; Oskam und Boswijk 2016), ökonomische (Hartl et al. 2016; Möhlmann 2015) sowie ökologische (Cohen und Kietzmann 2014; Hamari et al. 2016) Einflüsse organisieren mehr und mehr Menschen das Teilen von Gütern und Dienstleistungen über das Internet (Belk 2014; Bouncken und Reuschl 2018). Diese Art von Teilen etabliert sich dabei zunehmend als alternative Konsumform (Lamberton und Rose 2012), wohingegen der Besitz einer Sache immer mehr als Einschränkung der eigenen Mobilität und Flexibilität angesehen wird (Kathan et al. 2016; Schaefers et al. 2016). Dementsprechend tritt der Besitz einer Sache verstärkt in den Hintergrund (Chen 2008) und der bloße Zugang zu einer Sache wird vorgezogen (Belk 2007, 2010; Hennig-Thurau et al. 2007; Schaefers et al. 2016). Anstatt Waren und Güter zu kaufen und sie zu besitzen, erhalten Konsumierende vorübergehenden Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen, die sie benötigen (Bardhi und Eckhardt 2012; Hartl et al. 2016). Dieses Phänomen wird als Sharing Economy bezeichnet (Botsman und Rogers 2011), welche sich durch „Peer-to-Peer“-Aktivitäten auszeichnet, bei denen der Zugang zu Gütern und Dienstleistungen über „community-based online services“ koordiniert wird (Hamari et al. 2016). Dabei können sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen jeweils untereinander oder auch miteinander die Nutzung über das Internet organisieren (Reuschl und Bouncken 2017).
Im Kern der Sharing Economy steht die Koordination des Zugangs und somit die effiziente Gestaltung der Transaktionskosten, wodurch die Interaktion zwischen Individuen und die Bildung virtueller Gemeinschaften vereinfacht wird (Möhlmann 2015). Grundlage davon sind die Entwicklung des Internets und die zunehmende Vernetzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (Belk 2014). Durch diese Entwicklungen ist es möglich, ohne wesentliche Transaktionskosten Güter und Dienstleistungen gemeinschaftlich und nachhaltig zu nutzen (Albors et al. 2008; Belk 2014). Dabei stiftet das Teilen von Ressourcen für die Gemeinschaften einen ökonomischen Wert, da so die Anschaffungskosten vermieden und laufende Kosten abgeschafft werden können (Schaefers et al. 2016). Zentral ist auch ein sozialer Nutzen für die Beteiligten, der z. B. durch die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls entstehen kann (Belk 2007, 2014). Da durch die gemeinsame Nutzung eines Gutes Verschwendung vermieden und eine Überproduktion bekämpft werden kann, impliziert die Sharing Economy auch einen ökologischen Nutzen (Möhlmann 2015). Auf Seiten der Konsumierenden spiegelt sich dies in dem in der Einleitung erwähnten fundamentalen Wertewandel (Bardhi und Eckhardt 2012) sowie veränderten Konsumgewohnheiten (Hamari et al. 2016) wider.
Abgesehen von dem Einfluss auf den Konsum finden sich die Auswirkungen der Sharing Economy auch in anderen Bereichen wieder. Neben den für gewöhnlich herangezogenen Beispielen wie dem Teilen von Fahrzeugen, Wohnraum, Medien oder Kleidung (Bouncken 2018), hat die Sharing Economy auch Einfluss auf die Arbeitswelt. Hier etabliert sich zunehmend ein Trend, der sich durch das Teilen von Arbeitsraum kennzeichnet (Bouncken 2018; Richter et al. 2015). Unterstützt wird dieser Trend durch zwei weitere zentrale Einflussfaktoren. Unternehmen suchen vermehrt Flexibilisierungsmöglichkeiten ihrer Arbeitskräfte, um sich permanenten ökonomischen und technologischen Veränderungen (Raffaele und Connell 2016) besser stellen zu können. Diese Entwicklung ist zusätzlich durch eine Ausrichtung vieler Unternehmen auf das Interesse von Investierenden und damit einhergehend auf die Fokussierung kurzfristiger finanzieller Erfolge getrieben (Bouncken 2000; Spreitzer et al. 2017). Dadurch erhalten Arbeitnehmende immer seltener traditionelle Vollzeitstellen, die mit Arbeitsplatzsicherheit (Davis 2016), einer fixen Zeitplanung sowie einem festen Arbeitsplatz auf dem Gelände des Unternehmens verbunden sind (Kalleberg et al. 2000). Stattdessen werden Arbeitsplätze ausgelagert, Kernbelegschaften reduziert (Kalleberg 2001) und verstärkt Vertragsarbeitende, ohne Arbeitsplatzsicherheit oder Vorsorgeleistungen, eingestellt (Bidwell 2009; Bidwell und Briscoe 2009).
Einhergehend mit den Veränderungen auf Seiten von Unternehmen entwickeln sich auch auf Seiten der Arbeitnehmenden neue Anforderungen an die Arbeit (Schürmann 2013). Flexible Arbeitsregelungen (Wey Smola und Sutton 2002) in Bezug auf die räumliche und zeitliche Gestaltung der Arbeitsleistung (Johns und Gratton 2013) und eine ausgeglichene Work-Life-Balance (Carless und Wintle 2007) sind den Young Professionals zunehmend wichtiger. Dies resultiert in neuen Beschäftigungsmodellen, neuartigen Berufen und neuen Formen der Zusammenarbeit (Schürmann 2013). Beispiele für neue Beschäftigungsmodelle sind die nomadische Arbeit (Mark und Su 2010) oder die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten. Bei der nomadischen Arbeit reisen Menschen mit dem Ziel, Arbeit zu verrichten (Mark und Su 2010). Home-Office hingegen bezeichnet die Verrichtung der täglichen Arbeit von zu Hause bzw. allgemeiner gesprochen einem selbst gewählten Ort. Insbesondere auch an der steigenden Anzahl an Selbstständigen (Johns und Gratton 2013) lässt sich dieser Trend erkennen. So ist die Zahl der Selbstständigen in Deutschland bis 2019 auf ca. 3,5 Millionen gestiegen, europaweit lag die Zahl der Selbstständigen 2019 bei ca. 30,5 Millionen (eurostat 2020). Ermöglicht wird diese Entwicklung durch technologische Fortschritte in Informations- und Kommunikationstechnologien (Johns und Gratton 2013; Moriset 2014), welche es erlauben, Arbeit von überall und jederzeit zu erledigen (Kossek et al. 2015; Spreitzer et al. 2017). Viele dieser Selbstständigen verrichten ihre Arbeit mittlerweile in Coworking-Spaces (siehe auch Abschn. 14.4.4). Zusätzlich spielen verstärkt flexible Arbeitsplätze eine Rolle in der modernen Gestaltung von Organisationen (Gandini 2015; Merkel 2015; Gibson 2003). Darüber hinaus bietet die heutige Zeit vermehrt Möglichkeiten für digitale Geschäftsmodelle (Bouncken et al. 2019b). Durch die oben bereits erwähnten geringen Transaktionskosten der Sharing Economy (Albors et al. 2008; Belk 2014) können Unternehmen über Vermittlungsplattformen flexibel und ohne hohe Suchkosten auf die Arbeitsleistung von Selbstständigen zugreifen, die auf solchen Vermittlungsplattformen ihre Arbeitskraft anbieten (Gandini 2016b).
Dieser Wandel wird auch als „on-demand economy“ bezeichnet, was einen äußerst flexiblen Arbeitsmarkt beschreibt, in denen Berufstätige unabhängig und individuell agieren und nur bei Bedarf nachgefragt werden (Gandini 2016a). Da jedoch durch diesen Trend mehr und mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und weniger persönlichen Kontakt zu Arbeitskollegen haben, fühlen sich viele zunehmend isoliert und sozial abgeschirmt (Cooper und Kurland 2002; Garrett et al. 2017; Golden et al. 2008; Whittle und Mueller 2009). Um diesem Gefühl zu begegnen, haben einige Selbstständige begonnen, in öffentlich zugänglichen Plätzen wie Cafés zu arbeiten. Jedoch sind diese Plätze oftmals lärmintensiv und bieten wenig Privatsphäre (Garrett et al. 2017). Darüber hinaus bieten sie nur wenig Möglichkeiten für soziale Interaktion (Hampton und Gupta 2008).
Um der häufig auftretenden sozialen Vereinsamung entgegenzuwirken, hat sich Mitte der 2000er-Jahre ein neues Arbeitsmodell entwickelt, welches das Teilen von Arbeitsräumen beinhaltet und als „Coworking“ bezeichnet wird (Moriset 2014). Die Coworking-Spaces erfuhren seit dem ersten offiziellen Auftreten im Jahr 2005 in San Francisco (Foertsch und Cagnol 2013) große Beliebtheit und entwickelten sich rasant (Reuschl und Bouncken 2017). Im Jahr 2018 arbeiteten noch etwa 1,7 Millionen Menschen in knapp 19.000 Coworking-Spaces weltweit und diese Zahlen steigen im Jahr 2019 bereits auf 2,2 Millionen Coworkende in knapp 22.000 Coworking-Spaces weltweit (Foertsch 2018). Doch während Coworking-Spaces in der Praxis eine große Bedeutung haben, wurden sie in der Theorie bzw. Wissenschaft bisher nur vereinzelt betrachtet (vgl. Bilandzic und Foth 2013; Capdevila 2014; Davies und Tollervey 2013; Gandini 2015; Johns und Gratton 2013; Jones 2013; Kwiatkowski und Buczynski 2014; Moriset 2014; Pohler 2012; Spinuzzi 2012).
14.2.1 Coworking und Coworking-Spaces
Der Begriff Coworking bedeutet zu Deutsch „gemeinsam arbeiten“ und kommt ursprünglich 2005 aus San Francisco. Dort entwickelte sich das Coworking, das eine Arbeitsweise zwischen einem traditionellen Arbeitsplatz und einer gemeinschaftlichen Umgebung beschreibt. Diese gemeinschaftliche Arbeitsform wird beispielsweise von Freiberuflern, Selbstständigen, Start-ups oder Arbeitnehmern in Home-Office genutzt (Gandini 2015). Im Vordergrund steht hierbei nicht der wirtschaftliche Nutzen, sondern der Ansatz einer quellenoffenen Gemeinschaft, die Kommunikation und soziale Beziehungen zwischen den Mitgliedern fördert (Gandini 2015). Selbstständige oder Arbeitnehmer in Home-Office fühlen sich häufig sozial und beruflich isoliert, da sie ihre Arbeiten von zu Hause aus erledigen und sich deshalb nicht automatisch mit Kollegen oder anderen Menschen austauschen können (Bouncken et al. 2018a). Laut Bouncken und Reuschl schafft die soziale Interaktion mehr Zufriedenheit und Motivation bei der Arbeit. Außerdem kann die Interaktion den Mitgliedern auch beruflich zu mehr Erfolg führen, indem sie Informationen austauschen und sich somit gegenseitig bei Problemlösungen unterstützen (Bouncken und Reuschl 2017a).
Der Gedanke dahinter ist, dass Coworkende ihre individuellen Aufgaben neben anderen Personen, eher als mit ihnen, verrichten, vergleichbar mit der Atmosphäre, die typisch für ein Fitnessstudio ist (Aabø und Audunson 2012). Hierbei wird durch das nebeneinander Arbeiten die Isolation, die durch die digitale Arbeit und das Wegfallen eines klassischen Büroplatzes entsteht, verringert und eine soziale Komponente erzeugt, die die Coworkenden so sonst nur schwer erfahren können (Bouncken et al. 2016). Die Nutzenden kennen sich untereinander und kommunizieren viel, sind aber in ihrer Arbeit und Arbeitsweise selbständig. Um das zu ermöglichen bieten Coworking-Spaces neben der zum Arbeiten notwendigen Ausstattung wie Arbeitsplatz, Internet, Drucker und Konferenzraum auch Elemente zum Wohlfühlen und Kommunizieren wie Küchen, Freizeiträume mit Kickern oder Couch- und Hängematten-Landschaften. Von der German Coworking Federation sowie in verschiedenen Publikationen wurden dafür 5 Kernwerte identifiziert, die die Coworking-Mentalität beschreiben: (1) Offenheit, (2) Kollaboration, (3) Nachhaltigkeit, (4) Gemeinschaft und (5) Zugänglichkeit. Offenheit bedeutet, sich gegenseitig zu akzeptieren und neue Personen aber auch neuen Ideen offen gegenüberzustehen. Kollaboration bezieht sich darauf, dass Coworkende nicht nur zusammen parallel arbeiten, sondern auch zusammen an gemeinsamen Projekten arbeiten (Görmar et al. 2020). Die Nachhaltigkeit bedeutet hier der ressourcenschonende Ansatz, also das zur Verfügung stellen von ungenutzten Ressourcen, räumlich wie finanziell. Die Gemeinschaft bezeichnet das Wir-Gefühl innerhalb eines Coworking-Space aber auch unter allen Coworkenden, dass die Integration von verschiedenen Sichtweisen und Herangehensweisen ermöglicht. Die Zugänglichkeit bedeutet nicht nur die Öffnungszeiten des Space, sondern vielmehr die Zugänglichkeit des Space für alle Interessenten ohne eine Einschränkung der potenziellen Nutzenden.
14.3 Methode
Die Methodik wird aufgrund der Forschungssituation in zwei Bereiche geteilt. Zu Beginn des Projekts handelte es sich beim Thema Coworking-Spaces um ein weitestgehend unerforschtes Thema. Dies erfordert einen offenen, qualitativen Forschungsansatz. Nach ausführlichen Recherchen und Studien sowohl im Rahmen des Projekts als auch von anderen Wissenschaftlern*innen weltweit wird ein quantitativer Ansatz verfolgt.
14.3.1 Qualitativer Ansatz zur Erforschung eines neuen Phänomens
Coworking-Spaces und die zugehörigen Werte sind in dieser Kombination ein neues Phänomen mit steigender Relevanz für Forschung und Praxis, insbesondere hinsichtlich Faktoren wie Gemeinschaft, Permeabilität und Netzwerkaktivität. Für neuartige und unerforschte Themen, zu denen Coworking-Spaces zählen (Garrett et al. 2017), eignet sich am besten eine induktive Vorgehensweise (Mäkelä und Turcan 2007; Strauss und Corbin 1990). Dabei wird ein Thema erwartungs- und ergebnisoffen mit qualitativen Forschungsdesigns erforscht. Dieser Ansatz erlaubt es, kontextspezifische Daten aus verschiedenen Quellen zu kombinieren und somit Theorien und Rahmenkonzepte zu entwickeln (Strauss und Corbin 1998). Daher wurden im Rahmen dieses Forschungsprojekts zunächst basierend auf ausführlicher Literaturanalyse zwei Interviewleitfäden entwickelt – einer für die Nutzenden von CWS und einer für die Anbietenden von CWS. Die Interviews wurden als Semi-strukturierte Interviews persönlich und vor Ort geführt. So konnten Rückfragen beantwortet und potenzielle Kommunikationsprobleme verhindert werden. Die Interviews wurden aufgenommen und noch am selben Tag transkribiert. Anschließend wurden die Interviews durch den jeweiligen Interviewpartner*in überprüft. Die so erhobenen Daten wurden mit Informationen von Websites, Social-Media-Kanälen und Datenbanken ergänzt. So wurden objektive Daten über den Coworking-Space mit Informationen von der Website oder durch Nachrichtenbeiträge um relevante Aspekte wie Kosten für Räumlichkeiten oder zukünftige Ausrichtung (z. B. Börsengang) ergänzt. Sofern Nutzende in Unternehmen oder Start-ups organisiert waren, wurden zusätzliche Informationen über diese Unternehmen und Start-ups erhoben. Diese qualitativen Studien ermöglichten eine Unterscheidung der Coworking-Spaces hinsichtlich Geschäftsmodell, der dahinterstehenden Betreibenden sowie angesprochener Nutzenden. Des Weiteren konnten wir erste Erfolgsfaktoren für die Arbeit in und von Coworking-Spaces herausarbeiten. Für die Studien haben wir insgesamt 158 Interviews in Deutschland, China und den USA geführt und so über 350 Stunden Interviewmaterial gesammelt. In Deutschland wurden Daten erhoben, da der Projektfokus auf Deutschland liegt und Deutschland weltweit als Vorreiter im Bereich Coworking gilt. Da der Ursprung von Coworking in den USA liegt, wurden zusätzlich dort Daten erhoben. China ist für die Erhebung interessant, da es einen anderen kulturellen Hintergrund bietet. China ist traditionell kollektivistisch und die Gemeinschaft, das Teilen und das Gemeinsame haben einen hohen Stellenwert. Zum einen sind dies Kernelemente der sharing economy, zum anderen bietet China somit als Gegenpol zu den USA und Deutschland eine interessante Vergleichsgruppe. Für die Erhebung in den USA und in China wurden die Leitfäden in die jeweilige Sprache übersetzt. Dazu wurden die Leitfäden zunächst von zwei Personen von Deutsch in die Fremdsprache übersetzt und danach von zwei anderen Personen rückübersetzt. Unterschiede in der Übersetzungsarbeit wurden in den Teams diskutiert und angepasst. Die Interviews wurden sowohl mit Anbietenden von CWS als auch mit Nutzenden von CWS geführt (Tab. 14.1).
Die Auswertung der Interviews folgte einem schrittweisen Coding-Prozess nach Gioia et al.(2013) mit iterativen Prozessschritten, die eine Integration von Literatur und Zusatzmaterial erlaubten. Zunächst werden Zitate zu Konzepten erster Ordnung zusammengeführt. Im nächsten Schritt werden diese Konzepte zu Themen zweiter Ordnung aggregiert. Abschließend werden aggregierte Dimensionen gebildet. Mit dieser Methodologie können aus Interviews emergente Themen herausextrahiert werden. Eine unvoreingenommene Herangehensweise ist dafür unabdingbar.
14.3.2 Quantitative Forschung zur Überprüfung von Beziehungen und Wirkungsmechanismen
Darauf aufbauend wurden zwei Fragebögen entwickelt – einen für die Nutzenden von CWS und einen für die Anbietenden von CWS. Damit wurden die identifizierten Anbietenden- und Nutzendengruppen befragt. Bei dieser deduktiven Vorgehensweise wurden die vorher von Anbietenden, Nutzenden und Experten*innen subjektiv beschriebenen Situationen und Zusammenhänge messbar gemacht und in statistischen Modellen dargestellt. Die Fragebögen wurden sowohl papierbasiert als auch online erhoben. Potenziellen Fragen wurde durch einen informierenden Einleitungstext vorgebeugt. Die Fragen wurden sowohl durch eine 5-Punkt Likert-Skala als auch durch Single Items erhoben. Auch hier wurden die Datensätze um Informationen aus Sekundärquellen wie Websites, Social-Media-Kanälen und Datenbanken ergänzt. So konnten die in den qualitativen Studien herausgearbeiteten Beziehungen empirisch getestet werden. Die Ergebnisse dieser quantitativen Studie ermöglichen es uns, Instrumente zur Verbesserung der Arbeit von und in Coworking-Spaces zu entwickeln. In einem anschließenden Roll-out werden die Instrumente in einem Online-Tool zur weiteren Verbreitung zur Verfügung gestellt.
In der quantitativen Erhebung wurden erneut Nutzende und Anbietende befragt. So konnten in den Ländern Deutschland, China und USA insgesamt 909 Nutzende sowie 89 Anbietende befragt werden (Tab. 14.2).
Die Auswertung erfolgte im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen mit der Software MPlus und mit SPSS. So können verschiedene Wirkungsketten aufgezeigt und analysiert werden.
14.4 Ergebnisse
Im Rahmen des Forschungsprojekts konnten bereits erste Erkenntnisse rund um das Thema Coworking gewonnen werden. So konnten wir verschiedene Anbietenden- und Nutzendengruppen identifizieren, Coworking-Spaces klassifizieren und einzelne Gestaltungsmerkmale herausarbeiten.
14.4.1 Die Anbietenden
Grundsätzlich konnten vier verschiedene Arten von Coworking-Spaces identifiziert werden: (1) Corporate Coworking-Spaces, (2) Open Corporate Coworking-Spaces, (3) Consultancy Coworking-Spaces und (4) Independent Coworking-Spaces. Die Corporate Coworking-Spaces bezeichnen Unternehmen, die ihre Büro- und Arbeitsplatzstrukturen dem Prinzip von flexiblen Arbeitsplätzen in offenen Bürostrukturen gewidmet haben. Dabei stehen die Arbeitsplätze nur den Angestellten zur Verfügung, eine Vermietung oder Öffnung für externe Nutzende findet nicht statt. Die offenen und kreativ gestalteten Büroflächen ermöglichen und unterstützen den Wissensaustausch zwischen Mitarbeitenden. Prominente Beispiele hierfür sind Facebook, Apple und Google. Open Corporate Coworking-Spaces verfolgen dasselbe Prinzip für ihre eigenen Mitarbeitenden, öffnen den Arbeitsplatz jedoch zusätzlich (teilweise) für externe Coworkende, z. B. Freelancer. Dadurch wird der Wissensaustausch mit Unternehmensexternen gefördert und die Angestellten profitieren von kreativen Ideen und neuartigem Input. Die externen Nutzenden können in diesem Zuge als Spezialisten*innen zu Beratungszwecken hinzugezogen werden und als kurzfristige Projektmitarbeitende das Unternehmen unterstützen. Langfristig können so neue Angestellte akquiriert werden, die das Unternehmen bereits kennen und die dem Unternehmen von Arbeitsweise und Einstellung bereits bekannt sind. Bekannte Beispiele für diese Art von CWS sind Modul57 von TUI und Ottobock. Consultancy Coworking-Spaces sind innovative und kreative Raumkonzepte, die nur für die Kunden*innen des jeweiligen Beratungsunternehmens geöffnet sind. Darin können sowohl kundenindividuelle Innovationsprojekte betreut werden als auch passende und interessante Unternehmen zusammengeführt werden. Dabei fungiert das Beratungsunternehmen als Leumund und ermöglicht so, dass Kunden*innen mit ähnlichen Projekten ihre Innovationen gemeinsam mit vereinten Kräften vorantreiben können. Über das reine Raumangebot hinaus kann das Beratungsunternehmen als Moderator und Anbietender zusätzlicher Dienstleistungen fungieren. Weitere Mitarbeitende können potenzielle Lücken im Bereich Wissen und Methodik ergänzen und somit das gesamte Angebot des Beratungsunternehmens erweitern. Als Vorreiter ist hier PwC mit Experience Centern in der ganzen Welt – u. a. in Frankfurt – zu nennen. Im Gegensatz zu diesen Coworking-Spaces stehen die unabhängigen Coworking-Spaces. Diese stehen normalerweise allen Interessenten offen, sind aber manchmal auf bestimmte Themen fokussiert (z. B. Techquarter in Frankfurt mit Fokus auf Fintech Start-ups) oder auf bestimmte Nutzendengruppen (z. B. Rockzipfel in München für Mütter mit Kindern). Nutzende gehen hier nicht nur ihrer Arbeit nach, sondern entkommen auch ihrer sozialen Isolation. Sie profitieren insbesondere von der Gemeinschaft, dem Wissensaustausch und den Freizeitmöglichkeiten. Hierfür können die Coworking-Spaces betahaus und St. Oberholz angeführt werden (siehe Bouncken et al. 2017).
14.4.2 Sonderformen von Coworking
Im obigen Abschnitt wurde auf die gängigen Formen von Coworking-Spaces eingegangen. Insbesondere unabhängige Coworking-Spaces nutzen jedoch immer häufiger die Möglichkeit, sich als „Coworking + X“ zu positionieren. Dafür bieten sie nicht nur das Arbeitsumfeld an, sondern ergänzen das Arbeitsumfeld um eine weitere Komponente als Alleinstellungsmerkmal. Dies kann die Möglichkeit zum Wohnen sein, das Co-living (Rent24 in Berlin), oder die Möglichkeit, in der Nähe von Erholungsgebieten zu arbeiten und diese direkt nutzen zu können (Coconat in Bad Belzig). Weitere Kombinationen sind Coworking + Urlaub (z. B. Beachhub auf Ko Phangan, Thailand) oder Coworking + besondere Aktivitäten (z. B. Coworking + Reiten als Ausgleich zur Arbeit, RossVita in Neuenhagen bei Berlin). Es geht also darum, ein gewisses Level an Individualität auszustrahlen. Zu individuell und besonders darf es jedoch auch nicht sein, da ansonsten potenzielle Nutzende abgeschreckt werden (vgl. dazu Täuscher et al. 2020).
14.4.3 Angebote in Coworking-Spaces
Coworking-Spaces bieten ihren Nutzenden zwei Kernelemente. (1) Materielle Ausstattung und (2) Soziale Gestaltungselemente. Zu den materiellen Aspekten gehört der Arbeitsplatz mit Internetverbindung, Konferenzräume und Drucker, also alles, was in der wissensintensiven Arbeit benötigt wird. Zusätzlich werden in manchen Coworking-Spaces Arbeitsutensilien, Maschinen und Labore zur Verfügung gestellt. Diese Grundausstattung wird für die Arbeit der Nutzenden benötigt. Die sozialen Elemente bestehen aus Gemeinschaftsräumen, voll ausgestatteten Küchen, Entspannungsräumen und Sessellandschaften. Mit diesen Elementen wird der Wissensaustausch, die Kreativität und die Gemeinschaft gefördert (Bouncken et al. 2020b).
Begleitet werden diese Kernelemente von Dienstleistungen, die optional zusätzlich gebucht werden können. Solche Dienstleistungen können Cateringangeboten für Workshops sein, aber auch Sekretariatsdienstleistungen sowie Unternehmensadressen und -briefkästen. Zusätzlich werden häufig Seminare, Fortbildungen und Networking-Events für alle Nutzende des Coworking-Space sowie externe Interessenten*innen organisiert.
14.4.4 Die Nutzenden
Auch die Nutzenden lassen sich in verschiedene Kategorien gruppieren, (1) die Utilizer, (2) die Learner und (3) die Socializer. Die Utilizer sind Coworkende, die ausschließlich den direkten Nutzen für ihre Aufgabenbewältigung im Rahmen ihrer eigenen Tätigkeiten suchen. Die Interaktion mit anderen Coworkenden zum Wissensaustausch oder zum Aufbau persönlicher Kontakte wird nicht verfolgt. Das Hauptziel des Learners ist es, im Austausch mit anderen Coworkenden das Wissen zu erweitern. Die Tätigkeit steht nicht im Vordergrund. Der Socializer nutzt den Coworking-Space primär um der sozialen Isolation zu entkommen, der er aufgrund seiner Tätigkeit oder seiner Bürosituation ausgesetzt ist. Er möchte Freundschaften schließen und sich über aktuelle Small-Talk-Themen unterhalten (siehe Bouncken und Reuschl 2017b).
Abhängig von der Art des Coworking-Spaces variieren die Anteile der Nutzendengruppen. Die Corporate Coworking-Spaces richten sich ausschließlich an Angestellte des Unternehmens. Primäre Nutzendengruppe sind somit die Utilizer. Doch der Grund eines Unternehmens flexible Arbeitsplatzstrukturen zu schaffen ist auch die Förderung des Austauschs. Somit sind die Learner explizit erwünscht und bilden die zweite Nutzendengruppe.
Open Corporate Coworking-Spaces adressieren grundsätzlich dieselben Nutzendengruppen. Zusätzlich ist hier ein geringer Anteil der Socializer, da die externen Nutzenden auch aus dem Grund der sozialen Isolation zur Nutzung von Coworking-Spaces tendieren. Der Anteil fällt jedoch eher gering aus, da die meisten Coworkenden, die primär Socializer sind, zu den unabhängigen Coworking-Spaces tendieren.
Die Consultancy Coworking-Spaces adressieren Mitarbeitende von Unternehmen, die Kunden*innen des Beratungsunternehmens sind. Dies ist Teil des Geschäftsmodells des Beratungsunternehmens und ist für die Unternehmen somit kostenpflichtig. Der reine Austausch mit anderen Mitarbeitenden und das abbauen sozialer Isolation ist somit kein Grund für die Nutzung. Vielmehr geht es darum, dass die Nutzenden unter Mitwirkung von Beratenden neue Ideen generieren oder neue Ideen weiterentwickeln sowie das Umfeld und die Einrichtung des CWS dafür nutzen. Primäre Nutzendengruppen sind also die Utilizer und die Learner.
Im unabhängigen Coworking-Space mischen sich die Nutzendengruppen. Die wenigsten hier sind Utilizer und die meisten sind Socializer. Das liegt daran, dass in unabhängigen Coworking-Spaces die Wertegemeinschaft besonders wichtig ist und das Gemeinschaftsleben einen hohen Stellenwert einnimmt.
14.4.5 Coworking-Spaces als Ecosysteme
Ein wichtiger Aspekt für Solo-Selbstständige und Start-ups ist, wie aus unseren Erhebungen hervorgeht, die Vernetzung auf der beruflichen Ebene. Diese Vernetzung ist aufgrund von Kennenlernen und Vertrauensbildung persönlich deutlich schneller und besser möglich, als über digitale Medien. Je mehr Personen mit gleichen und/oder verschiedenen Hintergründen ins persönliche Netzwerk integriert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, bei Problemen entsprechende Hilfe zu erhalten. Die Kombination vieler solcher Netzwerke kann auch als Ecosystem bezeichnet werden. Ein Ecosystem besteht aus einer Gemeinschaft verbundener Akteure. Diese kombinieren und ergänzen ihr Wissen, ihre Quellen und ihr Potenzial (Turkina et al. 2016; Dunning 1988). Diese Verbindungen ermöglichen den Zugang zu breit verteiltem Wissen und Kontakten (Mudambi et al. 2018). Außerdem kann so einem gemeinsamen Endkunden*in ein aufeinander abgestimmtes Angebot angeboten werden. Ein Akteur kann Teil verschiedener Ecosysteme sein. Im Kontext der Coworking-Spaces sind sowohl die einzelnen Coworkenden als auch die Coworking-Spaces solche Akteure.
Die Coworking-Spaces als „Hüter*in der Gemeinschaft“ fungieren dabei als Gate-Keeper. Alle Coworkenden, die in die Gemeinschaft eintreten, erfüllen daher die Grundvoraussetzungen um als Teil der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Sie werden somit in das Coworking-Space Ecosystem aufgenommen und sind damit direkt auch Teil des Ecosystems der aller Coworking-Spaces. Mit Eintritt steuern sie ihr persönliches Netzwerk bei und erweitern somit das existierende Ecosystem. Dies erweitert das zugängliche Wissen und die zur Verfügung stehende Unterstützung. Das Netzwerk, auf das die Coworkenden über die Ecosystem-Zugehörigkeit Zugriff haben, hat darüber hinaus direkte Auswirkungen auf Innovativität und Projekterfolg. Ein ausgeprägtes und von allen Teilnehmenden aktiv unterstütztes Ecosystem ist somit einer der Erfolgsfaktoren von Coworking-Spaces.
14.4.6 Permeabilität
Permeabilität bedeutet die Möglichkeit von einem Team, einer Gruppe oder einem Netzwerk in ein anderes Team, eine andere Gruppe oder ein anderes Netzwerk zu wechseln (Ellemers et al. 1988). Diverse Studien haben gezeigt, dass Permeabilität die Kommunikation und die Innovationskraft fördern (Bouncken et al. 2020a; Jacobides und Billinger 2006; Workman 2005). Permeabilität ermöglicht außerdem das Einbinden von vielfältigen Nutzenden, was wiederum wichtig für Innovativität ist (Bouncken et al. 2008). Der Wissensaustausch entlang vielfältiger Nutzenden wird durch die physische Nähe in Coworking-Spaces zusätzlich unterstützt (Bouncken und Aslam 2019). Die Nutzenden von Coworking-Spaces sind, anders als Angestellte eines Unternehmens, nicht auf einen Arbeitsplatz oder eine Tätigkeit festgelegt. Somit herrscht ein gewisser Grad an Fluktuation von Nutzenden innerhalb eines Coworking-Space. Diese Fluktuation ist notwendig, um den Wissensaustausch und die Kreativität kontinuierlich zu fördern. Coworking-Spaces, die den Fluss und Austausch von Informationen forcieren, verbessern die dazugehörigen kreativen Prozesse.
Sehr geringe Permeabilität, also eine geringe Fluktuation von Nutzenden in Coworking-Spaces, erhöht zwar das Gemeinschaftsgefühl aufgrund von Beständigkeit, reduziert jedoch den Wissensaustausch. Das bestehende Netzwerk wird fixiert und die Vorteile der flexiblen Arbeitswelt in Coworking-Spaces können nicht realisiert werden. Eine zu hohe Fluktuation von Coworkenden hingegen verhindert, dass Vertrauen und Akzeptanz aufgebaut werden kann. Vertrauen hingegen ist wichtig für die Leistung der Coworkenden (Hughes et al. 2018). Ohne Vertrauen wird außerdem bereits das Initiieren des Informationsflusses verhindert. Folglich fördert ein gewisses Level an Permeabilität die Innovationskraft sowie den Unternehmenserfolg (Bouncken et al. 2019a).
14.4.7 Gemeinschaftsgefühl
Der Permeabilität gegenüber steht das Gemeinschaftsgefühl. Diverse Studien haben das Gemeinschaftsgefühl als Kernelement von Coworking-Spaces herausgearbeitet (Blagoev et al. 2019; Castilho und Quandt 2017; Garrett et al. 2017; Spinuzzi et al. 2019). Garrett et al. (2017) erläutern, dass eine gemeinsame Vision, geteilte Normen und gemeinsame Routinen ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Nutzenden kreieren, obwohl kein gemeinsamer Arbeitgeber einen Wertekodex oder eine Unternehmensphilosophie vorgibt.
Ebenso wie bei der Permeabilität muss ein gewisses Gemeinschaftsgefühl im Coworking-Space geschaffen werden. Das Gemeinschaftsgefühl fördert ebenfalls die Innovationskraft sowie den Unternehmenserfolg. Eine Identifikation mit einer gemeinsamen Basis (dem Coworking-Space) reicht dabei schon aus, wichtiges Wissen miteinander zu teilen (vgl. dazu Bouncken und Barwinski 2020). Eine zu stark ausgeprägte Gemeinschaft hingegen bedeutet eine fixe und starre Situation ähnlich wie sie in etablierten Unternehmen verhindert werden soll. Dies wird wiederum durch vorhandene Fluktuation verhindert. Das Zusammenspiel von Permeabilität und Gemeinschaftsgefühl ist somit einer der Erfolgsfaktoren der Arbeit in und von Coworking-Spaces (siehe Bouncken und Reuschl 2018). Der vorhandene Wettbewerb und die Konkurrenzsituation wirkt sich dabei nicht negativ auf die Gemeinschaft aus (Bouncken et al. 2018b).
14.4.8 Matching von interessierten Parteien
Gemeinsam zu arbeiten, sich auszutauschen und gemeinsam die Freizeit zu gestalten reicht jedoch nicht aus, um mit den beruflichen Tätigkeiten erfolgreich zu sein. Die passenden Partner*innen müssen für die gewünschten Zwecke passend zusammengeführt werden. Dafür sind entsprechende Coworking-Space Mitarbeitende notwendig (s. Abschn. 14.4.9). Das Zusammenbringen von Coworkenden untereinander und/oder in Kombination mit Externen kann nicht generisch erfolgen, sondern muss zweckdienlich und zielführend sein. Hierfür haben sich Workshops und Events als hilfreich herausgestellt. In unserem Projekt konnten wir primär drei verschiedene Arten identifizieren: (1) Netzwerktreffen, (2) Kooperationen bilden und (3) Transferformate. Bei (1) Netzwerktreffen geht es darum, (potenzielle) Mitglieder einer Fachgemeinschaft aufeinander aufmerksam zu machen und zusammenzuführen. Es geht darum, Aufmerksamkeit für andere Personen desselben (Fach)gebiets zu schaffen und diese in Austausch miteinander zu bringen. Veranstaltungen zum Zweck der (2) Kooperation sollen den Anstoß für gemeinsame Projekte bieten. Primärer Fokus dieser Projekte ist – abhängig von den Partnern*innen – Forschung und Entwicklung sowie große Aufträge, die von einer Partei nicht alleine oder nicht vollständig bewältigt werden können und somit zusätzliches Wissen oder Können notwendig ist. Die (3) Transfertreffen dienen dem Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Beide Seiten können so zu speziellen Themen ihre Anforderungen oder ihr Leistungsspektrum abstecken und sich gegenseitig über die neuesten Trends aus ihrem Bereich informieren.
Anders als erwartet sind Treffen mit Geldgebenden, also die Funktion eines Business Angels oder die Unterstützung von etablierten Unternehmen, kaum relevant für die Nutzenden von Coworking-Spaces.
14.4.9 Rollen im Coworking-Space
Um einen Coworking-Space langfristig erfolgreich betreiben zu können hat sich in unseren Erhebungen ebenfalls herausgestellt, dass diverse Positionen auf der Betreibenden-Seite besetzt sein sollten. Dies ist zumeist erst möglich, wenn der Coworking-Space eine gewisse Größe und somit gewisse finanzielle Möglichkeiten hat. Es ist jedoch auch erst ab einer gewissen Größe notwendig bzw. hilfreich. Einzelne Positionen können bei kleineren CWS zusammengelegt werden und von einer Person erfüllt werden.
Community-Manager
Der Community-Manager vernetzt intern die Mitglieder miteinander. Er weiß, welches Mitglied sich auf welchen Bereich spezialisiert hat und was das jeweilige Mitglied an Hilfe braucht und mit welchen Fähigkeiten es selbst andere unterstützen kann. Darüber hinaus kümmert sich der Community-Manager um das Wohlbefinden der CWS-Nutzenden und hält die Gemeinschaft am Leben. Er weiß nicht nur, wo die einzelnen Nutzenden beruflich stehen, sondern kennt im Idealfall auch die persönlichen Situationen jedes Einzelnen und kann somit auch auf der persönlichen Ebene agieren und intervenieren. Da der Community-Manager all dies weiß gehört zu dem Tätigkeitsbereich ebenfalls das Streitschlichten. Da alle Befindlichkeiten und ggf. persönliche schwierige Lebenslagen bekannt sind ist das Einfühlungsvermögen notwendig, um Streit unter den Coworkenden zu schlichten bzw. im Vorhinein zu verhindern.
Concierge/Verwaltende
Der Concierge/Verwaltende ist dafür verantwortlich, dass es im CWS an nichts fehlt und alles in genau der richtigen Menge vorhanden ist. Dies beinhaltet Kreativmaterial wie Flip-Charts, Stifte, ausgestattete Moderationskoffer und Whiteboard-Stifte aber auch Beamer-Lampen, Küchenutensilien und alles, was zur Grundausstattung des CWS gehört. Darüber hinaus ist diese Person aber auch dafür verantwortlich, dass mit den Materialien sorgsam umgegangen wird. Während der Community-Manager also für das weiche Gerüst des CWS verantwortlich ist (der Gemeinschaft), ist der Concierge/Verwaltende für die Infrastruktur des CWS verantwortlich.
Event-Manager
Der Event-Manager ist für alle Veranstaltungen im CWS zuständig. Gibt es kein digitales Buchsystem für Konferenz- und Veranstaltungsräume, so ist diese Person für die Belegung der vorhandenen Räume zuständig, ansonsten für die Verwaltung der entsprechenden Software. Zusätzlich ist diese Person für die Veranstaltungen verantwortlich, die im CWS stattfinden oder vom CWS organisiert werden. Dies beinhaltet die Organisation von externen Rednern*innen aber auch die Vermietung von Veranstaltungsräumen für externe Veranstaltungen. Auf Veranstaltungswünsche der Coworkenden soll der Event-Manager nach Möglichkeit eingehen und diese umsetzen oder die Nutzenden bei der Umsetzung der Wünsche mit allen Kräften unterstützen.
Je nach Situation können auch weitere Positionen hilfreich sein. Eine Gestaltende Person ist beim Bau, bei der Ausstattung und bei der Gestaltung des CWS hilfreich. Dies sollte natürlich in Verbindung mit der Gestaltung der Gemeinschaft stattfinden, um die Räume und die Gemeinschaft aneinander anzupassen.
14.4.10 Relevanz der Kernwerte von Coworking
(1) Offenheit als erster Kernwert genießt unbestritten einen hohen Status. Der Austausch und die Interaktion mit anderen Menschen sind häufig erstgenannte Gründe für die Nutzung von Coworking-Spaces. Somit ist es wenig verwunderlich, dass die Offenheit gegenüber anderen Coworkenden und ihren Ideen in der breite praktiziert und gelebt wird. Dies konnten wir auch in verschiedenen Studien bestätigen. (2) Kollaboration hingegen hat nur einen geringen Stellenwert und ist – abhängig von der Situation – nicht gewünscht. Dies bezieht sich jedoch auf das Aufbauen von gemeinsamen Projekten und das Aufbauen eines gemeinsamen Unternehmens mit einer Person, die man im Coworking-Space kennenlernt. Kollaboration im Sinne von gegenseitiger Unterstützung bei bestehenden Projekten ist davon unberührt. Das Verfolgen von (3) Nachhaltigkeit ist Coworkenden sehr wichtig. Als Teil der sharing economy sind Coworkende mit dem Teilen und der gemeinsamen Nutzung stark verwurzelt. Die Möglichkeit etwas nutzen zu können ist ihnen wichtiger als etwas zu besitzen. Das bezieht sich auf Büroräume und Fortbewegungsmittel, aber auch auf besondere elektronische Geräte (z. B. mobile WiFi-Hotspots) und finanzielle Ressourcen. Die (4) Gemeinschaft als wichtiges Element in Coworking-Spaces hat eine besondere Stellung, da nicht jeder Coworkende die Gemeinschaft im selben Kontext einbezieht. Gemeinschaft kann als Motivator gelten, wenn Coworkende sich gegenseitig bei der Arbeit sehen, sie kann aber auch der Small Talk über aktuelle Ereignisse in Sport und Politik sein. Gemeinschaft kann das gemeinsame Kochen in der gemeinsamen Küche sein, sie kann aber auch die gemeinsame Pause am Kicktisch oder an der Tischtennisplatte sein. Den Höhepunkt erreicht das Gefühl der Gemeinschaft bei neuen Freundschaften, die sich im Coworking-Space bilden können. Abhängig von der Nutzendenart (s. Abschn. 14.4.4) und des Coworking-Spaces (s. Abschn. 14.4.1) wird von beiden Seiten unterschiedlich viel Wert auf die Gemeinschaft gelegt und nimmt somit einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Abschließend hinaus müssen Coworking-Spaces für sich evaluieren, ob sie ihr Angebot allen Interessenten zugänglich machen wollen (Zugänglichkeit). Unsere Auswertungen der quantitativen Erhebung hat gezeigt, dass es hierzu keine abschließende Äußerung getätigt werden kann. Auf der einen Seite gibt es Coworkende, die eine breite, diverse Menge an Coworkenden nur in Ausnahmefällen wünschen und dies selten als hilfreich empfinden. Sie bevorzugen eine klare Positionierung und einen klaren Fokus, da dies als Alleinstellungsmerkmal von Coworkenden wertgeschätzt wird. Dieser Fokus kann auf dem Tätigkeitsfeld basieren (Techquartier in Frankfurt am Main) aber auch auf allen anderen Kriterien (Alleinerziehende mit Kind, s. Rockzipfel in München; Gemeinschaftsgefüge mit Bewerbung als Einstiegshürde, etc.). Auf der anderen Seite gibt es Coworkende, die ein breites diverses Umfeld bevorzugen, da sie keine Kooperationen anstreben, sondern sich flexibel austauschen möchten. Die Art der Nutzung ist dabei schlussendlich Abhängig vom Stadium, in dem sich das jeweilige Unternehmen befindet (Barwinski et al. 2020).
14.5 Fazit
Coworking-Spaces bieten enormes Potenzial, sowohl für unternehmerischen Erfolg als auch für die Humanisierung der Arbeit. Durch verbesserte Kommunikation und verstärkten Wissensaustausch können Innovationen auf Produkt-, Geschäfts- und Geschäftsmodellebene gezielt erreicht werden. Für die Nutzenden von Coworking-Spaces bedeutet es, dass sie sich vermehrt selbstständig freier entwickeln können, was nicht nur Grenzen verringert und Kreativität fördert, sondern auch das Wohlbefinden stärkt.
Unsere Forschung hat gezeigt, dass es verschiedene Arten von Coworking-Spaces gibt: (1) Corporate Coworking-Spaces, (2) Open Corporate Coworking-Spaces, (3) Consultancy Coworking-Spaces und (4) Independent Coworking-Spaces. Insbesondere letztere differenzieren sich zunehmend durch Sonderformen von Coworking-Spaces, die sich durch Coworking+X auszeichnen und eine Zusatzleistung als Alleinstellungsmerkmal anbieten. In den Coworking-Spaces wird neben der notwendigen Infrastruktur für Büros zusätzlich die Möglichkeit zur Interaktion, Gemeinschaft und Austausch geboten. In manchen Coworking-Spaces werden darüber hinaus Postadressen, Sekretariatsdienstleistungen und Eventplanungen angeboten. Dies wird von den Coworkenden abhängig von der Nutzendengruppe unterschiedlich angenommen. Die (1) Utilizer sind eher auf die Nutzung der Infrastruktur fokussiert, während der (2) Learner das Umfeld zum Lernen nutzen möchte. Der (3) Socializer präferiert die Interaktion mit anderen Coworkenden, um der sozialen Isolation zu entkommen. Die Summe aller Akteure kreiert ein Ecosystem. Durch das Ecosystem können sich die Teilnehmenden schneller und stärker entwickeln und von Kontakten, Fähigkeiten und Ressourcen anderer Teilnehmenden profitieren. Ein gewisser Grad an Durchlässigkeit, also Permeabilität, ermöglicht in diesem Ecosystem kontinuierlich neue Kontakte zu knüpfen. Zu hohe Permeabilität reduziert jedoch das Gemeinschaftsgefühl. Die Gemeinschaft ist wichtig für gegenseitiges Vertrauen, um andere Coworkende bei Projekten bereitwillig zu unterstützen. Dabei hilft auch das Matching von Interessenten. Coworkende untereinander, aber auch Coworkende mit Externen, müssen in passenden Situationen zusammengeführt werden, damit eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Unterstützend hierfür sind verschiedene Rollen, die im Coworking-Space besetzt sein sollten. Dazu zählen insbesondere der Community-Manager und der Event-Manager. Aber auch der Verwaltende/der Concierge übernimmt eine wichtige Rolle im laufenden Betrieb des Coworking-Space. Nur teilweise durch die Betreibenden beeinflussbar aber dennoch gravierend für die Entwicklung eines Coworking-Spaces ist die Frage, in wie weit sich Coworkende mit den Coworking Kernwerten identifizieren. Die fünf Kernwerte (1) Offenheit, (2) Kollaboration, (3) Nachhaltigkeit, (4) Gemeinschaft und (5) Zugänglichkeit beschreiben die Werte, nach denen die meisten Coworkenden leben und die ihnen auch bei der Arbeit wichtig sind.
Diesen Ansätzen stehen jedoch noch Risiken und Schwächen entgehen, die durch wissenschaftliche Forschung und praktische Erprobung kalkulierbar gemacht werden müssen mit dem Ziel, diese zu beseitigen.
Da Deutschland von Anfang an als Vorreiter der Idee des Coworking in Europa galt, sollte Deutschland diese Position nicht aufgeben und sich auf verschiedenen Ebenen intensiv mit der Thematik beschäftigen. Das Forschungsprojekt „Hierda“ kann an dieser Stelle nur ein Anfang sein.
Literatur
Aabø, S., & Audunson, R. (2012). Use of library space and the library as place. Library & Information Science Research, 34(2), 138–149.
Albors, J., Ramos, J. C., & Hervas, J. L. (2008). New learning network paradigms: Communities of objectives, crowdsourcing, wikis and open source. International Journal of Information Management, 28(3), 194–202. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.09.006.
Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2012). Access-based consumption: The case of car sharing. Journal of Consumer Research, 39(4), 881–898.
Barwinski, R. W., Qiu, Y., Aslam, M. M., & Clauss, T. (2020). Changing with the time: New ventures’ quest for innovation. Journal of Small Business Strategy, 1(30), 19–31.
Belk, R. (2007). Why not share rather than own? The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 611(1), 126–140.
Belk, R. (2010). Possessions and self. Hoboken: Wiley International Encyclopedia of Marketing.
Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research, 67(8), 1595–1600. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.10.001.
Bidwell, M. (2009). Do peripheral workers do peripheral work? Comparing the use of highly skilled contractors and regular employees. ILR Review, 62(2), 200–225.
Bidwell, M. J., & Briscoe, F. (2009). Who contracts? Determinants of the decision to work as an independent contractor among information technology workers. Academy of Management Journal, 52(6), 1148–1168.
Bilandzic, M., & Foth, M. (2013). Libraries as coworking spaces: Understanding user motivations and perceived barriers to social learning. Library Hi Tech, 31(2), 254–273. https://doi.org/10.1108/07378831311329040.
Blagoev, B., Costas, J., & Karreman, L. (2019). We are all herd animals’: Community and organizational city in coworking spaces. Organization, 1–23. https://doi.org/10.1177/1350508418821008.
Botsman, R., & Rogers, R. (2011). What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live. London: Collins.
Bouncken, R., & Barwinski, R. (2020). Shared digital identity and rich knowledge ties in global 3D printing – A drizzle in the clouds? Global Strategy Journal. https://doi.org/10.1002/gsj.1370.
Bouncken, R. B. (2000). Dem Kern des Erfolges auf der Spur? State of the Art zur Identifikation von Kernkompetenzen. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70(7/8), 865–886.
Bouncken, R., Ratzmann, M., Barwinski, R., & Kraus, S. (2020a). Coworking spaces: Empowerment for entrepreneurship and innovation in the digital and sharing economy. Journal of Business Research, 114, 102–110. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.033.
Bouncken, R. B., Aslam, M. M., & Qiu, Y. (2020b). Coworking spaces: Understanding, using, and managing sociomaterality. Business Horizons (accepted).
Bouncken, R., & Reuschl, A. (2017a). Emergence of a new institutional field? Forces around the institutionalization of coworking-spaces (accepted). In EGOS 2017, Pre-colloquium development workshop PDW, Copenhagen.
Bouncken, R., Reuschl, A., & Görmar, L. (2017). Archetypes and proto-institutions of coworking-spaces: emergence of an innovation field? In Strategic management society annual conference, Houston, TX.
Bouncken, R., Aslam, M. M., & Brem, A. (2019a). Permeability in coworking-spaces as an innovation facilitator. In 2019 Portland international conference on management of engineering and technology „Technology management in the world of intelligent systems“, 25.–29. August 2019, Portland, OR.
Bouncken, R., Kraus, S., & Roig-Tierno, N. (2019b). Knowledge- and innovation-based business models for future growth: Digitalized business models and portfolio considerations. Review of Managerial Science, 1–14. https://doi.org/10.1007/s11846-019-00366-z.
Bouncken, R. B. (2018). University coworking-spaces: Mechanisms, examples, and suggestions for entrepreneurial universities. International Journal of Technology Management (IJTM), 77(1/2/3), 38–56.
Bouncken, R. B., & Aslam, M. M. (2019). Understanding knowledge exchange processes among diverse users of coworking-spaces. Journal of Knowledge Management, 23(10), 2067–2085. https://doi.org/10.1108/JKM-05-2018-0316.
Bouncken, R. B., & Reuschl, A. J. (2017b). Coworking-spaces: Chancen für Entrepreneurship und business model design. ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 65(3), 151–168.
Bouncken, R. B., & Reuschl, A. J. (2018). Coworking-spaces: How a phenomenon of the sharing economy builds a novel trend for the workplace and for entrepreneurship. Review of Managerial Science, 12(1), 317–334. https://doi.org/10.1007/s11846-016-0215-y.
Bouncken, R. B., Ratzmann, M., & Winkler, V. A. (2008). Cross-cultural innovation teams: Effects of four types of attitudes towards diversity. International Journal of Business Strategy (IJBS), 8(2), 26–36.
Bouncken, R. B., Clauss, T., & Reuschl, A. (2016). Coworking-spaces in Asia: A business model design perspective. Paper presented at the SMS special conference Hong Kong, Hong Kong, China.
Bouncken, R. B., Aslam, M. M., & Reuschl, A. J. (2018a). The dark side of entrepreneurship in coworking-spaces. In A. T. Porcar & D. R. Soriano (Hrsg.), Inside the mind of the entrepreneur. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62455-6_10.
Bouncken, R. B., Laudien, S. M., Fredrich, V., & Görmar, L. (2018b). Coopetition in coworking-spaces: Value creation and appropriation tensions in an entrepreneurial space (journal article). Review of Managerial Science, 12(2), 385–410. https://doi.org/10.1007/s11846-017-0267-7.
Capdevila, I. (2013). Knowledge dynamics in localized communities: Coworking spaces as microclusters. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.2414121.
Capdevila, I. (2014). Coworking spaces and the localized dynamics of innovation. The case of Barcelona. International Journal of Innovation Management, 19(3), 1540004. https://doi.org/10.2139/ssrn.2502813.
Carless, S. A., & Wintle, J. (2007). Applicant attraction: The role of recruiter function, work – life balance policies and career salience. International Journal of Selection and Assessment, 15(4), 394–404.
Castilho, M. F., & Quandt, C. O. (2017). Collaborative capability in coworking spaces: Convenience sharing or community building? Technology Innovation Management Review, 7(12), 32–42.
Chen, Y. (2008). Possession and access: Consumer desires and value perceptions regarding contemporary art collection and exhibit visits. Journal of Consumer Research, 35(6), 925–940.
Cohen, B., & Kietzmann, J. (2014). Ride on! Mobility business models for the sharing economy. Organization & Environment, 27(3), 279–296. https://doi.org/10.1177/1086026614546199.
Cooper, C. D., & Kurland, N. B. (2002). Telecommuting, professional isolation, and employee development in public and private organizations. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 23(4), 511–532.
Davies, A., & Tollervey, K. (2013). The style of coworking: Contemporary shared workspaces. Munich: Prestel Verlag.
Davis, G. F. (2016). The vanishing American corporation: Navigating the hazards of a new economy. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.
Dunning, J. H. (1988). The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. Journal of International Business Studies, 19, 1–31.
Ellemers, N., Van Knippenberg, A., De Vries, N., & Wilke, H. (1988). Social identification and permeability of group boundaries. European Journal of Social Psychology, 18(6), 497–513.
eurostat. (2020). Selbstständigkeit nach Geschlecht, Alter und Bildungsabschluss. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-datasets/-/LFSQ_ESGAED. Zugegriffen am 16.01.2020.
Foertsch, C. (2018). 1,7 Millionen Mitglieder werden 2018 weltweit in Coworking Spaces arbeiten. http://www.deskmag.com/de/1-7-millionen-mitglieder-werden-2018-in-coworking-spaces-arbeiten-weltweite-umfrage-studie-marktberi. Zugegriffen am 05.01.2020.
Foertsch, C., & Cagnol, R. (2013). The history of coworking in a timeline. http://www.deskmag.com/en/the-history-of-coworking-spaces-in-a-timeline. Zugegriffen am 05.01.2020.
Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review. ephemera, 15(1), 193–205.
Gandini, A. (2016a). Coworking: The freelance mode of organisation? In The reputation economy (S. 97–105). London: Palgrave Macmillan.
Gandini, A. (2016b). Digital work: Self-branding and social capital in the freelance knowledge economy. Marketing Theory, 16(1), 123–141.
Garrett, L. E., Spreitzer, G. M., & Bacevice, P. A. (2017). Co-constructing a sense of community at work: The emergence of community in coworking spaces. Organization Studies, 38(6), 821–842. https://doi.org/10.1177/0170840616685354.
Gibson, V. (2003). Flexible working needs flexible space? Towards an alternative workplace strategy. Journal of Property Investment & Finance, 21(1), 12–22. https://doi.org/10.1108/14635780310468275.
Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology. Organizational Research Methods, 16(1), 15–31.
Goh, K.-Y., Heng, C.-S., & Lin, Z. (2013). Social media brand community and consumer behavior: Quantifying the relative impact of user-and marketer-generated content. Information Systems Research, 24(1), 88–107.
Golden, T. D., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2008). The impact of professional isolation on teleworker job performance and turnover intentions: Does time spent teleworking, interacting face-to-face, or having access to communication-enhancing technology matter? Journal of Applied Psychology, 93(6), 1412.
Görmar, L., Barwinski, R., Bouncken, R., & Laudien, S. (2020). Co-Creation in coworking-spaces: Boundary conditions of diversity. Knowledge Management Research & Practice 1–12.
Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(9), 2047–2059.
Hampton, K. N., & Gupta, N. (2008). Community and social interaction in the wireless city: Wi-fi use in public and semi-public spaces. New Media & Society, 10(6), 831–850.
Hartl, B., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2016). Do we need rules for „what’s mine is yours“? Governance in collaborative consumption communities. Journal of Business Research, 69(8), 2756–2763.
Hennig-Thurau, T., Henning, V., & Sattler, H. (2007). Consumer file sharing of motion pictures. Journal of Marketing, 71(4), 1–18.
Hughes, M., Rigtering, J. P. C., Covin, J. G., Bouncken, R. B., & Kraus, S. (2018). Innovative behaviour, trust and perceived workplace performance. British Journal of Management, 29(4), 750–768. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12305.
Jacobides, M. G., & Billinger, S. (2006). Designing the boundaries of the firm: From „Make, Buy, or Ally“ to the dynamic benefits of vertical architecture. Organization Science, 17(2), 249–261. http://www.jstor.org/stable/25146029.
Johns, T., & Gratton, L. (2013). The third wave of virtual work. Harvard Business Review, 91(1), 66–73.
Jones, A. M. (2013). The fifth age of work: How companies can redesign work to become more innovative in a cloud economy. Portland: Night Owls Press LLC.
Kalleberg, A. L. (2001). Organizing flexibility: The flexible firm in a new century. British Journal of Industrial Relations, 39(4), 479–504.
Kalleberg, A. L., Reskin, B. F., & Hudson, K. (2000). Bad jobs in America: Standard and nonstandard employment relations and job quality in the United States. American Sociological Review, 65, 256–278.
Kathan, W., Matzler, K., & Veider, V. (2016). The sharing economy: Your business model’s friend or foe? Business Horizons, 59(6), 663–672. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.06.006.
Kossek, E. E., Thompson, R. J., & Lautsch, B. A. (2015). Balanced workplace flexibility: Avoiding the traps. California Management Review, 57(4), 5–25.
Kwiatkowski, A., & Buczynski, B. (2014). Coworking: Building community as a space catalyst. New York: Cohere, LCC.
Lamberton, C. P., & Rose, R. L. (2012). When is ours better than mine? A framework for understanding and altering participation in commercial sharing systems. Journal of Marketing, 76(4), 109–125.
Mäkelä, M. M., & Turcan, R. V. (2007). Building grounded theory in entrepreneurship research. In Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship (S. 122–143). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Mark, G., & Su, N. M. (2010). Making infrastructure visible for nomadic work. Pervasive and Mobile Computing, 6(3), 312–323.
Merkel, J. (2015). Coworking in the city. ephemera, 15(2), 121–139.
Möhlmann, M. (2015). Collaborative consumption: Determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again. Journal of Consumer Behaviour, 14(3), 193–207. https://doi.org/10.1002/cb.1512.
Moriset, B. (2014). Building new places of the creative economy. The rise of coworking spaces. Paper presented at the 2nd geography of innovation international conference, January 2014, Utrecht.
Mudambi, R., Li, L., Ma, X., Makino, S., Qian, G., & Boschma, R. (2018). Zoom in, zoom out: Geographic scale and multinational activity. Journal of International Business Studies, 49(8), 929–941. https://doi.org/10.1057/s41267-018-0158-4.
Oskam, J., & Boswijk, A. (2016). Airbnb: The future of networked hospitality businesses. Journal of Tourism Futures, 2(1), 22–42. https://doi.org/10.1108/JTF-11-2015-0048.
Pohler, M. N. (2012). Neue Arbeitsräume für neue Arbeitsformen: Coworking Spaces. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 37(1), 65–78.
Raffaele, C., & Connell, J. (2016). Telecommuting and co-working communities: What are the implications for individual and organizational flexibility? In Sushil, Connell, & Burgess (Hrsg.), Flexible work organizations (S. 21–35). Springer India.
Reuschl, A. J., & Bouncken, R. B. (2017). Coworking-spaces als neue organisationsform in der sharing economy. In M. Bruhn & K. Hadwich (Hrsg.), Dienstleistungen 4.0. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Richter, C., Kraus, S., & Syrjä, P. (2015). The shareconomy as a precursor for digital entrepreneurship business models. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 25(1), 18–35.
Schaefers, T., Lawson, S. J., & Kukar-Kinney, M. (2016). How the burdens of ownership promote consumer usage of access-based services. Marketing Letters, 27(3), 569–577.
Schürmann, M. (2013). Coworking Space: Geschäftsmodell für Entrepreneure und Wissensarbeiter. Dordrecht: Springer-Verlag.
Spinuzzi, C. (2012). Working alone together: Coworking as emergent collaborative activity. Journal of Business and Technical Communication, 26(4), 399–441. https://doi.org/10.1177/1050651912444070.
Spinuzzi, C., Bodrožić, Z., Scaratti, G., & Ivaldi, S. (2019). „Coworking is about community“: But what is „community“ in coworking? Journal of Business Technical Communication, 33(2), 112–140.
Spreitzer, G. M., Cameron, L., & Garrett, L. (2017). Alternative work arrangements: Two images of the new world of work. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 473–499.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. London: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications.
Täuscher, K., Bouncken, R., & Pesch, R. (2020). Gaining legitimacy by being different: Optimal distinctiveness in crowdfunding platforms. Academy of Management Journal. Accepted.
Turkina, E., Van Assche, A., & Kali, R. (2016). Structure and evolution of global cluster networks: Evidence from the aerospace industry. Journal of Economic Geography, 16(6), 1211–1234. https://doi.org/10.1093/jeg/lbw020.
Wey Smola, K., & Sutton, C. D. (2002). Generational differences: Revisiting generational work values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 23(4), 363–382.
Whittle, A., & Mueller, F. (2009). ‚I could be dead for two weeks and my boss would never know‘: Telework and the politics of representation. New Technology, Work and Employment, 24(2), 131–143.
Workman, M. (2005). Virtual team culture and the amplification of team boundary permeability on performance. Human Resource Development Quarterly, 16(4), 435–458.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2020 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Görmar, L., Bouncken, R.B. (2020). Gemeinsames Arbeiten in der dezentralen digitalen Welt. In: Daum, M., Wedel, M., Zinke-Wehlmann, C., Ulbrich, H. (eds) Gestaltung vernetzt-flexibler Arbeit. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61560-7_14
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61560-7_14
Published:
Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-61559-1
Online ISBN: 978-3-662-61560-7
eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)