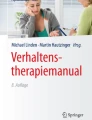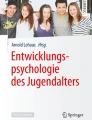Zusammenfassung
Der alltägliche Lebensraum „(home range“) umfasst die Wohnung, das Wohnumfeld und Aktivitäts- und Begegnungsorte in Quartieren und Gemeinwesen. Die Erschließung sozial-räumlicher Orte außerhalb der Wohnung für Menschen mit Behinderungen, ihre Inklusion in Sozialräumen gilt als Königsweg für die Ermöglichung vollumfänglicher, selbstbestimmter und gleichberechtigter Teilhabe. In dem Beitrag wird geklärt, was unter Sozialraum und was unter sozialer Inklusion zu verstehen ist. Der Begriff Sozialraum ist im deutschsprachigen Raum weit verbreitet und eng mit dem Fachkonzept Sozialraumorientierung verbunden, das andernorts weitgehend unbekannt ist. International wird die anwendungsorientierte Forschung unter dem Begriff soziale Inklusion zusammengefasst. Vorgestellt wird ein Rahmenmodell, in dem sich die Faktoren verorten lassen, die Aspekte der sozialen Inklusion befördern oder behindern. Vorgeschlagen wird mithilfe ökologisch-psychologischer Theorien spezifischer die ökologischen Kontexte (Mikrosysteme oder Behavior Settings) zu fokussieren, in denen soziale Inklusion gelingt oder misslingt (z. B. im Nachbarschaftsgeschehen, in Geschäften, in Vereinen), und die dort stattfindenden Prozesse feiner zu beschreiben. Die Forschung zur sozialen Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist anwendungsorientiert. Anhand der Themen Sozialraumorientierung, Sozialplanung, Begegnungen im Sozialraum und Nachbarschaft wird exemplarisch deutlich, was das für die Weiterentwicklung der Forschung bedeutet.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Der in der Sozialgeografie gebräuchliche Begriff „home range“ (Porteous 1977), der sich mit „alltäglicher Lebensraum eines Menschen“ übersetzen lässt, macht deutlich, wie eng das Wohnen mit der alltäglichen Lebensführung verquickt ist. Der alltägliche Lebensraum umfasst die Wohnung, das Wohnumfeld und Aktivitäts- und Begegnungsorte in Quartieren und Gemeinwesen. Die Erschließung solcher sozial-räumlichen Orte für Menschen mit Behinderungen, ihre Inklusion in Sozialräumen gilt als Königsweg für die Ermöglichung vollumfänglicher, selbstbestimmter und gleichberechtigter Teilhabe.
In diesem Beitrag wird zunächst geklärt, was unter Sozialraum und was unter sozialer Inklusion zu verstehen ist. Der Begriff Sozialraum ist im deutschsprachigen Raum weit verbreitet und eng mit dem Fachkonzept Sozialraumorientierung verbunden, das andernorts weitgehend unbekannt ist. International wird die empirische anwendungsorientierte Forschung unter dem Begriff soziale Inklusion zusammengefasst. Im zweiten Abschnitt wird ein Rahmenmodell vorgestellt, in dem sich die Faktoren verorten lassen, die Aspekte der sozialen Inklusion befördern oder behindern. Zusätzlich schlage ich vor, mithilfe ökologisch-psychologischer Theorien spezifischer die ökologischen Kontexte (Mikrosysteme oder Behavior Settings) in der Forschung zu fokussieren, in denen soziale Inklusion gelingt oder misslingt (z. B. im Nachbarschaftsgeschehen, in Geschäften, in Vereinen), und die dort stattfindenden Prozesse feiner zu beschreiben. Der dritte Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über Themen und Befunde der Forschung. Die Forschung zur sozialen Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist anwendungsorientiert. Anhand der Themen Sozialraumorientierung, Sozialplanung, Begegnungen im Sozialraum und Nachbarschaft wird exemplarisch deutlich, was das für die Weiterentwicklung der Forschung bedeutet.
1 Sozialraum und soziale Inklusion: Konzepte und Forschungsstränge
Ein Ziel dieses Beitrags ist es, die internationale Forschung zur sozialen Inklusion mit der deutschsprachigen Sozialraum-Forschung zusammenzubringen. Das Sozialraum-Konzept, wie es in Deutschland in der Sozialen Arbeit und Pädagogik gebraucht wird, ist in der internationalen Forschung zu Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weitgehend unbekannt. Beide Forschungsstränge haben durch die in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verankerten Leitziele Teilhabe und Inklusion an Bedeutung und Umfang gewonnen. Dabei hat der Inklusionsbegriff zwei unterschiedliche Bedeutungen. Er steht, erstens, für ein universell gültiges menschenrechtliches Prinzip, das das Ziel hat, allen Menschen auf der Basis gleicher Rechte ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. Inklusion meint in der UN-BRK die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, die auch anderen zur Verfügung stehen (im Gegensatz zur Exklusion). Zweitens ist Inklusion auch ein Prinzip für die Gestaltung gesellschaftlicher Angebote. Es geht davon aus, dass die inklusive Gestaltung von Infrastrukturen, Einrichtungen, Dienstleistungen und Aktivitäten am besten geeignet ist, die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe zu verwirklichen (Laumann und Dieckmann 2020).
Ein Hindernis für die Verwirklichung der sozialen Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist die unklare Definition des Konzepts in der Forschung und Politik. Aus der Zusammenschau der Definitionen schlagen Simplican et al. (2015) vor, soziale Inklusion als Interaktion zwischen zwei wichtigen Lebensbereichen, den interpersonalen Beziehungen und der Teilnahme an Aktivitäten im Gemeinwesen, zu begreifen. Beide Bereiche sind notwendig für soziale Inklusion, sie überlappen sich und können sich gegenseitig unterstützen. Eine stärkere Beteiligung im Gemeinwesen lässt das soziale Netzwerk einer Person wachsen. Ein größeres und vielfältigeres Netz von sozialen Beziehungen erleichtert den Zugang zu und das Niveau der Einbeziehung in Aktivitäten im Gemeinwesen (Petry et al. 2005).
Simplican et al. (2015) unterscheiden strukturelle und funktionale Komponenten interpersonaler Beziehungen und der Teilnahme an Aktivitäten im Gemeinwesen. Bei sozialen Beziehungen lassen sich die Arten von Personen in einem sozialen Netzwerk unterscheiden (z. B. Familienmitglieder, professionelle Assistenzpersonen, Partner*innen, Freund*innen, Bekanntschaften – ob mit oder ohne Behinderungen). Strukturell lassen sich bei sozialen Beziehungen u. a. die Dauer einer Beziehung, ihr Ursprung, die Häufigkeit von Interaktionen und die Örtlichkeit, in welcher sie stattfinden, unterscheiden. Soziale Beziehungen können mehr oder weniger reziprok oder intensiv sein. Sie haben einen eher formellen oder informellen Charakter (Rollenbeziehungen versus persönliche Beziehungen). Persönliche soziale Netzwerke lassen sich anhand ihrer Homogenität, ihrer Größe, der geographischen Verteilung der Mitglieder und der Dichte (Vernetzung der Mitglieder untereinander) unterscheiden. Die Netzwerkforschung interessiert sich besonders für die Funktionen, die Beziehungspartner*innen haben können (Walker et al. 1977; Heidbrink et al. 2009). Neben der emotionalen, instrumentellen und informationellen Funktion können soziale Beziehungen auch Sinn und Identität stiften, Zugehörigkeit und Sicherheit vermitteln (Simplican et al. 2015 nennen das „bonding“). Und über soziale Beziehungen eröffnen sich Möglichkeiten, neue Personen kennen zu lernen (brückenbauende Funktion).
Bei der Teilnahme im Gemeinwesen unterscheiden Simplican et al. (2015) kategorial zwischen Freizeitaktivitäten, politischen bzw. bürgerschaftlichen Aktivitäten, Arbeit, Bildung, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie religiösen und kulturellen Aktivitäten. Die Teilnahme kann segregiert (wenn Menschen mit Behinderung und Assistenzpersonen in für sie besonders gestalteten Settings unter sich bleiben), halb-segregiert (wenn ausschließlich Menschen mit Behinderung und Assistenzpersonen an einer Aktivität in allgemeinen Settings beteiligt sind) oder inklusiv (unter gemischter Beteiligung in allgemeinen Settings) erfolgen. Grade der Beteiligung können verschieden sein – von der bloßen Präsenz im Gemeinwesen bis zur Einnahme zentraler oder weniger zentraler Rollen in einem konkreten Geschehen.
Die Sozialraumorientierung ist ein Fachkonzept, das seine Ursprünge in der Gemeinwesenarbeit der Sozialen Arbeit hat. Im Kern geht es darum, nicht Menschen zu verändern, sondern in den Sozialräumen Verhältnisse und Arrangements so zu gestalten, dass mehr Teilhabemöglichkeiten und ein Mehr an individueller Teilhabe entstehen. Zu den fünf von Hinte (2016) formulierten Grundprinzipien gehören die Orientierung am Willen der Menschen (mit Energie besetzte Ziele), die Unterstützung der Eigeninitiative und Selbsthilfe, die Aktivierung der Ressourcen der Menschen und der Sozialräume sowie die Kooperation in bereichsübergreifenden Netzwerken. Die Sozialraumorientierung ist ein stärken- und ressourcenorientierter Ansatz, dem eine sozial-ökologische Betrachtungsperspektive zugrunde liegt (DHG 2021).
Sozialräume werden auf drei verschiedene Weisen konstituiert: aus der Betrachtung eines Individuums, aus dem Blick auf ein sozial-geteiltes Quartier oder als Verwaltungs- und Planungsraum im Gemeinwesen (Laumann und Dieckmann 2020).
Auf der individuellen Ebene bezeichnet Sozialraum den individuellen, räumlichen wie sozialen Handlungsraum einer Person (Dieckmann et al. 2013, S. 22). Der alltägliche Lebensraum (home range) gibt die geographischen Örtlichkeiten, Wegstrecken und Gebiete an, in denen sich eine Person im Alltag bewegt, in denen sie handelt und anderen begegnet. Der interpersonale Handlungsraum einer Person lässt sich durch ihr persönliches Netzwerk sozialer Beziehungen abbilden.
Auf der Quartiersebene bezeichnet Sozialraum einen von einer Gruppe von Personen geteilten, durch Alltagshandlungen und interpersonale Bezüge angeeigneten und begrenzten Raum, der sich in kognitiven Karten, emotionalen Bindungen und Identifikationen niederschlägt. Die Grenzen dieser Art von Sozialräumen sind unscharf und überlappend. In Sozialräumen entfalten sich Aktivitäten, Partizipations- und Begegnungsmöglichkeiten, Kooperationen und Konflikte. Sie werden von sozialen Netzwerken getragen und gleichzeitig werden Netzwerke in ihnen geknüpft (Laumann und Dieckmann 2020). Ein Quartier (ein Stadtteil oder eine dörfliche Gemeinde) umfasst neben den Wohnungen und dem unmittelbaren Wohnumfeld auch einen Nahraum, in dem beispielsweise Einrichtungen für die tägliche oder regelmäßige Versorgung zu erreichen sind.
Auf der Ebene des Gemeinwesens sind Sozialräume abgezirkelte Planungsräume für die kommunale Gestaltung. Sozialräume zeichnet eine Sozialstruktur und eine sozial-kulturell geprägte Gestaltung aus, die Infrastrukturen, Angebote und Aktivitäten, die Gestaltung der räumlichen und baulichen Umgebung, ökonomische Aspekte und vieles andere mehr umfasst. Die Gestaltung unterliegt einem geschichtlichen Wandel. Die Festlegung von Planungsräumen soll sich an den in der Lebenswelt von Bürger*innen verankerten Sozialräumen orientieren.
Sozialräume auf der Quartiers- oder Gemeinwesensebene stellen also Möglichkeitsräume für Menschen mit Beeinträchtigung und andere Bevölkerungsgruppen dar, die sich verändern lassen und für den Einzelfall erschlossen werden können.
2 Rahmentheorien für die Identifikation förderlicher und hinderlicher Bedingungen
Wenn es darum geht, förderliche und hinderliche Bedingungen für die Entwicklung sozialer Beziehungen und die Teilnahme an Aktivitäten im Gemeinwesen zu identifizieren, schlagen Simplican et al. (2015) ein ökologisches Rahmenmodell vor, in dem sie Einflussfaktoren auf verschiedenen Ebenen verorten. In ähnlicher Weise hatten bereits Overmars-Marx et al. (2014) in einem Literaturüberblick zu Nachbarschaftsgeschehen Befunde zu Einflussbedingungen geordnet (s. Abschn. 7.4.4). In dem Rahmenmodell werden fünf verschiedene Ebenen unterschieden. Auf der personalen Ebene wirken sich Merkmale einer Person wie individuelle Kompetenzen, die Fähigkeit zur Selbstmotivation und Handlungsplanung, Selbstvertrauen und das sozial-räumliche Wissen auf die soziale Inklusion aus. Der Grad der sozialen Inklusion beeinflusst wiederum Variablen der Person, wie ihre Zufriedenheit, ihren Selbstwert, ihr Zugehörigkeitsgefühl oder die Einsamkeit einer Person. Auf der interpersonalen Ebene geht es um Beziehungen von Menschen mit Behinderungen zu Assistenzpersonen, Familienmitgliedern, Freund*innen usw. sowie um die Einstellungen der Mitglieder ihres sozialen Netzwerks. Positive Auswirkungen zeigen sich im Vertrauen zu- und Respekt füreinander und in einem wachsenden sozialen Kapital. Zu negativen Auswirkungen gehören Erfahrungen von Diskriminierung oder Gewalt in Beziehungen. Die organisationale Ebene thematisiert sowohl Bedingungen in Organisationen, die professionelle Teilhabeleistungen erbringen, als auch Bedingungen in Familien, in denen ein erheblicher Teil von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung lebt. Betrachtet werden beispielsweise Organisations- und Familienkulturen. Auf der Ebene des Gemeinwesens geht es um Wohnformen, die Verfügbarkeit von angemessenen Unterstützungsdiensten, den Zugang zu Transportdiensten und anderen Angeboten und Ressourcen im Gemeinwesen. Betrachtet werden auch die Einstellungen wichtiger Akteure im Gemeinwesen, die historisch entstandene Kultur in Bezug auf Menschen mit Behinderungen sowie räumlich-physische Aspekte. Die sozial-politische Ebene bezieht sich u. a. auf Gesetze und deren Umsetzung, wirtschaftliche Faktoren, die Finanzierung von Leistungen und die historische Entwicklung von Unterstützungsdiensten. Wenig systematische Forschung gäbe es laut Simplican et al. (2015) zu der Frage, was politischen Wandel bewirken kann. Anekdotisch sei zu konstatieren, dass die Mobilisierung von Selbstvertretungsgruppen, Angehörigenvereinigungen oder Wohlfahrtsverbänden immer wieder politische Effekte zeitige.
Das skizzierte Rahmenmodell ist in der Lage, die Ergebnisse bislang wenig aufeinander bezogener Studien zu sortieren und so einen Überblick zu schaffen. Es öffnet den Blick für Umweltbedingungen unterschiedlicher Art und Größenordnung, die die soziale Inklusion befördern oder behindern. Und es zeigt auf, welche Effekte soziale Inklusion auf diesen Ebenen haben kann. Umweltbedingungen und Teilhabegeschehen wirken wechselseitig aufeinander ein, die Transaktionen können positive Dynamiken erzeugen.
Allerdings lässt sich das konkrete Zusammenspiel von Bedingungen in den verschiedenen alltäglichen Kontexten nicht mit diesem Rahmenmodell abbilden. Aus einer ökologisch-psychologischen Perspektive ist die Alltagswelt strukturiert durch sozial-kulturelle Geschehenssysteme, in denen Variablen in geordneten Beziehungen zueinander stehen, während andere Faktoren als Umwelt auf diese Geschehenssysteme einwirken. Wenn Untersuchungen spezifischer auf einen Kontext angelegt würden (z. B. auf Nachbarschaften und Nachbarschaftsgeschehen, Abschn. 7.4.4), könnte die Analyse von Barrieren und förderlichen Bedingungen handlungsnäher erfolgen und praktisches Handlungswissen generieren.
In der Psychologie sind ab den 1970er Jahren Ansätze entstanden, die menschliches Handeln und Erleben von ihrem ökologischen Kontext her zu verstehen suchen. Für Urie Bronfenbrenner spielt sich das Alltagshandeln von Individuen in Mikrosystemen ab: „Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, das die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit seinen eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt. Ein Lebensbereich ist ein Ort, an dem ein Mensch direkte Interaktion mit anderen eingehen kann.“ (Bronfenbrenner 1990, S. 76). Mikrosysteme sind in größere Umweltkontexte eingebettet (Meso-, Exo- und Makrosysteme). Bronfenbrenners Ökologiekonzept wurde u. a. von Monika Seifert in ihrer Studie zum Wohnalltag von Erwachsenen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung (Seifert 1997a, b) eingesetzt, um Befunde zu Dimensionen der Lebensqualität im „Mikrosystem Wohnbereich“ zu verorten und dieses „im Kontext übergreifender Systeme“ (Seifert 1997a, S. 201) zu verstehen.
Bei der Formulierung des Mikrosystems greift Bronfenbrenner auf ein anderes Konzept zurück, das Behavior Setting von Roger Barker (1903–1980). Barker beschreibt nicht nur die strukturellen Merkmale eines unmittelbaren Lebensbereichs, an dem eine Person teilhat, sondern auch die Dynamik des darin ablaufenden Geschehens (Barker und Associates 1978). Ein Behavior Setting ist ein überindividuelles, konkretes und sozial-kulturelles Geschehenssystem. Beispielsweise lassen sich ein Lebensmittelladen, ein Yogakurs, ein zirkulierender Stadtbus, ein Nachbarschaftsgeschehen, ein Café, ein Schwimmbad oder Spazierrunden im Park als Behavior Settings begreifen. In Anlehnung an Kaminski (1995) werden hier kurz die strukturellen Merkmale und die Geschehensdynamik eines Behavior Settings beschrieben – ausführlicher ist das am Beispiel eines Lebensmittelmarkts bei Dieckmann (2022) nachzulesen:
Ein Behavior Setting hat klare räumliche und zeitliche Grenzen, in denen das Geschehen stattfindet, und eine interne soziale Struktur. D. h. im Geschehen gibt es verschiedene funktionale Positionen, die mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten verbunden sind – die Leader-Position, herausgehobene oder einfache Teilnehmerrollen, oft auch die Rolle als bloße Zuschauende des Geschehens. Das Behavior Setting-Geschehen zeichnet sich durch typische Handlungsmuster aus und läuft nach einem bestimmten Programm ab, zu dem phasenspezifische Abläufe und Skripte für die verschiedenen Positionen („Drehbücher“ für Rollen), rollenspezifische Normen und Angemessenheitsnormen, die für alle Teilnehmer*innen gelten, zählen. Neben der Programmstruktur eröffnen Behavior Settings je nach Settingtyp verschieden große Freiräume für soziale Interaktionen, die mehr oder weniger losgelöst vom Programmgeschehen sein können. In einem Behavior Setting sind das räumliche Milieu und die Verhaltensobjekte auf das Handlungsgeschehen abgestimmt (Synomorphie). Der Zugang zu einem Behavior Setting kann unterschiedlich geregelt sein. Die Teilnahme kann für Personen verpflichtend oder freiwillig sein und von Zugangskriterien abhängen (z. B. Eintrittsgeld, Zugehörigkeit zu einer Gruppe). Außerdem sind Behavior Settings unterschiedlich autonom bezogen auf ihre Gestaltung (freie Gestaltung versus stark von außen reglementiert). Das Geschehen in einem Behavior Setting wird durch drei Arten von Zielen gesteuert: die Programmziele (Funktion des Behavior Setting); die individuellen Zielsetzungen der Teilnehmenden, die Programmziele spezifizieren, aber auch darüber hinaus gehen können; die Aufrechterhaltungsziele, die dazu führen, dass Störungen vermieden oder beseitigt werden.
Dieckmann (2022) hat gezeigt, wie sich aus dem Behavior Setting-Konzept differenziert Arten von Barrieren ableiten lassen, die grundsätzlich für alle derartigen Geschehenssysteme gelten (s. Tab. 7.1). Diese Barrieren werden nicht von den individuellen Merkmalen spezifischer Personenkreise abgeleitet. Eine inklusive barrierearme Gestaltung sollte an den ökologischen Grundeinheiten unseres Alltagslebens ansetzen. Ein weiteres Beispiel für den Nutzen der ökologisch-psychologischen Sichtweise wird weiter unten für die Analyse von Begegnungen im Sozialraum gegeben.
3 Zum Stand der Forschung zur sozialen Inklusion
Für eine prägnante Zusammenfassung des Forschungsstandes werden hier mit Amado (2012) fünf Stufen der sozialen Inklusion unterschieden (s. Abb. 7.1). Die physische Anwesenheit von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in den Sozialräumen wird gesellschaftlich weitgehend anerkannt. Auch nehmen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zunehmend – in einigen Bereichen mehr, in anderen weniger – an den verschiedenen Angeboten und Aktivitäten im Gemeinwesen teil, z. B. als Kund*innen in Geschäften oder Friseursalons, als Gäste in Lokalen, als Teilnehmer*innen an kulturellen Angeboten und Freizeitaktivitäten, als Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft (McCarron et al. 2011). Der öffentliche Nahverkehr und soziale Medien werden noch wenig genutzt und die Freizeit wird oft nicht in Begleitung selbst gewählter Freund*innen verbracht (Amado et al. 2013). Häufig geschieht die Teilnahme im Rahmen einer von Assistenzpersonen „geleiteten“ Gruppe, sodass die Einzelperson selbst kaum mit Menschen ohne intellektuelle Beeinträchtigung interagiert (Clement und Bigby 2010, S. 160). Ein Beispiel wäre der Einkauf einer Wohngruppe im Supermarkt, bei dem sich die Gruppe wie in einer Blase, dirigiert durch den Einkaufszettel einer Mitarbeiterin durch die Regalgänge bewegt, ohne dass die einzelnen intellektuell beeinträchtigten Menschen mit dem Verkaufspersonal als Kund*innen ins Gespräch kommen.
Insgesamt resultieren aus der gemeinsamen Teilnahme selten soziale Kontakte, die zu neuen gemeinsamen Aktivitäten führen. Noch seltener entwickeln sich engere Freundschaften oder Wohn- oder Lebenspartnerschaften zwischen Menschen mit und ohne intellektuelle Beeinträchtigung (Dieckmann et al. 2013, S. 20; Amado et al. 2013). Die sozialen Netzwerke von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung sind im Mittel erheblich kleiner als die der Allgemeinbevölkerung (Robertson et al. 2001) und viele Beziehungen sind über längere Jahre nicht stabil (Haveman und Stöppler 2021). Der Großteil der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung hat keine/n feste/n Lebenspartner*in und keine eigenen Kinder. Zu den Beziehungspartner*innen gehören typischerweise neben den professionellen Assistenzpersonen Angehörige der Herkunftsfamilie und andere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Sehr viel seltener bestehen enge Kontakte zu Menschen ohne Behinderung. Neben Assistenzpersonen sind Eltern oder Geschwister oft die wichtigsten Vertrauenspersonen. Freundschaften bleiben stark an Kontexte gebunden (z. B. Werkstatt für behinderte Menschen, Freizeitgruppen, Wohngemeinschaften) und machen diese anfällig für Abbrüche nach dem Ausscheiden aus einem solchen Setting. Selbst gewählte Beziehungen zu anderen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden geschätzt, weil sie als entlastend erlebt werden, zur Selbstermächtigung beitragen (nicht nur in Selbstvertretungsgruppen) und auch die Möglichkeit zu intimeren Beziehungen bieten. Noch wenig erforscht ist, welche Rolle solche Beziehungen für die Inklusion im Gemeinwesen spielen können. In allen Wohnformen finden sich sowohl Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, deren Sozialbeziehungen auf die direkten Unterstützungspersonen beschränkt bleiben, als auch solche, die über ein ausdifferenziertes Beziehungsnetz verfügen (Dieckmann et al. 2015, S. 15). In zwei großen und repräsentativen Studien aus den USA (Stancliffe et al. 2007) und aus Irland (McCarron et al. 2011) berichtete jeweils die Hälfte der Befragten von Einsamkeitsgefühlen, die manchmal oder oft auftreten. In der irischen Studie gab ein Drittel an, Schwierigkeiten zu haben, Freund*innen zu finden. In der amerikanischen Studie wurde vor allem die Abwesenheit eines Partners oder einer Partnerin beklagt.
Der Grad der Teilnahme im Gemeinwesen von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung ist geringer als in der Allgemeinbevölkerung und als in anderen Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen (Amado et al. 2013). Die Partizipation sinkt mit dem Alter und mit dem Grad der Beeinträchtigung der Personen. Verdonschot et al. (2009) listen nach Auswertung von elf Studien folgende Umweltfaktoren auf, die die Teilnahme im Gemeinwesen fördern: kleine Wohneinheit (institutionelle Wohnformen wirken sich negativ aus), Vielfalt und Attraktivität von Angeboten in der Wohnumgebung, Arbeitsangebote, Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln, flexible Unterstützung durch Assistenzpersonen, Engagement der Herkunftsfamilie, individuelle Wahlmöglichkeiten und Ausrichtung auf Selbstbestimmung sowie die Partizipation von Bewohner*innen an Entscheidungen von Wohndiensten. Der Beitrag von Heddergott und Dieckmann in diesem Band (Kap. 4) geht noch genauer auf Zusammenhänge ein. Zur sozialen Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung, die in ihrer Herkunftsfamilie leben, liegen noch kaum Forschungsergebnisse vor (Amado et al. 2013).
Anders als barrierefreie Umgebungen oder inklusive Angebote sind persönliche soziale Beziehungen nicht einfach durch Vorkehrungen herstellbar. Sie wachsen aufgrund der Initiative und der gegenseitigen Sympathie der Beteiligten. Allerdings können Akteure im Gemeinwesen durch die vollwertige Anerkennung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dafür sorgen, dass dieser Personenkreis mit seinen Lebenserfahrungen und Ausdrucksweisen gesellschaftlich attraktiver erscheint. Interventionen zur sozialen Inklusion folgen zwei Strategien (Amado et al. 2013): Zum einen werden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in allgemeine Settings im Gemeinwesen integriert. Durch den regulären Kontakt entstehen Gelegenheiten zu bedeutungsvollen Interaktionen. Ein gut beforschtes Beispiel ist die Beteiligung von Rentner*innen mit intellektueller Beeinträchtigung an allgemeinen Seniorengruppen und ehrenamtlichen Aktivitäten in Australien (Stancliffe et al. 2013). Eine zweite Strategie zielt auf die Veränderung von Einstellungen wichtiger Akteure gegenüber Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in den Mainstream-Angeboten, z. B. in Sportvereinen oder Kirchengemeinden. Zum einen geht es um die Identifikation von Barrieren (z. B. Mobilität, Kommunikationsschwierigkeiten), zum anderen um die Erfahrung von Gewinnen durch die Teilnahme von behinderten Menschen (z. B. durch eine sensiblere und sorgsamere Interaktion in Gruppen, das Zeigen freundschaftlicher Verbundenheit). Als hilfreiche Elemente haben sich die Einführung eines Mentoring, die Zurverfügungstellung praktischer Informationen und der oft vorübergehende Einsatz von Assistenzpersonen erwiesen. Insgesamt gilt es, das Gemeinwesen und seine Akteure stärker in die Pflicht zu nehmen.
Noch wenig erforscht ist der Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Aktivitäten im Gemeinwesen und der wahrgenommenen Zugehörigkeit von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei allen Beteiligten. Zudem wird deutlich, dass der präferierte Grad an Inklusion an Aktivitäten individuell unterschiedlich ist, wobei das Anspruchsniveau auch mit dem Sozialisations- und Erfahrungshintergrund zusammenhängt. Bei der Messung der Teilnahme an Aktivitäten standen bisher als Indikatoren die Teilnahmemöglichkeit (ja-nein), die Häufigkeit und die Intensität der Beteiligung im Vordergrund (s. Kap. 5).
4 Aktuelle Forschungsthemen
Fragestellungen, Methoden und Befunde der anwendungsorientierten Forschung sollen an den vier aktuellen Forschungsthemen Handlungskonzept Sozialraumorientierung, Planung inklusiver Gemeinwesen, Begegnungen im Sozialraum und Nachbarschaft aufgezeigt werden.
4.1 Handlungskonzept Sozialraumorientierung
Im deutschsprachigen Raum ist das Handlungskonzept Sozialraumorientierung in die Behindertenhilfe eingeführt worden, um die Unterstützung stärker auf die selbstbestimmte Teilhabe und soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen auszurichten. Das Handlungskonzept entstand in der Gemeinwesenarbeit in den 1970er/80er Jahren und hatte sich bereits in der Jugendhilfe und der sozialen Stadtentwicklung etabliert, bevor es auch für die Behindertenhilfe adaptiert wurde. „Ausgehend vom Willen des Einzelnen, der Stärkung seiner Eigeninitiative und dem Einbezug seiner persönlichen und sozialen Ressourcen werden durch Zielgruppen- und bereichsübergreifende Kooperation und Vernetzung mit lokalen Akteur*innen Ressourcen im Stadtviertel oder der Gemeinde erschlossen, die die Teilhabechancen stärken“, so formuliert die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (2021, S. 24) unter Rückgriff auf Hinte die Grundidee der Sozialraumorientierung. Was es fachlich heißt, sozialraumorientiert zu arbeiten, haben Früchtel und Budde (2010) in ihrem sog. SONI-Modell für die verschiedenen Handlungsfelder konkretisiert (Tab. 7.2).
Das Akronym SONI steht für vier Handlungsfelder: Politik (S – für gesellschaftliche und örtliche Sozialstruktur), Organisation (O), bürgerschaftliche Netzwerke bzw. Angebote im Gemeinwesen (N), und Individuum (I). Diese vier Handlungsfelder werden zusammen betrachtet, die Arbeit in ihnen soll aufeinander bezogen erfolgen. Die sozialraumorientierte Arbeit bewegt sich auf den Ebenen des Systems und der Lebenswelt (Tab. 7.2). Auf der Ebene der Lebenswelt wird die individuelle Fallarbeit, bei der die Ressourcen, Ziele und Interessen einer Person im Vordergrund stehen, erweitert um die Erschließung von Ressourcen im sozial geteilten Raum. Die System-Ebene umfasst das gesellschaftliche Ordnungssystem (Politik, Rechte, Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit, Hilfesystem) und Organisationen, die Unterstützung bewerkstelligen können. Zum Handeln auf der Systemebene gehört, sich kommunalpolitisch einzumischen und zu beteiligen sowie Rechtsansprüche geltend zu machen. Auf der organisationalen Ebene geht es darum, Organisationsstrukturen zu schaffen, die ein effektives Handeln vor Ort ermöglichen, und mit anderen Organisationen im Sozialraum zu kooperieren. Die sozialraumorientierte Arbeit versteht sich nicht als ein bloßes Add-on, als Hinzufügung zur individuellen Fallarbeit, sondern verändert auch den personenzentrierten Blick fundamental. Die Kunst der Leitung einer Organisation besteht darin, abgestimmt über alle vier Felder zu handeln mit dem Ziel der Verbesserung der Teilhabe der Klient*innen.
Teilhabeforschung in Deutschland beschäftigt sich mit der Frage, wie das Handlungskonzept Sozialraumorientierung in Organisationen der Behindertenhilfe implementiert werden kann, sodass es sich als soziale Innovation durchsetzt.
Wie kann die Sozialraumorientierung in Anbieterkonzepte gegossen und wie können sozialraumbezogene Leistungen finanziert werden? In Modellprojekten in Hessen (Erhardt et al. 2015; May et al. 2018) und Westfalen-Lippe (Dieckmann et al. 2023) wurden bei der Schaffung neuer Wohnsettings zusätzliche Mittel für die sozialraumorientierte Arbeit zur Verfügung gestellt. In der Begleitforschung wurden deren Ziele, die Aufgabenprofile und angewandten Methoden der für die Umsetzung eingestellten Fachkräfte dokumentiert. Im westfälischen Programm für selbstständiges und technikunterstütztes Wohnen im Quartier wird das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit auch für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf in Apartmenthäusern realisiert. Mieter*innen werden dabei über zwei Jahre von einer sozialraum- und quartiersbezogenen Teilhabegestalter*in unterstützt. Diese Stelle wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe als zuständigen Träger der Eingliederungshilfe auf der Basis eines Anbieterkonzepts finanziert. In der Projektevaluation zeigt sich, dass Anbieter sehr unterschiedlich darauf vorbereitet sind, Fachkonzepte für die sozialraumorientierte Arbeit zu verfassen und dass eine solche Orientierung Auswirkungen auf die Strukturen der gesamten Organisation nach sich ziehen muss.
Die Finanzierung nicht-fallspezifischer sozialraumorientierter Arbeit ist überzeugender zu argumentieren, wenn sie sich nachvollziehbar in der individuellen Teilhabe und deren Unterstützung niederschlägt. Der Vergleich der Beteiligung von Mieter*innen mit Behinderung an außerhäuslichen Aktivitäten und an sozialen Beziehungen vor und wenige Monate nach dem Einzug in ein Apartmenthaus zeigt, dass es Quartiers- und Teilhabegestalter*innen gelingen kann, die Interessen und Ressourcen der Mieter*innen mit den Möglichkeiten im Gemeinwesen in der individuellen Teilhabe- und Unterstützungsplanung zu verknüpfen (Dieckmann et al. 2023). In beiden Modellprojekten wirkten sich ein langfristig vorbereiteter Umzug, mit denen Mieter*innen positive persönliche Teilhabeziele verbinden, die Einbindung der Angehörigen und die Zusammenarbeit mit mehrheitlich aufgeschlossenen Akteuren im Gemeinwesen positiv aus auf die individuelle Teilhabe und Lebensqualität (Steinmetz und Heimberg 2016; Dieckmann et al. 2023). In beiden Projekten wird zugleich deutlich, wie schwierig sich die Schaffung von bezahlbarem und adäquat gelegenem Wohnraum aktuell gestaltet.
Beforscht wird auch, wie die sozialraumorientierte Arbeit mit der individuellen Teilhabeplanung verknüpft werden kann. Laumann und Dieckmann (2019) haben vier Möglichkeiten der organisationalen Verknüpfung einander gegenübergestellt, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen können:
-
1.
Der frühzeitige Blick auf die Ressourcen im Sozialraum kann sichergestellt werden, wenn eine Kraft mit sozialraumbezogener und kommunikativer Expertise (in Hamburg „Teilhabe-Lots*innen“ genannt) Menschen mit Behinderung im Vorfeld einer individuellen Teilhabeplanung begleitet und berät, um das, was sie will, sowie ihre individuellen Ressourcen und die Ressourcen im Gemeinwesen herauszuarbeiten. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in der Stiftung Alsterdorf, in dem Teilhabe-Lots*innen in einem neu geschaffenen Eingangsmanagement des Anbieters angesiedelt waren, wird dieses Modell vom Hamburger Senat als Leistungsträger in einem erweiterten Rahmen erprobt und als Beratungs- und Planungsleistung finanziert. Teilhabe-Lots*innen sind Anbieter-unabhängige Dienstleister, die im Sinne der Sozialraumorientierung die Klient*innen dabei unterstützen, ihre Bedürfnisse im Sozialraum zu realisieren. „Die Teilhabe-Lots*innen arbeiten teils integriert und dennoch autonom im Rahmen des leistungsrechtlichen Systems. Sie brauchen die strukturelle Distanz zu allen potentiellen Unterstützungs-Akteuren und die kenntnisreiche Nähe zu potentiellen Dienstleistenden“ (Stonis et al. 2021, S. 9).
-
2.
Expertise für die Realisierung der sozialräumlichen Arbeit kann in demselben Fachdienst eines Anbieters angesiedelt werden, der auch für die Unterstützung bei der individuellen Teilhabeplanung und für deren Umsetzung zuständig ist.
-
3.
Sozialraum- bzw. quartiersbezogene Teilhabegestalter*innen/ Teilhabemanager*innen können in Wohndiensten vor Ort angebunden tätig sein wie in den Modellprojekten in Hessen und Westfalen. Sie haben bei der individuellen Teilhabeplanung und bei der Umsetzung im Alltag (Teilhabemanagement) eine beratende Funktion.
-
4.
Eine vierte Variante besteht darin, dass die direkte Bezugsassistenz gleichzeitig für die Erkundung und Verankerung sozialräumlicher Bezüge in der Teilhabeplanung und im Teilhabemanagement verantwortlich ist.
Auf andere Weise hat die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) die Implementierung der Sozialraumorientierung vorangetrieben. In Bezug auf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und komplexem Unterstützungsbedarf hat sie fachliche Standards für die Unterstützung der Teilhabe formuliert (DHG 2021). Analog zu pflegerischen Standards oder medizinischen Richtlinien kann die Formulierung pädagogischer Standards dazu beitragen, das handlungsorientierte Fachwissen prägnant und schnell zu verbreiten und fachliche Ansprüche für Unterstützungsleistungen zu formulieren. Der DHG-Standard ist ein Pilot. Ähnlich wie für die Medizin oder Pflege müssten Strukturen für die weitere Formulierung von Standards geschaffen werden, die die Partizipation wichtiger Akteure und die wissenschaftliche Fundierung garantieren (Dieckmann et al. 2021).
4.2 Planung inklusiver Gemeinwesen
Die Implementierung der Sozialraumorientierung in Diensten und Einrichtungen für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen korrespondiert mit der kommunalen Aufgabe, Gemeinwesen und Quartiere inklusiv zu gestalten. Die im Grundgesetz verankerte kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge und die Vorgaben in Sozialgesetzbüchern (z. B. § 94 und § 95 BTHG) führen in Deutschland zu sozialplanerischen Aktivitäten, wie sie in diesem Ausmaß in anderen, z. B. den angelsächsisch geprägten Ländern unbekannt sind. Die Sozialplanung in Bezug auf Menschen mit Behinderungen begreift sich auf der Basis der UN-BRK nicht mehr als reine Fachplanung von Teilhabeleistungen, sondern hat den Anspruch Gemeinwesen und Quartiere inklusiv zu gestalten, um Menschen mit Behinderung eine barrierefreie und gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen im Gemeinwesen zu ermöglichen.
Aufgaben und Prozessmodelle für eine auf Inklusion zielende Sozialplanung haben Johannes Schädler, Albrecht Rohrmann und ihr Team am Zentrum für Planung und Evaluation sozialer Dienste an der Universität Siegen (Rohrmann et al. 2014) sowie Sabine Schäper, Friedrich Dieckmann und Christiane Rohleder am Institut für Teilhabeforschung an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen Münster (Schäper et al. 2019) iterativ anhand von kommunalen Planungsprojekten entwickelt.
Der Siegener Ansatz der örtlichen Teilhabeplanung zielt auf fünf Aufgabenfelder: die politische Partizipation von Menschen mit Behinderung und Schaffung von Beteiligungsstrukturen, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung, die Gestaltung einer barrierefreien Infrastruktur, die inklusive Gestaltung von Einrichtungen für die Allgemeinheit und die Entwicklung flexibler inklusionsorientierter Unterstützungsdienste für Menschen mit Behinderung. Orientiert am Lebenslauf gilt es, Angebote und Unterstützungsstrukturen für alle Lebensphasen inklusiv umzugestalten. Neben der Einbeziehung der gewählten kommunalen Gremien werden Bürger*innen direkt beteiligt in niedrigschwelligen „offenen Foren“, die oft einmalig stattfinden, und in verbindlicheren Arbeitsgruppen, die projektbezogen befristet sind („Arenen“). Von ihrem Selbstverständnis her richten Sozialplaner*innen ihr Handeln an einer Strategie aus, bringen die fachliche Expertise ein und organisieren Partizipation (Schädler 2010).
Der Münsteraner Ansatz (Schäper et al. 2019; Dieckmann und Rohleder 2021) integriert am Beispiel der Lebensphase Alter die kommunale Teilhabeplanung, die Psychiatrieplanung, die Seniorenplanung und Pflegebedarfsplanung. Das Vorgehen ist inklusiv, orientiert sich an den Sozialräumen und Adressat*innen und wird partizipativ angelegt. Die Bearbeitung der sachlich-inhaltlichen Planungsaufgabe ist eingebunden in die kommunalpolitischen Entscheidungsketten und erfolgt darüber hinaus im Zusammenspiel mit längerfristig angelegten Kooperationsstrukturen und zeitlich befristeten Beteiligungsformaten auf Ebene der Stadt bzw. des Kreises und in den betroffenen Quartieren (Stadtteilen bzw. kreisangehörigen Gemeinden). Zu den Aufgaben der Sozialplanung gehören auch die Schaffung und Pflege von Kooperationsstrukturen (z. B. von Arbeitskreisen Alter in den Stadtteilen, einer Konferenz von Anbietern und Selbstvertretungsgruppen auf Ebene des Kreises oder der Stadt) und die jeweils passende Gestaltung von projektbezogenen Partizipationsmöglichkeiten. Schäper et al. (2019) stellen eine Reihe partizipativer Planungsmethoden vor sowie die Nutzung geographischer Informationssysteme für die sozialräumliche Darstellung von Bedarfen und Angeboten.
Es geht nicht darum, ein einheitliches technokratisches Prozessmodell für eine inklusive Sozialplanung in allen Städten und Kreisen zu etablieren. Dazu ist auch das System sozialer Leistungen zu stark aufgesplittet und mit von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Zuständigkeiten zu variantenreich. Vielmehr ist nach der Phase der wissenschaftlichen Entwicklung von Planungsansätzen und -methoden empirisch zu evaluieren, was sich in der Praxis bewährt hat und wie Ansätze und Methoden auf den unterschiedlichen Ebenen implementiert werden können.
4.3 Positive Begegnungen im Sozialraum
Die Auflösung gemeindeferner Wohninstitutionen und die Schaffung gemeindeintegrierter Wohnsettings (Deinstitutionalisierung) war häufig mit der Hoffnung verbunden, dass sich für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung tiefergehende soziale Beziehungen zu Mitbürger*innen in der Nachbarschaft und im Gemeinwesen ergeben würden. Das ist nicht in dem erwarteten Maße eingetreten (Amado et al. 2013). Insbesondere in städtischen Räumen entwickeln jedoch auch andere Einwohner*innen oft keine lang andauernden Freundschaften in ihrem Wohnviertel. Stadtgeographen weisen darauf hin, dass einmalige soziale Begegnungen und sog. schwache soziale Beziehungen („weak social ties“), z. B. Bekanntschaften, ein Gefühl der Zugehörigkeit, soziale Anerkennung, Wohlbefinden sowie Sicherheit vermitteln können (Fincher und Iveson 2008). Die australische Arbeitsgruppe um Bigby und Wiesel (2019) hat untersucht, was für Arten von Begegnungen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung außerhalb der Wohnung im Sozialraum erleben und welche Bedingungen „gute“ Begegnungen fördern bzw. verhindern.
Bigby und Wiesel (2019) differenzieren drei Typen geselliger („convival“) Begegnungen im öffentlichen oder halb-öffentlichen Raum:
-
Begegnungen, die aufgrund der vorübergehenden Übernahme gleicher Rollen (z. B. als Tanzschüler*in in einem Tanzworkshop oder als Müllaufleser*in einer Putzaktion in der Gemeinde) zu einer Identifikation miteinander führen,
-
Begegnungen, die mit einer kurzzeitigen Anerkennung im Alltag verbunden sind, z. B. durch Blickkontakt, Hilfeleistungen, Grüßen während der Nutzung des ÖPNV oder in Einkaufsläden,
-
wiederholte Begegnungen, die zu einem Bekanntwerden führen, z. B. als Mitglied in einer Kirchengemeinde, in der Nachbarschaft, beim Bäcker „um die Ecke“.
Von diesen inklusiven Begegnungstypen unterscheiden Bigby und Wiesel (2019):
-
Begegnungen in spezifischen sozialen Räumen für Menschen mit Beeinträchtigung (z. B. Werkstätten für behinderte Menschen),
-
exkludierende Begegnungen, die das Gefühl vermitteln, nicht dazuzugehören (z. B. durch abwertende Bemerkungen, Ungeduld oder Furchtreaktionen eines Gegenübers),
-
das Meiden oder Auslassen von Interaktionen – sei es absichtlich oder nicht.
Wie Assistenzpersonen in der konkreten Interaktion gesellige Begegnungen mit anderen fördern können, zeigt anschaulich die von Bigby und Wiesel (2014) konzipierte Online-Fortbildung „Supporting Inclusion“ (http://supportinginclusion.weebly.com). Zudem haben Bigby und Wiesel (2019) auf der Grundlage von teilnehmender Beobachtung, Fragebögen und Interviews Merkmale von öffentlichen bzw. halb-öffentlichen Settings („places“) identifiziert, die Begegnungen erleichtern. So würden Settings, deren Aktivitäten nicht wettbewerbsorientiert sind, die von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung für den gleichen Zweck aufgesucht werden und die Gelegenheiten für verbale oder nonverbale Kommunikation bieten, positive Kontaktaufnahmen leichter machen. In den Niederlanden haben Bredewold et al. (2016) am Beispiel von Nachbarschaftskontakten psychisch oder intellektuell beeinträchtigter Erwachsener herausgefunden, dass Settings mit klaren Rollen und Regeln (z. B. Gemeinschaftsgärten, Zuverdienst-Zentren) gesellige Begegnungen erleichtern. Solche Settings würden nicht zu hohe Anforderungen an soziale Kompetenzen und Aushandlungsprozesse stellen, die Menschen mit psychischer oder intellektueller Beeinträchtigung oft überforderten. Und die Interaktionsräume blieben auch für Menschen ohne Beeinträchtigung überschaubar und begrenzbar. Bredewold et al. (2016) sprechen mit Bezug auf Goffman von „built-in-boundaries“, die gesellige Begegnungen erleichtern.
Die Forschung zu begegnungsförderlichen Settings in Gemeinwesen steht erst am Anfang. Mithilfe des Behavior Setting-Konzepts (BS) können öffentlich zugängliche Geschehenstypen voneinander abgegrenzt und klassifiziert werden. Vorliegende Befunde zu Begegnungen lassen sich kontextualisiert in einem Behavior Setting präziser erklären. Beispielsweise muss der Wettbewerbscharakter eines BS-Geschehens gesellige Begegnungen nicht ausschließen. Hinderlich wird der Wettbewerbscharakter dann, wenn die Ansprüche der Teilnehmenden (Ertragserwartungen) zu unterschiedlich und unvereinbar sind oder wenn durch den Wettbewerbscharakter ein auch zeitlicher Handlungsdruck entsteht, der nicht kompensierbar ist und zu einer Überforderung von Beteiligten führt. Behavior Settings, die Freiräume für Kommunikation vorsehen, können Begegnungen vertiefen, man denke z. B. an die Begrüßungsphase oder Schlussgespräche bei einer Yogastunde. Zusätzlich erleichtern Gesprächsanlässe (wie gemeinsame Erlebnisse, Verabschiedungen) oder eine notwendige Verständigung (z. B. Absprachen bei Partnerübung) die Aufnahme von Kommunikation. Der Zweck eines BS führt Personen zusammen, wie Bigby und Wiesel (2019) richtig konstatieren. Aber ein inklusives BS, an dem Personen mit und ohne Behinderung freiwillig teilnehmen, wird nur dann Bestand haben, wenn die individuellen Zielerwartungen der verschiedenartigen Teilnehmer*innen befriedigt werden. Ein BS mit einem strukturierten Programm und klaren Rollen und Regeln erleichtert die Interaktion einander bislang nicht bekannter Menschen und schützt auch vor weitergehenden persönlichen Ansprüchen (Bredewold et al. 2016). Und natürlich sind Behavior Settings, die im Alltag immer wieder aufgenommen werden und an denen eine Person immer wieder teilnimmt, förderlich, um sich kennenzulernen, sodass aus Begegnungen Bekanntschaften entstehen.
Aus der Perspektive des BS-Konzepts lassen sich auch neue Hypothesen über förderliche und hinderliche Bedingungen für gesellige Begegnungen formulieren: So können durch das räumlich-materielle Arrangement (Milieu) Kommunikationsanlässe geschaffen werden, z. B. wenn sich die Gäste in einem Imbiss an einem langen Tisch gegenüber sitzen statt an Zweier-Tischen voneinander separiert zu speisen. Für die Wahrnehmung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und Kontaktaufnahme ist beispielsweise der Umgang mit Verletzungen von Angemessenheitsnormen im Rahmen eines BS entscheidend. Wie werden normabweichende Verhaltensweisen interpretiert und bewertet? Inwieweit werden Setting-bezogene Normen verändert? Und auch Assistenzpersonen als weitere Teilnehmende in einem BS eröffnen neue Gelegenheiten für soziale Interaktionen.
Insgesamt kann das BS-Konzept Diensten der Eingliederungshilfe helfen, Settings im Gemeinwesen im Hinblick auf Inklusion und Möglichkeiten für soziale Begegnungen zu sondieren. Beispielsweise suchen manche Tagesförderstätten Settings in den Gemeinden, in denen auch Menschen mit komplexer Beeinträchtigung kleinere Arbeiten übernehmen können („sich nützlich machen“) und die damit einhergehend Begegnungsmöglichkeiten bieten (Becker 2016).
4.4 Nachbarschaft und nachbarliche Beziehungen
Der Begriff „Nachbarschaft“ bezieht sich sowohl auf die Gesamtheit der Nachbar*innen in der Umgebung als auch auf die von Nachbar*innen bewohnte Gegend (soziale und physische Wohnumwelt, Flade 2006, S. 81). Unter Nachbarschaft kann aber auch ein sozial und räumlich markiertes Geschehenssystem, ein Mikrosystem im Sinne Bronfenbrenners (1990) verstanden werden (Seifert 2018). Die Nachbar*innen einer Person sind die Menschen, die außerhalb der Wohnung der Person in unmittelbarer räumlicher Nähe leben. Je nach Siedlungsform gibt es Nachbar*innen, die im gleichen Haus leben, und solche, die nebenan oder gegenüber in anderen Häusern wohnen. Was für ein nachbarschaftliches Geschehen sich entfaltet, hängt von den Gelegenheiten in der Umwelt sowie den Interessen und Kompetenzen potenziell Beteiligter ab, eine Nachbarrolle auszufüllen – gegebenenfalls mit Unterstützung (vgl. Overmars-Marx et al. 2014). Gelegenheiten für Nachbarschaftsgeschehen lassen sich mithilfe folgender Fragen eingrenzen: Welche kulturellen Normen rahmen nachbarschaftliches Verhalten? Was nutzen Nachbar*innen gemeinsam? Was haben sie gemeinsam zu regeln? An welchen Orten begegnen sie sich im Alltag? Wie sehr sind sie vom Wohnalltag des jeweils anderen positiv oder negativ tangiert? Für westliche Länder identifizieren Skjaeveland et al. (1996) vier Aspekte von Nachbarschaftsgeschehen: Sich Grüßen und kurze Gespräche im Alltag (als typische Merkmale sog. schwacher sozialer Beziehungen), gegenseitige Unterstützungshandlungen (mit Lebensmitteln aushelfen, sich Dinge ausleihen, Post entgegennehmen u. ä.), Ärger mit Nachbar*innen (z. B. aufgrund von Störungen der Privatheit wie Lärm und Geruch oder interpersonaler Konflikte) sowie die kognitiv-emotionale Bindung an die Nachbarschaft, die im besten Fall ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit vermittelt.
Das Interesse an nachbarlichen Beziehungen ist individuell verschieden. Flade (2006) unterscheidet unter Rückgriff auf Riger und Lavrakas (1981) vier Typen von Nachbar*innen: Die Mobilen sind wenig örtlich verwurzelt und sozial eingebunden (oft z. B. Studierende, junge Berufstätige). Die Isolierten leben dagegen schon lange in der Nachbarschaft, haben aber dennoch kaum soziale Bezüge entwickelt. Davon zu unterscheiden sind die sozial Eingebundenen, die erst kurz in der Nachbarschaft leben, wie beispielsweise junge Familien. Der vierte Typus sind die Etablierten, die eng mit ihrer Nachbarschaft verwurzelt und zugleich sozial eingebunden sind. Die Unterschiede im Nachbarschaftsverhalten zwischen Stadt und Land, aber insbesondere auch zwischen unterschiedlichen städtischen Quartieren lassen sich auch mit den unterschiedlichen nachbarschaftlichen Bedürfnissen erklären. Gerade innerstädtische Quartiere zeichnen sich durch eine Vielfalt und einen starken Wechsel von Nachbar*innen aus. Nachbar*innen im ländlichen Raum sind häufig seit langem dort verwurzelt, kennen sich über soziale Netzwerke und sind auch stärker aufeinander angewiesen. Neben den Bedürfnissen ist für die Betrachtung nachbarlicher Beziehungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Frage wichtig, inwieweit sie – gegebenenfalls mit Unterstützung – die nachbarliche Rolle einnehmen und gestalten können.
Die Auflösung von Komplexeinrichtungen war mit der Hoffnung verknüpft, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung infolge des Umzugs in Stadtviertel und dörfliche Gemeinden nachbarliche Beziehungen zu nichtbehinderten Menschen entwickeln würden. Nachbarliche Beziehungen sollten zu einer Brücke für die soziale Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Gemeinwesen werden. Je nach Wohnsetting sind die Voraussetzungen für Kontakte zu Nachbar*innen allerdings sehr unterschiedlich. Menschen, die in Wohnheimen leben, haben selten Kontakte zu nichtbehinderten Nachbar*innen, weil sich in ihrem Wohngebäude keine finden und das institutionelle Eigenleben eine Orientierung auf die unmittelbare Nachbarschaft oft verhindert. Die Nachbarschaftskontakte von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung, die bei ihren Angehörigen leben, hängen stark von der nachbarschaftlichen Einbindung der Familie insgesamt ab. Angehörige fungieren häufig als Brückenbauer (Boland und Guerin 2021).
Geforscht wurde vor allem zu nachbarlichen Beziehungen von Personen, die ambulant unterstützt in einer eigenen Wohnung leben. Die Berliner Kundenstudie von Seifert (2010) zeigt, dass sich überwiegend die von Skjaeveland et al. (1996) beschriebenen positiven Aspekte des Nachbarschaftsverhalten entwickeln, wie kurze Kommunikation und Kontakte im Alltag und kleine gegenseitige Hilfen. Nachbarliche Kontakte führten nur manchmal zu tiefer gehenden persönlichen Beziehungen. Wie oben erwähnt, wird die Bedeutung der schwachen sozialen Beziehungen für Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung allerdings unterschätzt. Overmars-Marx et al. (2019) identifizierten sechs Themen, die aus der Sicht von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in ihrer Nachbarschaft relevant waren. Grundlage waren Fotos, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als relevant für ihre Nachbarschaft aufgenommen hatten und in Interviews diskutiert wurden (Photovoice-Methode). Für die Teilnehmer*innen waren die Attraktivität der Nachbarschaft, die Aktivitäten, die sozialen Kontakte und für sie möglichen sozialen Rollen bedeutsam sowie Aspekte, die ihre Unabhängigkeit als Quartiersbewohner*in und ihre öffentliche Bekanntheit demonstrierten. Der Grad ihrer öffentlichen Bekanntheit hing wiederum stark zusammen mit dem Vorhandensein schwacher sozialer Beziehungen, den ausgeübten sozialen Rollen und länger bestehenden, vor allem familiären Netzwerken im Quartier.
Welche Bedingungen fördern die Entstehung von positiv bewertetem Nachbarschaftsgeschehen und guten nachbarlichen Beziehungen?
Inklusiv ausgerichtete Nachbarschaften und nachbarliche Beziehungen lassen sich nicht verordnen oder herstellen. Stadtplanung, Architektur, Gemeinwesenarbeit, Anbieter in der Behindertenhilfe und informelle Netzwerke von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können jedoch ein gedeihliches Zusammenleben befördern (Menzl 2018). Ob so entstehende Gelegenheiten genutzt werden, hängt auch von den Interessen und der Ausgestaltung der nachbarlichen Rollen durch die Quartiersbewohner*innen mit und ohne Behinderung selbst ab (Overmars-Marx et al. 2014). In der folgenden Zusammenfassung von Forschungsergebnissen wird berücksichtigt, dass in der englischsprachigen Literatur der Begriff neighbourhood oft weiter gefasst ist als im deutschsprachigen Raum und sich internationale Studien oft auf das gesamte Quartier beziehen.
Gestaltung von Quartieren und Wohngebäuden
Barrierefreiheit: Eine barrierefreie Gestaltung der öffentlich genutzten Räume und von Wohngebäuden, z. B. durch städtebauliche Vorgaben, erleichtert die Inklusion.
Bezahlbarer Wohnraum: Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die überwiegend Wohngeld beziehen, müssen die Möglichkeit haben, bezahlbaren Wohnraum in Quartieren zu finden. Das gelingt häufig nur dann, wenn Kommunen in Quartieren eine Mischung von sozial geförderten, von am Markt offerierten Mietwohnungen und von Wohnen im Eigentum vorgeben. Die Erfahrung der Stadt Hamburg zeigt, dass Wohnmöglichkeiten für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die auf Unterstützung angewiesen sind, sich erst in ausreichender Anzahl ergeben, wenn eine Mindestquote inklusiver Wohneinheiten für einzelne Areale innerhalb eines Quartiers festgeschrieben wird (Menzl 2018; Gies 2022).
Zusammensetzung der Bewohnerschaft: Für die Entstehung eines nachbarschaftlichen Geschehens sind Quartiersbewohner*innen wichtig, die längerfristig wohnen bleiben, die als gleich oder ähnlich Gesinnte bestimmte Haltungen und Lebensstile teilen und die von ihrem sozial-kulturellen Kapital her die Kompetenzen für die Initiierung von nachbarschaftlichem Geschehen mitbringen. Die Segregation innerhalb eines Viertels kann durch städtebauliche Vorgaben (z. B. zulässige Art der Bebauung, Anwendung von Quoten für das Wohnen zur Miete und im Eigentum auf der Ebene von Straßenzügen oder -blöcken, Gies 2022) verhindert werden.
Begegnungsorte und Angebote: Im Quartier sollten Angebote erreichbar sein, die von Nachbar*innen aus eigenem Interesse aufgesucht werden und zu Begegnungen und Aktivitäten führen. Dazu zählen u. a. Geschäfte und Dienstleister für den alltäglichen Bedarf, Verweilzonen und „grüne“ Orte, Freizeitangebote und Quartierszentrum, Quartierstützpunkt mit sozialen Dienstleistungen. Dabei muss es hinreichend viele nichtkommerzielle Angebote geben.
Halb-private Zonen und Gemeinschaftsräume in Wohngebäuden: Die Gestaltung halb-privater Zonen und klarer Übergänge vom halb-privaten zum öffentlichen Raum in Wohngebäuden und um sie herum kann Begegnungsmöglichkeiten schaffen und erleichtern. In Wohnhäusern haben sich Gemeinschaftsräume der Haus- oder Mietergemeinschaft bewährt, die je nach Interesse der Hausbewohner*innen für unterschiedliche Funktionen genutzt werden, z. B. als Fitnessraum, Werkstatt, Raum für Geselligkeit, Gemeinschaftsgarten.
Abgrenzungsmöglichkeiten in Wohngebäuden: Neben den Gelegenheiten zur Begegnung lassen sich nachbarliche Störungen vermeiden, wenn ein ausreichender Schutz vor sensorischer Stimulation durch die räumliche und bauliche Gestaltung (Distanzen, Schall- und Sichtschutz) gegeben ist. Für die Akzeptanz von Menschen mit herausforderndem Verhalten ist das essenziell wichtig. Dichtere Wohnbebauungen sind hier oft weniger geeignet.
Quartiersmanagement und Bewusstseinsbildung
Bewusstseinsbildung für Nachbarschaftshilfe: Kommunen und andere Akteure können Nachbarschaftshilfe nicht verordnen, sie ist freiwillig und auch abhängig von den konkreten Nachbarschaftskonstellationen. Kommunen können aber z. B. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein Klima schaffen, das Nachbarschaftshilfe als Teil einer Kultur des Zusammenlebens im Gemeinwesen aktualisiert.
Quartiersmanagement: Die Beteiligung von Quartiersbewohner*innen, die Entfaltung und Nutzung von Angeboten im Quartier und die Entstehung von nachbarschaftlichen Geflechten kann durch ein Quartiersmanagement, das auch die Inklusion zum Ziel hat, gefördert werden (Menzl 2018). Zum Teil können auch Quartiers- und Teilhabegestalter*innen, die in der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, zum Aufbau eines inklusiven Quartiers beitragen.
Typen von Wohnsettings mit Unterstützung
In Wohnheimen haben Bewohner*innen aufgrund der räumlichen Bedingungen und einer oft vorherrschenden institutionellen Binnenorientierung kaum Chancen, Nachbar*innen ohne Behinderung kennen zu lernen. Leben Menschen mit Behinderung zusammen mit Angehörigen, hängt das Nachbarschaftsleben oft von der Einstellung der Angehörigen zur Nachbarschaft und der familiären Unterstützung nachbarlicher Beziehungen ab. Für die Entstehung nachbarlicher Beziehungen auch von Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf werden als Wohnsettings inklusive Hausgemeinschaften, in denen Menschen mit und ohne Behinderung in verschiedenen Haushalten unter einem Dach leben (z. B. im Rahmen einer Baugemeinschaft) oder das Wohnen in einem inklusiv ausgerichteten Verbund von unterstützten Wohnsettings in einer Nachbarschaft (z. B. das Wohnen „im Drubbel“, Hoppe 2006) bevorzugt. Das Leben in einem Verbund von in der Nachbarschaft verteilten Wohnungen ermöglicht nicht nur eine ökonomische Organisation der Unterstützung, sondern hilft, die Selbsthilfepotenziale nachbarlicher Beziehungen zu Menschen mit und ohne Behinderung auf freiwilliger Basis zu erschließen.
Wohndienste und Assistenzpersonen
Eine irische Studie (Boland und Guerin 2022) kommt zu dem Schluss, dass Anbieter zwar die Bedeutung der Inklusion im Wohnquartier als Leitideen in den Konzeptionen haben, dass dieses Handlungsfeld aber kaum in konkrete Aufgaben und Handlungsweisen übersetzt wird. Wohndienste und unterstützte Wohnsettings begreifen sich noch wenig als Teil einer Nachbarschaft. Dabei können gerade unterstützte Wohnsettings für Nachbar*innen Alltagshilfen leisten, die Beziehungen fördern, z. B. die Annahme von Paketen oder das Blumengießen im Urlaub. Entscheidend ist die Einstellung von Assistenzpersonen in Wohndiensten (Overmars-Marx et al. 2014). Diejenigen, die sich eher als Betreuer*innen denn als Unterstützende von Inklusion begreifen, sehen es nicht als ihre primäre Aufgabe an, Gelegenheiten für Nachbarschaftsgeschehen zu nutzen und Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dabei zu helfen, auf Gegenseitigkeit beruhende nachbarliche Beziehungen zu schaffen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Unterstützung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Interaktion zu anderen in der Öffentlichkeit oft mit größeren Hemmungen bei Assistenzpersonen verbunden ist als in der Wohnung.
Informelle und familiäre Beziehungen
Die informellen Netzwerke von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, insbesondere familiäre Beziehungen, sind eine wichtige Ressource für die Entstehung von nachbarlichen Beziehungen (Overmars-Marx et al. 2014). Boland und Guerin (2021) stellten fest, dass erwachsene Geschwister sehr oft als Brückenbauer in die Nachbarschaft fungieren. Das trifft sowohl zu, wenn Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung zusammen mit ihren Eltern oder Geschwistern wohnen, als auch wenn sie nur an Wochenenden dort zu Besuch sind. Aktivitäten im Gemeinwesen werden von einem Großteil der Geschwister, die in Kontakt mit ihren behinderten Geschwistern sind, begleitet, z. B. gemeinsames Ausgehen, Einkäufe, Freizeitaktivitäten. Die inklusive Funktion von Angehörigen ist bislang zu wenig beachtet worden.
Nachbarschaftsrelevante Kompetenzen
Abbott und McConkey (2006) identifizieren vier Kompetenzen für die soziale Inklusion in der Nachbarschaft: Gespräche mit anderen Leuten führen; anerkannt werden von anderen; die Nutzung von Angeboten im Gemeinwesen und die Möglichkeit von Assistenz für selbstbestimmtes Handeln. Zu den erforderlichen Fertigkeiten gehören auch das aktive Grüßen, Höflichkeitsverhalten (wie Tür offenhalten) und das Wissen und Praktizieren von Gegenseitigkeit bei Gefälligkeiten. Ortskenntnisse, Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen erleichtern die Einbindung, weil Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung selbstständig ohne Assistenz teilnehmen können. Nicht verwunderlich ist, dass Menschen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung weniger dieser Kompetenzen entwickeln (Overmars-Marx et al. 2014). Die Förderung der sozialen Kompetenzen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung für Nachbarschaftsverhalten ist essenziell. Genauso aber müssen Nachbarn lernen, ihr Verhalten gegenüber Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung anzupassen. Assistenzpersonen nehmen zu wenig wahr, dass sie beides unterstützen sollten.
5 Fazit
Dieser Beitrag schließt mit einigen Empfehlungen, die aus der Bewertung der dargestellten Forschung zur sozialen Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung resultieren:
-
Zum gegenseitigen Nutzen sollte die bislang stärker auf Fachkonzepte und theoretische Betrachtungen ausgerichtete Forschung im deutschsprachigen Raum in die internationale, empirisch orientierte Forschungsgemeinschaft eingebracht werden.
-
Die Teilnahme an Aktivitäten im Gemeinwesen und die Entstehung und Pflege sozialer Beziehungen sind wechselseitig miteinander verwoben. Die Bedeutung sog. schwacher sozialer Beziehungen für die soziale Inklusion wird unterschätzt. Interventionen beziehen sich mittlerweile sowohl auf die Unterstützung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ihrer An- und Zugehöriger als auch auf Veränderungen bei den Akteuren und Angeboten im Gemeinwesen. Zukünftige Forschung sollte erhellen, wie aus der Beteiligung an Aktivitäten und sozialen Beziehungen Anerkennung und die Wahrnehmung von Zugehörigkeit entsteht.
-
Die statischen Rahmenmodelle für die Verortung von Einflussfaktoren auf die soziale Inklusion sind zu ergänzen um ökologische Theorien, die in der Lage sind, die Komplexität von Umweltausschnitten abzubilden. Sie können zu einer eher kontextspezifischen und damit auch anwendungsnäheren Differenzierung der Forschung führen.
-
Der eingeschlagene Weg, Barrieren und Förderfaktoren feinkörnig empirisch zu analysieren, hat sich auch für die Anwendung als nützlich erwiesen. Nachholbedarf besteht für Forschung zur Implementation von Handlungsstrategien und Fachkonzepten in den Gemeinwesen und Wohndiensten.
-
Ein anwendungsorientiertes Forschungsprogramm zur sozialen Inklusion hat die Perspektiven und Expertise verschiedener Disziplinen und Professionen zu berücksichtigen, z. B. auch die der Stadtplanung, Geografie und Architektur, und sollte idealerweise interdisziplinär angelegt werden.
Literatur
Abbott, S. & McConkey (2006). The barriers of social inclusion as perceived by people with intellectual disabilities. Journal of Learning Disabilities, 10, 275–287.
Amado, Angela Novak (2012). Status of research in social inclusion and community participation of individuals with intellectual/developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 56, (7/8), 813.
Amado, A., Stancliffe, R., McCarron, M., McCallion, P. (2013). Social inclusion and community participation of individuals with intellectual/developmental disabilities. Intellectual and Developmental Disabilities, 51 (5), 360–375.
Barker, R., & Associates (1978). Habitats, Environments, and Human Behavior. Jossey-Bass.
Becker, H. (2016). Inklusive Arbeit. Beltz Juventa
Bigby, C. & Wiesel, I. (2014). Supporting Inclusion. Workbook for Online Training Program. La Trobe University. http://supportinginclusion.weebly.com.
Bigby, C. & Wiesel, I. (2019). Using the concept of encounter to further the social inclusion of people with intellectual disabilities: what has been learned? Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 6 (1), 39–51. https://doi.org/10.1080/23297018.2018.1528174.
Bredewold, F., Tonkens, E., Trappenburg, M. (2016). Urban encounters limited: The importance of built-in boundaries in contacts between people with intellectual or psychiatric disabilities and their neighbours. Urban Studies, 53 (16), 3371–3387.
Boland, G. & Guerin, S. (2021). Connecting locally: The role of adult siblings in supporting the social inclusion in neighbourhoods of adults with intellectual disability. British Journal of Learning Disabilities, 00, 1–14.
Boland, G. & Guerin, S. (2022). Connecting locally: An examination of the role of service providers in supporting the social inclusion of adults with intellectual disabilities in their neighbourhoods. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 1–12. https://doi.org/10.1111/jppi.12419.1-12.
Bronfenbrenner, U. (1990). Ökologische Sozialisationsforschung. In L. Kruse, C. Graumann, E. Lantermann (Hrsg.), Ökologische Psychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen (S. 76–79). Psychologie Verlags Union.
Clement, T. & Bigby, C. (2010). Group Homes for People with Intellectual Disabilities. Encouraging Inclusion and Participation. Jessica Kingsley Publishers.
Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (2021). Standards zur Teilhabe von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und komplexem Unterstützungsbedarf. Kohlhammer.
Dieckmann, F. (2022). Der Beitrag der ökologischen Psychologie für die Teilhabeforschung. In G. Wansing, M. Schäfers, S. Köbsell (Hrsg.), Teilhabeforschung – Einführung in ein neues Forschungsfeld. Bd. 1 – Theoretische Perspektiven (S. 145–162). Springer VS.
Dieckmann, F., Graumann, S., Schäper, S., Greving, H. (2013). Bausteine für eine sozialraumorientierte Gestaltung von Wohn- und Unterstützungsarrangements mit und für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter. Vierter und abschließender Zwischenbericht im BMBF-Projekt „Lebensqualität inklusiv(e)“. Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen.
Dieckmann, F., Laumann, M., Thimm, A. (2023). Abschlussbericht zum SeWo-LWL-Programm zum selbstständigen und technikunterstützten Wohnen im Quartier. Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Institut für Teilhabeforschung.
Dieckmann, F. & Rohleder, C. (2021). Creating age and disability friendly communities to support healthy and meaningful aging (S. 205–216). In M. Putnam & C. Bigby (Hrsg.), Handbook on Aging and Disability. Routledge.
Dieckmann, F., Seifert, M., Bradl, C. (2021). Entwicklung von Standards bzw. Leitlinien für die Unterstützung von Teilhabe – ein wissenschaftlicher Weg zur Durchsetzung sozialer Innovationen? Abstract zu einer Forschungswerkstatt. In F. Dieckmann & M. Niehaus (Hrsg.), 2. Kongress der Teilhabeforschung 2021- Programm und Abstracts der Beiträge (S. 39). Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Institut für Teilhabeforschung.
Dieckmann, F., Schaeper, S., Thimm, A., Dieckmann, P., Dluhosch, S., Lucas, A. (2015). Die Lebenssituation von älteren Menschen mit lebenslanger Behinderung in Nordrhein-Westfalen. Band 2 der Schriftenreihe zur Berichterstattung über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW.
Erhardt, A., May, M., Schmidt, M., Steinmetz, J. (2015). Abschlussbericht für die Aktion Mensch zum Projekt: Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf – Wohnen mitten in der Gemeinde/Stadt. Hochschule Rhein-Main Wiesbaden.
Fincher, R. & Iveson, K. (2008). Planning and Diversity in the City: Redistribution, Recognition and Encounter. Palgrave MacMillan.
Flade, A. (2006). Wohnen psychologisch betrachtet (2. Aufl.). Huber.
Früchtel, F. & Budde, W. (2010). Bürgerinnen und Bürger statt Menschen mit Behinderungen. Teilhabe, 49 (2), 54–61.
Gies, L. (2022). Inklusive Quartiersentwicklung in Hamburg. Vortrag am Themenabend „Selbstbestimmt Wohnen in inklusiven Stadtvierteln – Wege für Münster“ an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Münster am 1.6.2022. https://www.s-inn.net/meldungen/selbstbestimmt-wohnen-in-inklusiven-stadtvierteln-wege-fuer-muenster.
Haveman, M. & Stöppler, R. (2021). Altern mit geistiger Behinderung. Grundlagen und Perspektiven für Begleitung, Bildung und Rehabilitation (3. Aufl.). Kohlhammer.
Heidbrink, H., Lück, H. & Schmidtmann, H. (2009). Psychologie sozialer Beziehungen. Kohlhammer.
Hinte, W. (2016). Sozialraumorientierung – was ist das eigentlich? In K. Terfloth, U. Niehoff, T. Klauss, C. Buckenmaier (Hrsg.), Inklusion – Wohnen – Sozialraum. Grundlagen des Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde (S. 78–90). Lebenshilfe Verlag.
Hoppe, U. (2006). Wohnen im Drubbel. Das ambulant unterstützte Wohnen der Lebenshilfe Münster (S. 170–176). In G. Theunissen & K. Schirbort (Hrsg.). Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen – soziale Netze – Unterstützungsangebote. Kohlhammer.
Kaminski, G. (1995). Behinderung in ökologisch-psychologischer Perspektive. In J. Neumann (Hrsg.), „Behinderung“. Von der Vielfalt eines Begriffs und dem Umgang damit (S. 44–74). Attempto.
Laumann, M. & Dieckmann, F. (2019). Implementation of community orientation in residential support services. Journal of Intellectual Disability Research, 63 (7), 720. https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652788/2019/63/7.
Laumann, M. & Dieckmann, F. (2020). Sozialraumorientierung als Fachkonzept für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. In Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e. V. (Hrsg.), Ich selbst? Bestimmt! – Selbstbestimmt Wohnen mit hohem Unterstützungsbedarf (S. 181–195). Verlag selbstbestimmtes Leben.
May, M., Ehrhardt, A., Schmidt, M. (Hrsg.) (2018). MitLeben: Sozialräumliche Dimensionen der Inklusion geistig behinderter Menschen. Barbara Budrich.
McCarron, M., Swinburne, J., Burke, E., McGlinchey, E., Mulryan, N., Andrews, V., Foran, S., McCalllion, P. (2011). Growing Older with an Intellectual Disability in Ireland 2011: First Results from the IDS-TILDA. Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery.
Menzl, M. (2018). Inklusive Quartiersentwicklung – Worauf kommt es an? Behindertenpädagogik, 57 (3), 293–303.
Overmars-Marx, T., Thomése, F., Verdonshot, M., Meininger, H. (2019). Neighbouhood social inclusion from the perspective of people with intellectual disabilities: relevant themes identified with use of photovoice. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32 (1), 82–93.
Overmars-Marx, T., Thomése, F., Verdonshot, M., Meininger, H. (2014). Advancing social inclusion in the neighbourhood for people with intellectual disability: an exploration of the literature. Disability & Society, 29 (2), 255–274.
Petry, K., Maes, B, Vlaskamp, C. (2005). Domains of quality of life of people with profound multiple disabilities: The perspective of parents and direct support staff. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, 35–46.
Porteous, J. (1977). Environment and Behavior. Planning and Everyday Urban Life. Addision-Wesley.
Riger, S. & Lavrakas, P. (1981). Community ties: Patterns of attachment and social interaction in urban neighbourhoods. American Journal of Community Psychology, 9 (1), 55–66.
Robertson, J., Emerson, E., Gregory, N., Hatton, C., Kessioglou, S., Hallmam, A., Lineham, C. (2001). Social networks of people with mental retardation in residential settings. Mental Retardation, 39 (3), 201–214.
Rohrmann, A., Schädler, J., Kempf, M., Konieczny, E., Windisch, M. (2014). Inklusive Gemeinwesen Planen. Eine Arbeitshilfe. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW.
Schädler, J. (2010). Grundlagen und Strategien einer örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderungen. In A. Rohrmann, J. Schädler, T. Wissel, M. Gaida (Hrsg.), Materialien zur örtlichen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderungen (S. 4–19). Zentrum für die Planung und Evaluation sozialer Dienste der Universität Siegen.
Schäper, S., Dieckmann, F., Rohleder, C., Rodekohr, B., Katzer, M., Frewer-Graumann, S. (2019). Inklusive Sozialplanung für das Alter. Kohlhammer.
Seifert, M. (1997a). Lebensqualität und Wohnen bei schwerer geistiger Behinderung. Theorie und Praxis. Diakonie Verlag.
Seifert, M. (1997b). Wohnalltag von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung. Eine Studie zur Lebensqualität. Diakonie Verlag.
Seifert, M. (2010). Kundenstudie. Bedarf an Dienstleistungen zur Unterstützung des Wohnens von Menschen mit Behinderung. Rhombos.
Seifert, M (2018). Ich habe einen Traum. Leben in Nachbarschaften ist Alltag. Behindertenpädagogik, 57 (3), 275–292.
Simplican, S.T., Leader, G., Kosciulek, J., Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of social networks and community participation. Research in Developmental Disabilities, 38, 18–29.
Skjaeveland, O., Gärling, T., Maeland, J. (1996). A multidimensional measure of neighboring. American Journal of Community Psychology, 24, 413–435.
Stancliffe, R., Lakin, K., Taub, S., Doljanac, R., Byun, S., Chiri, G. (2007). Loneliness and living arrangements. Intellectual and Developmental Disabilities, 45 (6), 380–390.
Stancliffe, R., Wilson, N., Gambin, N, Bigby, C., Baladin, S. (2013). Transition to Retirement. A Guide to Inclusive Practice. Sydney University Press.
Steinmetz, J. & Heimberg, W. (2016). „Mitleben“ – Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf wohnen mitten in der Gemeinde/Stadt. Teilhabe, 55 (3), 120–126.
Stonis, A., Steinberg, T., Haubenreißer, K. (2021). Das Leben selbst in die Hand nehmen. Modellprojekt Qplus: Erfahrungen Perspektiven. Orientierung, 1/2021, 7–9.
Verdonshot, M., de Witte, L., Reichcraft, E., Buntinx, W., Curfs, L. (2009). Impact of environmental factors on community participation of persons with an intellectual disability. A systematic review. Journal of Intellectual Disability Research, 53, 54–64.
Walker, K. N., MacBride, A., & Vachon, M. L. S. (1977). Social support networks and the crisis of bereavement. Social Science & Medicine, 11, 35–41.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2024 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Dieckmann, F. (2024). Sozialraum und soziale Inklusion. In: Dieckmann, F., Heddergott, T., Thimm, A. (eds) Unterstütztes Wohnen und Teilhabe. Beiträge zur Teilhabeforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40448-2_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40448-2_7
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-40447-5
Online ISBN: 978-3-658-40448-2
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)