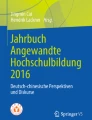Zusammenfassung
Der Beitrag untersucht die Entwicklung der Forschungszusammenarbeit zwischen Deutschland und China. Dabei stehen nicht Förderprogramme und quantitative Indikatoren im Zentrum, sondern bisher wenig untersuchte „Innenansichten“ solcher internationaler Kooperationen: Motive, persönliche Erfahrungen und Narrative der beteiligten Wissenschaftler:innen. Die hier vorgestellten Befunde basieren auf dem Projekt „Globalisierung der Forschung“, das 2011 bis 2015 vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gefördert wurde. Wie beschreiben und bewerten die jeweiligen Partner ihre Forschungszusammenarbeit? Haben sie ein gemeinsames Verständnis von Wissenschaft, ähnliche Vorstellungen von „guter Wissenschaft“ und guter wissenschaftlicher Praxis? Unterscheiden sich ihre Arbeitsstile, und falls ja, wie und wodurch? Was treibt ihre Zusammenarbeit an, und wie beschreiben sie deren Ergebnisse? Unsere „Sondierungen“ zeigten, dass die Kooperation von großem gegenseitigem Respekt geprägt war, aber zugleich auch von ganz unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten und Wünschen der Partner. Die hochgelobte Erfolgsgeschichte der Kooperation beruhte insoweit ironischerweise in nicht geringem Maße auf der Kapitalisierung von solchen Unterschieden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- Entwicklung der Forschungszusammenarbeit
- Innenansichten
- Globalisierung der Forschung
- Wissenschaftsverständnis
1 Einleitung
Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China im Oktober 1972 (die DDR war 1949 vorangegangen) haben sich die Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in vielen Bereichen nach zaghaften ersten Schritten in geradezu atemberaubendem Tempo fortentwickelt. Dass das so kommen würde, war anfangs keineswegs abzusehen, sondern angesichts der extrem unterschiedlichen Ausgangsbedingungen beider Seiten eher unwahrscheinlich. Trotz etlicher Probleme und Rückschläge erscheint die Beziehungsgeschichte im Rückblick als positiv und erfolgreich. Das gilt zuvorderst für den Bereich der Wirtschaft, in dem beide Länder inzwischen eng miteinander verflochten sind. Ihre vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten sind ein Paradebeispiel für die Bedeutung und Reichweite neuer Formen internationaler Arbeitsteilung und wirtschaftlicher Vernetzung in einer globalisierten Welt.
Die kulturellen Beziehungen entwickelten sich nicht annähernd so stürmisch, umfassend und folgenreich. Doch dank einer Vielzahl von Projekten, Initiativen und Programmen zur Förderung des Austauschs, von Kooperationen und persönlichen Begegnungen ist auch hier viel in Bewegung gekommen. Die Zusammenarbeit von Forscher:innen aus China und Deutschland oder benachbarten europäischen Ländern ist ein besonders interessantes Beispiel für neue Formen und Wege eines intensiven kulturellen Austauschs im beiderseitigen Interesse und zu beiderseitigem Nutzen.
2 Der Bedingungsrahmen: Die Entwicklung der Wissenschaft in China und der Kooperationen mit Deutschland seit den 1970er-Jahren
Den Startschuss für eine intensive Kooperation deutscher und chinesischer Wissenschaftler:innen in Forschungsfeldern von gemeinsamem Interesse gab der Abschluss eines Abkommens zur wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit (WTZ) zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik am 9. Oktober 1978, sechs Jahre nach Eröffnung des diplomatischen Parketts und zwei Jahre nach dem Ende der Kulturrevolution, die Forschung und Hochschulen in China den nahezu totalen Garaus gemacht hatte. Vereinbart wurden ein regelmäßiger Austausch von Informationen und Wissenschaftler:innen, die Einrichtung gemeinsamer Kommissionen und die Durchführung bilateraler Symposien und Forschungsvorhaben. Derartige Science Diplomacy war damals Neuland, zumindest soweit es die Beziehungen mit China betraf. Aus vorsichtig tastenden Anfängen in den 1980er-Jahren mit gelegentlichen Studienbesuchen und Kontakten zwischen der Chinese Academy of Science (CAS) und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) hat sich die chinesisch-deutsche Forschungskooperation zu einer etablierten Arena globalisierter Forschung entwickelt, in der zahlreiche forschungspolitische Akteure, Forschungseinrichtungen, Wissenschaftler:innen und Unternehmen aktiv sind. Für beide Länder ist sie von strategischer Bedeutung, um sich im wettbewerblichen Miteinander neue Forschungsfelder erschließen und an Ansehen sowie internationaler Sichtbarkeit gewinnen zu können.
Institutionalisierte wissenschaftliche Kooperationen zwischen Deutschland und China erlebten nach 1990 eine Hochkonjunktur. Nachdem der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und der chinesische Ministerpräsident Li Peng 1995 ein Gründungsabkommen zum Aufbau eines Chinesisch-Deutschen Zentrums für Wissenschaftsförderung in Beijing als Joint Venture der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der National Natural Science Foundation of China (NSFC) unterzeichnet hatten, konnte dieses im Jahr 2000 seine Arbeit aufnehmen. Weitere Beispiele für neue Formate institutionalisierter Kooperation sind die mehr als 30 Partnergruppen der CAS und MPG, das 2005 etablierte CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology in Shanghai sowie das 1998 gegründete Chinesisch-Deutsche Hochschulkolleg in Shanghai, ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Tongji-Universität unter Beteiligung renommierter deutscher Partneruniversitäten. 2004 kam es dann zur Gründung einer Chinesisch-Deutschen Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ebenfalls in Shanghai. Diese wird von der Tongji-Universität und einem Konsortium von 27 deutschen und schweizerischen Fachhochschulen getragen. 2008 konnten sich dort erstmals auch Studierende aus Deutschland einschreiben. 2015 bestanden insgesamt bereits mehr als 1300 formelle Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und der Volksrepublik China, aus der heute gut zehn Prozent aller ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen kommen, nämlich mehr als 30.000. Zugleich stellen chinesische Wissenschaftler:innen die weitaus größte Gruppe unter den ausländischen Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) für längere Forschungsaufenthalte an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Den Erfolgen der chinesischen Wissenschaft in der Anbahnung und Stabilisierung internationaler Kooperationen korrespondiert eine deutlich gestiegene Präsenz und Wertschätzung Chinas im globalen Wettbewerb um exzellente Forschungsleistungen und wissenschaftliche Innovationen. Den überraschenden Aufstieg ins Oberhaus der Wissenschaft, möglicherweise sogar zur „next science super power“ (Wilsdon und Keeley 2007), ermöglichte nicht zuletzt ein massiver Auf- und Ausbau der materiellen und personellen Ressourcen entsprechend klar definierter strategischer Prioritäten. Betrug der Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) am Bruttoinlandsprodukt der Volksrepublik im Jahr 2000 noch 0,9 %, waren es 2015 bereits 2,15 %. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der FuE-Aufwendungen von 17,3 % zwischen 2000 und 2017 stellte die VRC alle anderen Länder weit in den Schatten. 2015 übertrafen ihre kumulierten FuE-Aufwendungen erstmals die der EU 28 und dürften inzwischen in etwa die der USA erreicht haben (National Science Board, National Science Foundation 2020, Abb. 11 und 13). Der Grund dafür liegt auf der Hand: Für den von der Kommunistischen Partei Chinas beschlossenen radikalen Kurswechsel in der wirtschaftlichen Entwicklung – Aufbau neuer, von indigenen Innovationen bestimmten Industrien anstelle einer Massenproduktion von einfachen Gütern – ist die Expansion des Forschungs- und Hochschulsystems von zentraler Bedeutung. Ohne große und leistungsfähige Kapazitäten im Wissenschaftssystem wäre ein von Hightech, neuen Materialien, Produkten und Verfahren geprägter Paradigmenwechsel zu wissensbasierten Industrien und Dienstleistungen als künftigen Leitsektoren der chinesischen Wirtschaft nicht darstellbar gewesen. Gestützt und gesteuert wurde der gezielte Aus- und Umbau des chinesischen Wissenschaftssystems durch eine Reihe ikonisch gewordener staatlicher Programme mit nüchternen Titeln wie „863“, ein im März 1986 aufgelegtes Förderprogramm für Hochtechnologien, „973“ zur Stimulation grundlagenorientierter Forschungsarbeiten vom März 1997 oder „985“ und „211“ zur Herausbildung einer markanten Spitzengruppe von international konkurrenzfähigen Forschungsuniversitäten in China mit den „C9“ als Flaggschiffen, deren Strukturmerkmale denen in globalen Rankings führender Institutionen nachempfunden sind. Mit dem sogenannten Tausend-Talente-Programm von 2008 schließlich sollten gezielt Spitzenwissenschaftler:innen aus aller Welt angeworben und chinesische Doktoranden aus dem Ausland zurück nach China geholt werden. Da die USA das Programm seit 2018 als eine gezielte staatliche Initiative zum Diebstahl geistigen Eigentums betrachten, findet es heute in China allerdings keine öffentliche Erwähnung mehr.
Die weltweit einzigartigen Wachstumsraten in der Finanzierung der tertiären Bildung und von FuE-Kapazitäten haben erkennbar Früchte getragen: Die Zahl erfolgreich abgeschlossener Promotionen in China, insbesondere in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ist mittlerweile fast genauso hoch wie in den USA. Gleiches gilt für wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich „Science and Engineering“ und für Patentanmeldungen. Während der Anteil der USA an allen vom Science Citation Index erfassten Zeitschriftenartikeln zwischen 2001 und 2011 von 30 auf 26 % gesunken ist – der der EU ging von 35 auf 31 zurück – stieg der Anteil der VRC von drei auf elf Prozent (National Science Board 2014, Kap. 4). In absoluten Zahlen übertraf die Anzahl von Artikeln aus China, die das Peer-Review-Verfahren erfolgreich durchlaufen hatten, bereits 2016 die der aus den USA. Zwischen 2013 und 2018 kamen in 23 von 30 international als besonders zukunftsträchtig geltenden Forschungsfeldern mehr Artikel aus China als aus jedem anderen Land (The Economist 2019). Dabei bestehen aber nach wie vor erhebliche Unterschiede, in welchen Feldern die einzelnen Länder besonders stark oder nur schwach vertreten sind. So produzierten Forscher:innen aus den USA und den 28 Staaten der Europäischen Union (EU-28) im Jahr 2018 jeweils deutlich mehr Artikel im Bereich Biomedizin und Gesundheitswissenschaften als ihre Kolleg:innen aus der VRC. Dafür veröffentlichten diese umgekehrt mehr als doppelt so viele ingenieurwissenschaftliche Artikel wie US-amerikanische Wissenschaftler:innen. Auch ist die Qualität von Publikationen aus China ausweislich bibliometrischer Indikatoren längst nicht so schnell gestiegen wie ihre bloße Zahl. Ihr Anteil an dem einen Prozent der am häufigsten zitierten wissenschaftlichen Arbeiten bleibt noch immer hinter dem der USA und der EU-Mitgliedsstaaten zurück, doch ist auch hier eine stetige Aufholjagd zur Weltspitze zu beobachten. Ist der Anteil eines Landes an den meistzitierten Publikationen gleich dem an allen registrierten Veröffentlichungen, entspricht das einem Indexwert von eins. Im Jahr 2000 hatten die USA als einziges Land mit 1,77 einen Indexwert von mehr als eins erreichen können; die EU folgte mit 0,98 und die VRC blieb mit 0,37 weit abgeschlagen. 2016 stellte sich das Bild vollkommen anders dar: 1,88 für die USA, 1,3 für die EU und 1,18 für die VCR (National Science Board 2020, Abb. 22).
3 Die Attraktivität grenzenloser Forschung
Was aber bedeutet diese fulminante Entwicklung für die internationale Forschungszusammenarbeit von und mit China? Und was wiederum hat sie zur chinesischen Erfolgsgeschichte beigetragen? Seit den 1990er-Jahren gab es weltweit eine verblüffende Zunahme bi- und multinationaler Forschungskollaborationen, und zwar nicht nur in der schieren Anzahl, sondern auch im Themenspektrum sowie in der Art und im Umfang von kollaborativen Projekten mit internationalen Partnern. Internationale Zusammenarbeit ist zweifellos ein Megatrend der Wissenschaftsproduktion geworden (Edler 2010). Die Zahl entsprechender, durch die öffentliche Hand, staatliche und private Agenturen oder Stiftungen geförderte Projekte und Vorhaben ist gleichsam explodiert. Das gilt auch für die dafür bereitgestellten Mittel. Mehr als ein Viertel aller im Web of Science erfassten Veröffentlichungen hat internationale Ko-Autorenschaften. 2011 schätzte die britische Royal Society deren Anteil sogar auf 35 % (Royal Society 2011). 1990 waren es gerade einmal zehn Prozent gewesen (Wagner et al. 2015). Dass immer mehr Länder in den ehemals kleinen, exklusiven Kreis forschungsstarker Nationen drängten, hat die „geography of science“ radikal und wahrscheinlich nachhaltig verändert. Internationale Allianzen, Projektpartnerschaften und strategische Bündnisse sind probate Mittel geworden, um im internationalen Reputations- und Ressourcenwettbewerb der Wissenschaft zu punkten. Arbeitsteilung und Komplementaritäten lassen die Forschungsarbeit effektiver und effizienter werden, aber auch diverser und reichhaltiger. Internationale Partnerschaften, Konsortien, Netzwerke und Projektverbünde symbolisieren die neue Normalität grenzenloser Forschung (Adams 2012).
Kooperatives Kräftemessen und Ressourcenmanagement sind das Gebot der Stunde. Der Hype internationaler Forschungszusammenarbeit hat freilich einen empirisch validen Hintergrund: Arbeiten von internationalen Teams werden häufiger zitiert als die von Autoren aus nur einem Land. Von mehreren Autoren gemeinsam verfasste Artikel haben deutlich höhere Chancen, zitiert zu werden, als solche mit nur einem Autor (Wagner et al. 2015). Wer eine maximale Wirkung (Resonanz) von Publikationen erreichen will – die Währung, in der Erfolge und persönliche Anerkennung in der Wissenschaft gemessen werden –, tut das am besten mittels internationaler Ko-Autorenschaften. Chinesische Forscher:innen können durch die Kooperation mit Kolleg:innen aus den USA oder aus der EU in der Regel wesentlich mehr Zitationen generieren als mit Partnern nur aus dem eigenen Land. Umgekehrt finden internationale Publikationen mit chinesischer Beteiligung mehr Beachtung als Artikel von Autorenteams nur aus der EU oder den USA (Cao et al. 2020). Allerdings haben Wissenschaftler:innen aus China hier noch Nachholbedarf: Nach den jüngsten Statistiken des US-amerikanischen National Science Board hatten 2018 nur knapp 22 % der Publikationen mit chinesischer Beteiligung internationale Partner (127.000 von insgesamt 583.000), 78 % ausschließlich Autoren aus der VRC. In den USA stammten dagegen etwa 40 %, in Deutschland sogar mehr als die Hälfte (gut 53 %), der in den einschlägigen Datenbanken erfassten wissenschaftlichen Veröffentlichungen von internationalen Autorenteams (National Science Board 2020, Abb. 23).
Seit geraumer Zeit hat die Forschungszusammenarbeit zwischen China und Deutschland derart zugenommen, dass beide Länder sie zu einem Schwerpunkt ihrer internationalen wissenschaftspolitischen Aktivitäten erklärt haben. Im Dezember 2015 verabschiedete das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung die „China-Strategie 2015–2020“, ein Jahr später folgte China mit einer „Deutschland Strategie“. Daraus erwuchsen eine neue Förderinitiative und eine Reihe gemeinsamer Forschungsprojekte und institutioneller Impulse, beispielsweise für ein Performance Monitoring des Asiatisch-Pazifischen Forschungsraums mit Schwerpunkt China und für neue, bessere Modelle für die Anbahnung, Auswahl und Abwicklung von Kooperationsprojekten. Die Zusammenarbeit wird von hoher gegenseitiger Wertschätzung getragen und von den meisten Beteiligten als weitgehend unproblematisch und positiv beurteilt. Gleichwohl zeigen sich bei einer näheren Betrachtung deutliche Unterschiede im Wissenschaftsverständnis zwischen deutschen bzw. europäischen Wissenschaftler:innen einerseits und ihren Partnern aus der Volksrepublik. Die Vorstellungen davon, was „gute Wissenschaft“ ausmacht, die jeweilige Motivation für wissenschaftliche Arbeit und die Ziele und Legitimation für die Forschung im Allgemeinen und die eigenen Arbeiten im Besonderen sind durchaus verschieden.
Der Beitrag nimmt die bisher noch wenig ausgeleuchtete Mikroebene der staatlich organisierten Forschungszusammenarbeit mit China in den Blick. Deren Architektur und Prozesse, Felder, Inhalte und Prioritäten sind hinlänglich oft beschrieben und analysiert worden – jedoch nicht die persönlichen Beobachtungen, Erfahrungen und Narrative von Wissenschaftler:innen, die sich in deutsch-chinesischen Projekten oder internationalen Forschungsverbünden engagieren. Wie sehen chinesische Forscher:innen ihre Partner und Kolleg:innen von deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen, und was halten diese umgekehrt von der in China betriebenen Wissenschaft? Was motiviert beide Seiten zu einer Zusammenarbeit und was erhoffen sie sich davon? Immerhin sind dafür nicht unbeträchtliche materielle Mittel nötig. Darüber hinaus wollen große geografische, kulturelle und sprachliche Distanzen sowie oft auch hohe administrative Hürden bewältigt werden. Internationale Kooperationen sind keine Selbstläufer, sondern erfordern von allen Beteiligten besondere Anstrengungen. Sind die Interessen und Vorgehensweisen der Partner weitgehend identisch und deckungsgleich, oder ergänzen sie sich zumindest? Wie bewerten sie den Verlauf und die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit und das Leistungsvermögen ihrer Gegenüber aus dem anderen Land?
Die im Folgenden vorgestellten Einblicke beruhen auf Forschungsarbeiten in dem Projekt „Globalisierung der Forschung“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zwischen 2011 und 2015. Dabei standen die Normen und Spielregeln guter wissenschaftlicher Praxis in internationalen Kooperationen am Beispiel der Zusammenarbeit vor allem deutscher, aber auch einiger Forscher:innen aus europäischen Nachbarstaaten mit China auf dem Prüfstand. Tandems aus langjährigen gemeinsamen Projekten wurden zu typischen Stressfaktoren, ihrem Wissenschaftsverständnis und möglichen Unterschieden zwischen der eigenen Arbeitsweise sowie der der jeweiligen Partner befragt. Neben umfangreichen Literaturrecherchen und bibliometrischen Erkundungen führten wir 70 semi-strukturierte, ein- bis anderthalbstündige Expert:inneninterviews mit namhaften Wissenschaftler:innen und mit Vertreter:innen von Forschungsorganisationen, Ministerien und Fördereinrichtungen in China und in Deutschland, aber auch aus den Niederlanden und der Schweiz. Sofern die Gesprächspartner:innen dem nicht widersprachen, wurden die Interviews aufgenommen, transkribiert und mithilfe elektronischer Tools aufbereitet. Alle folgenden mit (T) gekennzeichneten Zitate sind diesen Transkripten entnommen. Von unseren Interviewpartner:innen waren 54 in Kooperationsprojekten erfahrene Forscher, darunter fünf Frauen. 25 von ihnen waren an Universitäten oder Akademien in der VRC tätig, mehrheitlich in der Chemie, Informatik und Geowissenschaft, sechs in der Schweiz und fünf in Holland. Die Interviews in China fanden zwischen 2012 und 2014 in Beijing, Dalian, Hangzhou, Nanjing und Shanghai statt.Footnote 1
4 Motive für die Forschungszusammenarbeit
Zahlreiche interviewte Wissenschaftler:innen äußerten sich dezidiert positiv über den persönlichen Umgang und die Projektarbeit mit ihren chinesischen Partnern, ihre „Mentalität“ und „Herangehensweise“. Mehrfach positiv erwähnt wurde die „atmosphere of high expectations all around in China that makes it just great to work there“, wie ein holländischer Mathematiker von der Technischen Universität Delft prägnant formulierte (T 22).
Neben individueller Neugier, einer gewissen Sympathie für das jeweils andere Land und Wertschätzung der Kultur lag das stärkste Motiv für eine Zusammenarbeit allerdings darin, dass diese die eigene wissenschaftliche Arbeit bereichern und dem persönlichen Fortkommen dienen könnte. Über gemeinsame Projekte erhofften sich Forscher:innen beider Seiten einen besseren Zugang zu wichtigen Daten, knappen personellen Ressourcen und speziellen wissenschaftlichen Kompetenzen und Kenntnissen, über die sie selber entweder gar nicht oder nur begrenzt verfügten.
Bezüglich der konkreten Ziele für eine Zusammenarbeit zeigten sich jedoch sehr unterschiedliche Präferenzen. Forscher:innen aus Deutschland, den Niederlanden oder der Schweiz interessierten sich für wissenschaftlich attraktive chinaspezifische Forschungsobjekte und -themen, beispielsweise Schwerstofffrachten des Jangtse, die riesige Artenvielfalt des Landes, die großen ariden Gebiete im Westen und Norden oder besondere Umweltbelastungen. Ein Pflanzengenetiker der CAS aus Beijing brachte das folgendermaßen auf den Punkt: „We have special species, special data, special problems. This is a main motivation [für die deutsche Seite – Anm. d. Verf.]. In China, we have 35.000 species of higher plants, while for all Europe, it’s less than 20.000“ (T 32). Ein Umweltingenieur der Peking University betonte die großen Chancen, die eine Forschungszusammenarbeit mit China seinen Kolleg:innen aus dem Westen biete: „If you are interested to compete on the science market, you need special problems. (…) In China, we have many interesting problems. You have to work with China“ (T 25). „Ein deutscher Kollege von der Universität Stuttgart versprach sich von der Forschungszusammenarbeit mit China, ganz auf dieser Linie, eine Gelegenheit, ein Projekt zu haben, was beim Publizieren eine gewisse Beachtung findet. (…) [F]ür ein gutes Journal [kann ich – Anm. d. Verf.] nicht unbedingt mit der Emscher kommen, da muss schon was Spezielles gemacht worden sein“ (T 20).
Daten, zum Beispiel epidemiologische oder ökosystemische, waren für die Befragten ebenso attraktive Pull-Faktoren einer Kooperation mit China wie der erhoffte Zugang zu einzigartigen Material- oder Pflanzensammlungen und Kapazitäten wie beispielsweise des Beijing Genomics Institute, dem weltweit größten Genomsequenzierungszentrum. Und eine Kognitionspsychologin der Beijing Normal University formulierte klipp und klar: „Why do people come from abroad to work with us? Because of our beautiful data. We spend a lot of time on data collection methods and so on. That’s our advantage“ (T 34). Ein Elektrotechniker der Universität Stuttgart verwies auf ein weiteres, zumindest für Ingenieure wichtiges Motiv: „Der chinesische Markt ist der Markt der Zukunft. Da muss man einfach rein“ (T 8).
Viele der interviewten westlichen Wissenschaftler:innen schwärmten geradezu von den großen materiellen und personellen Möglichkeiten Chinas – und das gleich in doppelter Hinsicht. So illustrierte der Direktor eines Max-Planck-Instituts (MPI) in Dresden etwa sein Interesse an China mit einem Wahrscheinlichkeitskalkül: „Intelligenz ist normalverteilt. Also gibt es etwa 15-mal so viele gute Chinesen wie Deutsche. (…) Das heißt, es ist nicht bloß irgendwie interessant, sondern ganz einfach ein Ding der Notwendigkeit, nach China zu gehen, um Talente zu finden“ (T 10). Zum anderen hoben Deutsche auffallend oft den großen Fleiß und Ehrgeiz, die Ausdauer und technische Raffinesse chinesischer Wissenschaftler:innen hervor. „Was die Chinesen gut können, ist, große Mengen von Daten mit großen Mengen von Menschen durchzurechnen“ (T 14, Direktor eines MPI in Potsdam). Ein an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) tätiger Materialforscher resümierte seine Kooperationserfahrungen wie folgt: „Dinge, für die man viel Manpower braucht, kann man in China mittlerweile besser machen als hier“ (T 5). Auch im direkten Vergleich fielen chinesische Wissenschaftler:innen ihren Kooperationspartnern aus Europa sehr positiv auf: „Chinesen sind sehr fleißig und machen das, was man sagt. Andere, auch schon in Europa, machen das nicht. Das ist typischer Südländerstil, den sie an den Tag legen, wo man dann auch nicht so viel davon hat“ (T 1, Chemiker Uni ZH). „Ich habe jetzt einen chinesischen Doktoranden, dem kann man jedes Thema geben. Wenn ich sage, mach dieses, dann macht er das. Wenn ich das vergleiche mit einer gerade frisch promovierten Deutschen – das krasse Gegenteil. Die macht, was sie will. Erst sagt sie ja, aber wenn sie dann sieht, ich will das lieber anders machen, dann macht sie es“ (T 10, Physiker TU DA).
Bewunderung über das Können und die Möglichkeiten der Chinesen äußerte auch ein Umweltbiologe der Universität Zürich: „Was die Chinesen alles können! Die sind absolut perfekt in der Logistik. Wir haben 580 Waldstücke, 30 mal 30 m, die wir mit jeweils 400 Bäumen bepflanzen müssen, und zwar auf einem Terrain, das bis zu 45 Grad Steigung hat, also wirklich extrem. Sie sind mit Hunderten von Leuten rausgegangen und haben das Zeugs gepflanzt, jeden Keimling der richtigen Art am richtigen Ort. Es ist wirklich unglaublich!“ (T 6). Ein technischer Informatiker der Fudan Universität erklärte die Attraktivität großer Forschungsprojekte in China folgendermaßen: „If you have a centralized project, than the efficiency of working together is better in China than anywhere else in the world“ (T 31).
Dass in der Zusammenarbeit gleichwohl stets ein Quidproquo herrscht, belegt die Aussage eines in Deutschland promovierten Ingenieurs der Zhejiang University in Huangzhou: „Die westliche Seite macht die theoretischen Aspekte, wir doch mehr die Praxis“ (T 41). Ein Chemiker von der Technischen Universität Leiden hob einen anderen Aspekt der Kooperation mit einem Partner an einem State Key Laboratory in Dalian hervor: „[They – Anm. des. Verf.] can do characterizations and have facilities to make things that take a lot of work and time, and then we can use them. It’s beneficial for both sides“ (T 44). In bestimmten Bereichen verfügten die chinesischen Wissenschaftler:innen über exquisite technische Kompetenzen und große Raffinesse für ungewöhnlich aufwendige Untersuchungen, ohne die man keine anspruchsvollen Modellrechnungen und weiterführende Forschungen machen könnte. Die Kombination von umfassenden personellen Ressourcen, guten technischen Skills und speziellem Know-how war für westliche Wissenschaftler:innen ein wichtiger Pull-Faktor, Forschungskooperationen mit China einzugehen.
Chinesische Wissenschaftler:innen knüpften typischerweise andere Hoffnungen und Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Deutschland. Sie sahen darin nicht bloß einen „wichtigen Motor, die Qualität der Forschung [in China – Anm. des Verf.] zu verbessern“, wie es eine aus China stammende Professorin der ETHZ formulierte (T 43). Vielmehr erhofften sie sich davon auch ein Entrée in die Spitzenriege der internationalen Forschung. In der Kooperation könnten sie das dafür benötigte methodische und theoretische Rüstzeug erwerben und perfektionieren. Denn bei allem Stolz auf die inzwischen erreichte hohe Leistungsfähigkeit der Wissenschaft in China sahen sich die meisten chinesischen Gesprächspartner:innen zur Zeit der Interviews nach wie vor klar im Rückstand gegenüber dem Westen, den aus eigener Kraft zu schließen sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich wäre. Über die Forschungszusammenarbeit hofften sie, einen besseren Zugang zu internationalen Netzwerken und insbesondere hoch gerankten Zeitschriften zu erlangen, um einerseits der chinesischen Wissenschaft zu mehr Sichtbarkeit und Anerkennung zu verhelfen, andererseits zugleich aber auch selber erkleckliche Gehaltssteigerungen erzielen zu können, die inzwischen überall in China maßgeblich von bibliometrischen Leistungsvorgaben abhängen.
5 Wissenschaftsverständnis
Wer als Doktorand oder Researcher längere Zeit im westlichen Ausland gearbeitet hatte, versprach sich von einer Kooperation auch Impulse für eine grundlegende Änderung der Art und Weise wissenschaftlichen Arbeitens in China: „We need to learn to take more time and be more profound“, sagte ein Chemiker der Tsinghua-Universität (T 40). „Germans think things through. Chinese want to do things very fast and then go on“, sekundierte ihm ein Biologe der Peking Universität (T 27). Tatsächlich werden der chinesischen Wissenschaft im Ausland oft eine Inflation von minderwertigen Publikationen und eine Häufung von Plagiaten und gefälschten Forschungsergebnissen nachgesagt. Der wesentliche Grund dafür sei ein falscher Zuschnitt materieller Leistungsanreize. Ein Materialwissenschaftler der Technischen Universität Darmstadt brachte seine Eindrücke dazu wie folgt auf den Punkt: „Was die machen, muss vermarktbar sein. Das ureigenste wissenschaftliche Interesse bleibt dabei auf der Strecke“ (T 15). Wer im chinesischen Wissenschaftssystem vorankommen will, tut nach Auffassung vieler externer wie interner Beobachter:innen gut daran, schnelle, leicht erreichbare, an der Quantität der Publikationen ausgewiesene Erfolge anzustreben, anstatt sich mit aufwendigen Forschungen mit ungewissem Ausgang abzugeben (Liu et al. 2017). Während sich viele deutsche Wissenschaftler:innen von den technisch-methodischen Fertigkeiten ihrer chinesischen Partner:innen begeistert zeigten, von ihrer Konzentration, Ausdauer und dem Arbeitseifer, konnten diese umgekehrt der wissenschaftlichen Gründlichkeit der Deutschen einiges abgewinnen: „We really learn a lot from German scientists. They think very clearly, work very hard even if they have worked on a problem for a long time, they try to tackle it from a different angle. They focus on it for many years“ (T 32).
Eindeutig im Vordergrund stand für die chinesische Seite jedoch der dringende Wunsch, die Publikationschancen für ihre Arbeiten in den internationalen Top-Journals zu erhöhen: „We still need Western researchers to become a little better but especially to get access to prestigious journals. Don’t forget that all prestigious journals are run by foreigners. We have to collaborate with them. It’s necessary to publish there“ (T 25). Im Beförderungs- und Entlohnungssystem der chinesischen Universitäten und Forschungseinrichtungen stehen internationale Publikationen sehr hoch im Kurs, obwohl oder gerade weil sich Wissenschaftler:innen aus China damit viel schwerer tun als die aus Westeuropa, geschweige denn die aus den USA. „We always measure the impact of our publications. Joint publications always have a higher impact factor than single-side publication. That means if you publish together, you can have a double recognition for your work“, erläuterte ein Geologe der Peking-Universität das Kalkül (T 28). Dahinter steht, expressis verbis oder stillschweigend, die tiefe Überzeugung, Herausgeber und Gutachter internationaler Top-Journals würden chinesische Wissenschaftler:innen systematisch diskriminieren: „We have difficulties in finding access to high-profile journals. They treat us different because we are Chinese at this stage. That’s discrimination“, sagte ein Mathematiker der Pädagogischen Universität Ostchina in Shanghai (T 29). Darauf gründete sich der Vorschlag eines Deals mit westlichen Projektpartnern, der so oder ähnlich in vielen Interviews zur Sprache kam: „You can get access to our top results and be part of them, and we can use your language skills to get them want to work with top-level Western researchers not because we need them or their results, but to get access through them. And they benefit from us, get good results and find special problems“ (T 25).
6 Spiegelbilder: Same same but different
Im Blick der Partner aufeinander, aber auch in der Beschreibung der jeweils eigenen Kultur, in den Narrativen des Selbst und des Anderen, griffen die Interviewpartner befremdlich oft auf Stereotypen zurück.
Dazu gehörte auf westlicher Seite das Urteil, chinesische Wissenschaftler:innen frönten einer „mercurial fashion“, wie es eine Chemikerin der Technischen Universität Delft artikulierte (T 23). Sie wollten schnelle, möglichst „vermarktbare“ Resultate, hätten aber keinen eigenen „Forschungsdrang“ (T 14) und zeigten „keine intrinsische Neugier“ (T 6). Ihre Themen und Projekte wählten sie aus einer mehr oder minder instrumentellen Perspektive im festen Glauben an die „measurability of the world“ (T 22). „Die meinen, mit Daten wird Wissenschaft gemacht. Das geht nicht“ (T 20). Im dominanten Narrativ der westlichen Kooperationspartner sind chinesische Forscher:innen technisch hervorragend, geben sich aber mit Imitation zufrieden, statt echte Innovationen anzustreben. Daher schafften sie es meistens auch nicht, in ihrem Fachgebiet neue Fenster aufzustoßen oder gar die wissenschaftliche Agenda zu bestimmen. „Nachmachen, noch mal machen, was andere gemacht haben – das ist da gang und gäbe,“ befand ein renommierter Hydromechanik-Professor der ETHZ mit langjährigen Erfahrungen in Kooperationsprojekten in China. „Wir dagegen wollen immer etwas, was absolut neu und frisch ist“ (T 2). Ein amerikanischer Kollege, Informatiker an der ETHZ, sekundierte mit folgender Beobachtung: „You can’t afford to be intellectual in our sense, you just have to be competitive. (…) People are more willing to copy things. (…) You don’t get surprised by what came out, you don’t go, wow, never seen as paper like this. (…) They are innovative in finding good solutions for existing problems. They’re really creative in that. But not truly innovative“ (T 3).
In der einen oder anderen Spielart tauchte diese Trope in den Interviews immer wieder auf: „Die wollen nicht wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält“, vermutete ein physikalischer Geograf der Universität Tübingen. Sie arbeiteten „einfach nicht so hypothesenorientiert, sondern messen und erfassen einfach alles, ohne vorab zu überlegen, warum und wofür“ (T 6). Nur selten wurden solche schroffen Verdikte relativiert, wie es etwa eine Chemikerin der Universität Zürich tat: „Wenn man mit einer Hypothese kommt, dann sind sie vielleicht sehr viel genauer im Zerpflücken dieser Hypothese, wie man sie tatsächlich umsetzen soll und was man noch alles berücksichtigen muss. Sie sind viel mehr an Technologie interessiert. Die machen nicht einfach Blabla. Das ist der riesige Unterschied“ (T 4).
Die klare Orientierung der chinesischen Wissenschaftler:innen an real existierenden Problemen statt an aus der Wissenschaft selbst heraus entwickelten Forschungsfragen stieß bei westlichen Interviewpartner:innen mehrheitlich auf Unverständnis, wenn nicht gar Ablehnung. Ein Primat gesellschaftlich nützlicher Forschungsarbeiten erschien ihnen als Gefährdung der Freiheit, der speziellen Funktion und der Leistungsfähigkeit einer selbst verantwortlichen Wissenschaft. Allerdings gab es auch kritische Stimmen, die darauf hinwiesen, auch in Europa nähme der politische Druck zu, Anwendung und Nutzen als neues Leitmotiv wissenschaftlicher Forschung zu akzeptieren und die ‚reine Grundlagenforschung‘ zurückzuschneiden.
Gleichwohl trennte das, was Pierre Bourdieu die „Illusio des wissenschaftlichen Feldes“ (Bourdieu 1998) nannte, „eine Art interessenloses Interesse und Interesse an der Interessenlosigkeit“ als wichtigste Maxime wissenschaftlicher Arbeit, die Selbstwahrnehmung der interviewten westlicher Wissenschaftler:innen und Experten und deren Sicht auf die chinesische Wissenschaft auffallend hart von der Weltsicht ihrer chinesischen Partner. Ob und inwieweit das in der konkreten Forschungszusammenarbeit zu Problemen führte oder es diese belastete, blieb letztlich offen. Allerdings wurde sehr klar, dass in der Praxis der Kooperation auf beiden Seiten methodischer Pragmatismus und epistemische Toleranz vorherrschen und eine große Bereitschaft dazu besteht, Unterschiede als Komplementaritäten zu begreifen, die es im beiderseitigen Interesse zu nutzen gelte.
Stereotype sind kein westliches Privileg. Auch chinesische Wissenschaftler:innen griffen in den Interviews häufig darauf zurück, wenn sie ihre Zusammenarbeit mit westlichen Partner:innen und Unterschiede gegenüber ihrer eigenen Art zu forschen beschreiben sollten. Ein besonders nettes, prägnant-bizarres Beispiel dafür lieferte ein Professor für Elektrotechnik aus Nanjing, der in Deutschland promoviert und einige Jahre als Forschungsgruppenleiter in einem Fraunhofer-Institut gearbeitet hatte. Seine Erfahrungen resümierte er wie folgt: „In Germany, all students and staff are very fleißig workers. But in China, I guarantee you they are at least two times as fleißig. My work here is at least double as hard as in Germany, the hours are double as long, but it is more exciting. When alles in Ordnung, I come to the institute at eight and leave the office at five, I have Ferien, I have Urlaub, but there is weniger Spaß and everything bequemer. When everything is bequem, it’s not my working style, it’s boring“ (T 35).
Interessanterweise zeigten sich in der Selbst- und Fremdbeobachtung beider Seiten so gut wie keine offenen Widersprüche, sondern vor allem spiegelbildliche Entsprechungen. So merkten chinesische Wissenschaftler:innen kritisch an, Deutsche nähmen sich zu viel Zeit für „Tiefenbohrungen“, interessierten sich vorzugsweise für Theorien und innerwissenschaftliche Probleme, aber weder für den praktischen Nutzen ihrer Arbeit noch für irgendeine Anwendung ihrer Wissenschaft. Warum das eine Tugend und wissenschaftlich wertvoller sein sollte, konnten sie nicht nachvollziehen: „What I do makes sense. People need the results (…). What the Germans do, I have no idea. They have the strangest questions, and often it’s totally unimportant“ (T 35).
In der Tat empfanden Forscher:innen aus China einen handfesten Problembezug von Forschungsarbeiten nicht etwa als minderwertig, sondern sahen darin im Gegenteil eine besondere Stärke und einen klaren Vorteil ihrer Art, Wissenschaft zu betreiben. „Die Realität ist hier immer ganz nah“, lobte ein Materialwissenschaftler in Hangzhou seine Arbeit (T 41). Ein Physikalischer Chemiker aus Dalian bezeichnete einen „link to the practical world“ als unerlässlich für seine Arbeit, während ihm „pure research“ reiner Luxus schien (T 34). An der öffentlich und politisch eingeforderten strikten Anwendungsorientierung jeglicher Forschungsarbeit hatte niemand etwas auszusetzen, im Gegenteil. Viele Chines:innen hoben die engen Verbindungen zwischen ihrer Wissenschaft und der Politik lobend hervor. Ein Geograf verwies stolz auf viele Anfragen staatlicher Stellen zu akuten Problemlagen: „If our politicians want to know something, they just call me. The other day I got a phone call from (Ministerpräsident) Le Keqiang. He wanted to know whether to build a large water transfer construction to bring water from South China to the arid North. (…) I gave him a clear answer within two days. And he follows my advice. Something like that cannot work in Germany“ (T 48).
Welches Narrativ wissenschaftlicher Forschung die Deutungshoheit in der globalen Scientific Community erringen wird, ist noch längst nicht ausgemacht. Momentan sieht es eher nach einer friedlichen Koexistenz der beiden Leitmotive aus als nach einer Verdrängung der „reinen“ Grundlagenforschung von dem Thron, den sie in der Welt der Wissenschaften lange innegehabt hatte. Für die Forschungszusammenarbeit mit China wäre das gewiss eine gute Nachricht.
7 Differenzen, Konflikte und Spannungen
In dem, was die Kooperationspartner jeweils als befremdlich, belastend oder gar inakzeptabel an ihrer Forschungszusammenarbeit beschrieben, gab es deutliche, letztlich jedoch erwartbare Differenzen. Dabei ging es fast immer um Irritationen, die das positive Gesamtbild von der Kooperation und den jeweils anderen Beziehungspartner in aller Regel jedoch nicht trüben konnten.
Die von beiden Seiten berichteten Unterschiede im bereits skizzierten professionellen Selbstverständnis, im Arbeitsstil und Erwartungshorizont der Partner:innen belasteten die konkrete Projektzusammenarbeit, wenn überhaupt, dann höchstens nur am Rande. „What we do on the ground is the same, but how we organize our work is quite different and culturally influenced“ (T 32). Ähnliches berichteten auch westliche Interviewpartner:innen.
Konkrete Beispiele für Irritationen und Störgefühle waren einerseits unterschiedliche thematische Präferenzen oder Vorgaben und andererseits Umgangsformen. „It’s about different scientific impacts. We wanted to work on the Huaihe River, which flows a bit north of the Yangzi River. That area is heavily polluted, and we’re interested in that. What we wanted to find out about the surface pollution and its influence on agriculture. But our European partners wanted to know about ground water pollution. And the ground water pollution at this time in China is not very much in the focus of the government. (…) It’s a new subject. The Europeans wanted to do that, but we said we can’t do it because we don’t have enough data“ (T 25). Westliche Wissenschaftler:innen wiederum empfanden die stark hierarchischen Strukturen in der chinesischen Forschung und kleinteilige administrative oder politische Auflagen als Belastung und Handicap für eine gute Zusammenarbeit vor Ort (T 2, 6, 20). Äußerst kritisch betrachteten viele von ihnen den im chinesischen Wissenschaftssystem grassierenden „Quantifizierungswahn“ (Amelung 2009), die Fixierung ihrer Partner auf den messbaren ‚Impact‘ ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihre individuelle Positionierung in prestigiösen Rankings. Dass chinesische Wissenschaftler:innen ihre Forschungsthemen und Projekte „often opportunity-based rather than based on some intellectually driven question“ auswählten, konnten die meisten ihrer Partner aus Deutschland und benachbarten Ländern weder nachvollziehen noch billigen (T 3).
Umgekehrt klagten chinesische Forscher:innen oft sehr explizit über arrogante, schroffe Umgangsformen speziell ihrer Kollegen aus Deutschland. „Sometimes German scientists are not as diplomatic as those from other countries. Sometimes they’re lacking flexibility. I learned a word from a German colleague: zack zack. Chinese scientists are more flexible in this sense“, sagte ein Chemiker der Nanjing Universität (T 26). Ein Zürcher Professor sah es ähnlich: „Die deutsche Art kommt dort nicht an. Wir Schweizer sind sehr indirekt, das kommt bei denen gut an“ (T 6).
Die für deutsche Wissenschaftler:innen neuralgischen Punkte der Kooperation mit chinesischen Kolleg:innen betrafen dagegen nicht persönliche Umgangsformen, sondern vielmehr den Umgang mit Daten und geistigem Eigentum. Mehrere Ingenieure und technisch orientierte Naturwissenschaftler:innen machten in den Interviews ihrem Ärger über die bedenkenlose Bereitschaft chinesischer Doktoranden und wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen zum „Geheimnistransfer“ freimütig Luft und klagten darüber, dass diese sensible Daten, Versuchsergebnisse, Verfahren oder Modelle „abzukupfern“ (T 8, 20 und 14) versuchten. So befürchtete etwa ein Kognitionspsychologe aus Potsdam, seine Kooperationspartner in China könnten eine von ihm entwickelte spezielle Software zur Auswertung von Versuchsdaten, die sie für ihre gemeinsamen Experimente nutzen durften, unerlaubt kopieren und Versuchsergebnisse manipulieren. Um sicherzugehen, dass alle in China erhobenen Daten weder gefälscht noch „poliert“ worden waren, ließ er diese vor einer Veröffentlichung alle heimlich nochmals genau überprüfen (T 11).
Für die Zusammenarbeit gravierender und zugleich besonders delikat waren jedoch insbesondere politische Auflagen und Restriktionen für die Forschungsarbeiten, an denen viele westliche Interviewpartner:innen Anstoß nahmen. So bezeichneten es zum Beispiel Lebenswissenschaftler, Geografen, Wasserbauer und Meteorologen als unfair, dass sie von ihnen selbst in China erhobene Daten nicht „exportieren“ konnten, da China diese als sein Eigentum betrachtete. Speziell in politisch sensiblen Themen und Gebieten war und ist westlichen Forscher:innen nicht nur die freie Verwendung solcher Daten untersagt, sondern immer öfter würde auch der Zugang zu Forschungsobjekten, Sammlungen und Datenquellen quasi von Amts wegen behindert, versagt und erschwert. „In der Hydrologie wird immer davon ausgegangen, der Ausländer ist ein Spion“ (T 2). Zugang zu Messdaten, Objekten und Proben zu finden, wäre für ausländische Wissenschaftler:innen häufig nur über enge Beziehungen zu chinesischen Kooperationspartnern möglich (T 1). In jüngster Zeit würden Forschungsarbeiten tendenziell noch schärfer überwacht und reguliert. Eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit gebe es sowohl im breiten Bereich politisch missliebiger Themen wie Tibet, Taiwan und die Luftverschmutzung in den Metropolen als auch hinsichtlich der expliziten Anweisung oder der eher impliziten, kaum weniger nachdrücklichen Erwartung, von der Staatsführung propagierte historische Narrative nicht kritisch zu hinterfragen. Diese Entwicklung birgt erheblichen Zündstoff und nur schwer kalkulierbare Konfliktrisiken für die weitere Forschungszusammenarbeit mit der Volksrepublik China (Bekkers et al. 2019).
8 Kooperation im Wandel: Perspektiven
Zu guter Letzt zunächst eine gute Botschaft: Die deutsch-chinesische Forschungszusammenarbeit hat in ihrer rasend schnellen Entwicklung zwar einige politische Turbulenzen erlebt, doch ihre insgesamt positive Entwicklung und Erfolgsbilanz konnten diese nicht infrage stellen. Trotz signifikanter Unterschiede in ihrem jeweiligen Verständnis von „guter Wissenschaft“ und in ihrer professionellen Selbstverortung haben chinesische Wissenschaftler:innen und ihre Partner:innen aus Europa ihre Kooperation und Beziehungen nahezu ausnahmslos als positiv, anregend, erfolgreich und persönlich angenehm beschrieben. Konflikte über epistemische Fragen, Standards guter wissenschaftlicher Praxis oder forschungsethische Probleme sind bisher nirgends offiziell dokumentiert worden. Auch in den Interviews unserer Feldstudie spielten sie keine große Rolle, sondern kamen darin höchstens gelegentlich am Rande zur Sprache. Der Blick auf das Gegenüber ist insoweit grosso modo von Respekt und Sympathie, nicht selten sogar von Hochachtung geprägt.
Bedenkt man die erwähnten teils erheblichen Differenzen in den Erwartungen und im Arbeitsstil der Partner:innen und deren nicht immer kongruenten Narrative der Kollaboration, insbesondere in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und Motivation der jeweiligen „Gegenseite“, erscheint dieses Resümee paradox. Doch genau das war bisher die Grundlage für die Erfolgsgeschichte der Forschungszusammenarbeit. War sie auf europäischer Seite anfangs noch stark von einer Neugier auf das Fremde und auf ein wissenschaftlich unbekanntes Terrain motiviert, kamen später zweckrationale Kalküle hinzu, die unterschiedlichen Stärken und Schwächen und komplementären Leistungsportfolios der beiden Seiten zu ihrem gemeinsamen wissenschaftlichen Vorteil zu nutzen: Chinesische und deutsche Wissenschaftler:innen schätzen ihre Zusammenarbeit aus unterschiedlichen Gründen. Ob sich das, was Amerikaner:innen als „leveraging of differences“ bezeichnen, als Gelingensbedingung für die Kooperation erst allmählich in der gemeinsamen Arbeit ergeben hat oder von Anfang an so geplant war, ist eine müßige Frage. Fakt ist, dass sich das Arrangement gut bewährt und beiden Seiten dabei geholfen hat, wichtigen Forschungsinteressen nachzugehen und für beide Seiten interessante Ergebnisse zu erzielen.
Ob diese „terms of trade“ in der deutsch-chinesischen Forschungszusammenarbeit nachhaltig sind, ist allerdings fraglich. Denn in dem Maße, wie es China gelingt, mit viel Elan und Ehrgeiz, Talent und hohem Ressourceneinsatz eine international anerkannte Spitzenforschung zu etablieren, werden sich der Bezugsrahmen und das Interessenkalkül für beide Partner notwendigerweise ändern. Eine Forschungszusammenarbeit auf Augenhöhe hat ihre Bewährungsprobe erst noch vor sich. Ob eine solche Transformation gelingt und von welchen Mustern und Narrativen wissenschaftliche Kooperationen mit und in China künftig geprägt sein werden, ist eine spannende Frage und einer weiteren genauen Beobachtung allemal wert.
Notes
- 1.
Eine 2020 erschienene Dissertation über Gelingensbedingungen deutsch-chinesischer Kooperationen kam auf der Basis von 13 Interviews zu ganz ähnlichen Ergebnissen (Paul 2021).
Literatur
Adams, Jonathan. 2012. The rise of research networks: Collaborations. Nature 490: 335-336.
Amelung, Iwo. 2009. Modernität, Aberglaube und nationale Identität. Überlegungen zur Entwicklung der Wissenschaft in China. WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 6: 96-118.
Bekkers, Frank, W. Oosterveld, und P. Verhagen. 2019. Checklist for Collaboration with Chinese Universities and Other Research Institutions. HCSS Global Trends. The Hague Center for Strategic Studies. https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/BZ127566-HCSS-Checklist-for-collaboration-with-Chinese-Universities.pdf. Zugegriffen: 20. August 2022.
Bourdieu, Pierre. 1998. Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes. Konstanz: UVK.
Cao, Cong, J. Baas, C.S. Wagner, und K. Jonkers. 2020. Returning scientists and the emergence of China’s science system. Science and Public Policy 47: 172–183.
Edler, Jakob. 2010. Coordinate to collaborate: the governance challenges for European international S & T policy. In International science and technology cooperation in a globalized world, Hrsg. Heiko Prange-Gstöhl, 135–160. Cheltenham; Northampton, MA: Edward Elgar.
Liu, Xielin, S.S. Serger, U. Tagscherer, und A.Y. Chang. 2017. Beyond catch-up – can a new innovation policy help China overcome the middle income trap? Science and Public Policy 44: 656–669.
National Science Board. 2014. Science and Engineering Indicators 2014. Arlington VA: National Science Foundation (NSB 14–01). https://www.nsf.gov/statistics/seind14/content/etc/nsb1401.pdf. Zugegriffen: 06. Januar 2022.
National Science Board, National Science Foundation. 2020. Science and Engineering Indicators 2020: The State of U.S. Science and Engineering. NSB-2020–1. Alexandria, VA. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20201/. Zugegriffen: 02. Januar 2021.
Paul, Tina. 2021. Von „Behältern“ und „Systemen“. Deutsch-chinesische Wissenschaftskooperation aus der Sicht deutscher Forscherinnen und Forscher. die hochschule 1: 5–18.
The Economist. 2019. Red moon rising. If China dominates science, should the world worry? The Economist, 12. Januar.
Royal Society. 2011. Knowledge, Networks and Nations: Global scientific collaboration in the 21st century, RS Policy document 03/2011. London: The Royal Society.
Wagner, Caroline S., H.W. Park, und L. Leydesdorff. 2015. The Continuing Growth of Global Cooperation Networks in Research: A Conundrum for National Governments. PLOS one 10(7): e0131816.
Wilsdon, James, und J. Keeley. 2007. China: The next science superpower? London: Demos.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Schreiterer, U. (2023). Zur Entwicklung der Forschungszusammenarbeit mit China. In: Hu, C., Triebel, O., Zimmer, T. (eds) Im Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdverstehen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_9
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_9
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-40030-9
Online ISBN: 978-3-658-40031-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)