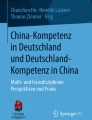Zusammenfassung
Der Aufsatz bietet eine differenzierte Betrachtung des Chinabildes der Deutschen und ihrer Wahrnehmung der chinesischen Kultur angesichts der Entwicklungen in der Gegenwart und der Rolle Chinas in der modernen Welt. Analysiert wird Chinas Rolle als wirtschaftlicher und politischer Akteur, um Möglichkeiten und Grenzen in den deutsch-chinesischen Beziehungen zu verdeutlichen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
China durchläuft einen wirtschaftlichen und sozialen Modernisierungsschub und flankiert seinen wachsenden wirtschaftlichen Einfluss und seine politischen Interessen mit einer zunehmend ambitionierteren Außenpolitik. Es profiliert sich international mit einer umfassenden Kooperationsstrategie und mit ehrgeizigen Initiativen und Projekten, speziell im Rahmen der „Neuen Seidenstraße“. Chinesische Unternehmen haben zahlreiche Firmen in Deutschland und Europa übernommen oder Beteiligungen erworben. Gleichzeitig haben die transatlantischen Beziehungen unter der Regierungsführung von US-Präsident Donald Trump nachhaltig gelitten. Auch die Chinapolitik der neuen US-Regierung unter Joe Biden versucht, den Aufschwung Chinas einzudämmen. Es ist dennoch unverkennbar, dass die internationalen Beziehungen gegenwärtig Kräfteverschiebungen in Richtung Asien ausgesetzt sind, auch wenn geopolitische Spannungen infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine die Entwicklung von Szenarien der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in vielen Weltregionen, darunter China und Deutschland, erschweren. Die Sichtweisen auf die Rolle Chinas polarisieren sich in Europa und speziell auch in Deutschland. Die deutsch-chinesischen Beziehungen laufen Gefahr, in ein turbulentes außen- und sicherheitspolitisches Fahrwasser zu geraten. Solche Entwicklungen könnten den Blick auf die beidseitig in vielen Bereichen gewinnbringenden Wirtschaftsbeziehungen und andere gemeinsame Interessen, speziell in der Klimapolitik, in der Wissenschaft und in anderen Feldern der internationalen Zusammenarbeit, verstellen, speziell wenn sich die deutsche Politik zu einseitig beraten lässt, mit expliziten China-Strategien zu sehr auf Konfrontationskurs geht, deutsche Leitmedien über China (weiter) zu einseitig informieren und Chinas Einfluss und Zusammenarbeit in anderen Weltregionen in Deutschland zu wenig Beachtung findet.
1 Einleitung
In diesem Beitrag soll das Chinabild der Deutschen einer differenzierten Betrachtung zugeführt werden, beginnend mit einem Blick auf die chinesische Kultur und Zivilisation, mit Fokus auf die Gegenwart und bezogen auf Chinas Rolle in der modernen Welt. Anschließend wird Chinas Rolle als globaler wirtschaftlicher Akteur im Fokus stehen, bevor der Blick auf dessen Rolle als globaler politischer Akteur gerichtet wird. Vor dem Hintergrund solcher kurzen Analysen schließt dieser Beitrag mit einem Ausblick der deutsch-chinesischen Beziehungen.
In diesen Überblicksartikel fließen verschiedene Forschungsarbeiten des Autors zu Chinas Rolle in den internationalen Beziehungen ein (Kuhn 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a, b) sowie politische Analysen im Rahmen des Austausches mit Think Tanks, unter anderem mit der Brookings Institution, der Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden, dem Center for China and Globalisation (CCG), dem Dialogue of Civilisations Research Institute (DOC) und Mercator Institute for China Studies (MERICS). Auch persönliche Erfahrungen aus zahlreichen beruflichen und privaten China-Aufenthalten werden berücksichtigt, nicht zuletzt die vielen Gespräche mit Chinaexpertinnen und -experten und Chinesinnen und Chinesen in Deutschland, einschließlich der Ehefrau des Autors, YU Miao.
Der Titel des Beitrags „China in der Welt aus deutscher Perspektive“ wirft die Frage auf, ob es eine deutsche Perspektive auf China überhaupt gibt oder geben sollte, oder ob wir nicht vielleicht besser von vielen und zum Teil sehr unterschiedlichen Perspektiven auf China sprechen sollten. Eines steht fest: Die Auseinandersetzung mit China als globaler Wirtschaftsmacht und zunehmend ambitionierterem globalen politischen Akteur hat sich in den letzten Jahren intensiviert. Die Anzahl der Veröffentlichungen zu China steigt rasant und die Sichtweisen auf China multiplizieren sich. Die Bandbreite der Analysen zu China ist groß. Allerdings sind dabei gewisse antagonistische Tendenzen nicht zu übersehen. Eines der aktuellen Bücher, das von zahlreichen deutschen Medien zitiert wird, ist eine besonders kritische Analyse der Rolle Chinas in der Welt: Die lautlose Eroberung: Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg (2020). Letztere war bis April 2020 für MERICS tätig und wechselte anschließend zum German Marshall Fund of the United States. Die Sprache der beiden Autoren kommt martialisch daher: „Dabei setzt es nicht nur seine Wirtschaftsmacht als Waffe ein, sondern die gesamte Bandbreite seiner Politik“, heißt es im Klappentext. Wolfram Elsner (2020) dagegen würdigt in seinem Buch Das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer eins ist anders! die wirtschaftspolitischen Leistungen und sozialen Errungenschaften Chinas und plädiert für einen offenen Dialog sowie für eine verlässliche, langfristige und selbstbewusste Kooperation mit der neuen Weltmacht. Das Buch vermittelt eine Bewunderung für die Leistungen Chinas auf vielen Gebieten. Kritische Reflektionen zu Herausforderungen oder Bedrohungen für europäische Werte und Interessen, zum Beispiel durch einen überbordenden Nationalismus, finden sich in dem Buch kaum. Es provoziert jedoch mit einigen undifferenzierten Spitzen gegen Politik, Parteien und Leitmedien in Deutschland.
Die transatlantischen Beziehungen haben die Auseinandersetzung mit China in Deutschland angeheizt, weil die USA ihre Verbündeten dazu drängen, im Konflikt mit China Position zu beziehen. Deutschland stellte sich jedoch vielen Bestrebungen der Trump-Regierung zu Strafzöllen entgegen und folgte auch nicht dem von den USA praktizierten diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022. Jedoch ist und bleibt die transatlantische Partnerschaft weiter wirkungsmächtig und beeinflusst die Chinadebatte in Deutschland. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und China bleibt jedoch weiter sehr groß.
Im Vergleich zu den USA schien China im Hinblick auf die öffentliche Meinung in Deutschland von der Covid-19-Pandemie zunächst profitiert zu haben. Eine repräsentative Umfrage der Körber-Stiftung zu Deutschlands Außenpolitik im Kontext der Corona-Pandemie kam im April 2020 zu dem Ergebnis, dass eine Verschiebung der Wertschätzung der Deutschen zugunsten Pekings stattfindet: „Während 37 % der Deutschen enge Beziehungen zu den USA vorzogen, sahen 36 % der Befragten enge Beziehungen zu China als wichtiger an. Im September 2019 fiel die Antwort auf dieselbe Frage mit 50 zu 24 % noch deutlich zugunsten der USA aus.“ (Körber-Stiftung 2020). Mit zunehmender Fortdauer der Covid-19-Pandemie wurden die rigiden Maßnahmen der Null-Covid-19-Politik in China und die langen Quarantänezeiten für internationale Reisende von der deutschen Wirtschaft und auch breiteren Öffentlichkeit zunehmend kritisch gesehen. Anders als Deutschland und andere EU-Staaten passte China seine Covid-19 Maßnahmen auch im Kontext der Omikron-Variante zunächst kaum an. Schließlich vollzog China im Dezember 2022 eine Kehrtwende und beendete die Politik der Lockdowns nach öffentlichen Protesten. In China und international wurde dies überwiegend positiv aufgenommen, obwohl die Zahl der Infektionen deutlich anstieg.
Viele Deutsche, speziell Chinaexpertinnen und -experten, sehen die politischen Entwicklungen der letzten Jahre kritisch bis sehr kritisch. Die sich ausweitende Machtfülle von Präsident Xi Jinping und der autoritärer gewordene Regierungsstil lassen in Deutschland und in vielen anderen Staaten der Europäischen Union (EU) Sorgen anwachsen, dass die Unterschiedlichkeit der politischen Systeme eine Zusammenarbeit erschweren und politische Antagonismen das Verhältnis zunehmend belasten könnten. In einem Dokument der EU-Kommission zur Chinastrategie vom März 2019 (European Commission 2019) wird die Volksrepublik erstmals als „Rivale“ in einem Systemwettbewerb beschrieben („systemic rival“), weil China dem marktwirtschaftlichen Modell der EU und der USA nicht nur sein merkantilistisches oder staatskapitalistisches Modell entgegenstellt, sondern versucht, es in alle Welt zu exportieren (Kafsack 2019). Der Bund der Deutschen Industrie (BDI) spricht in seinen Analysen zu China allerdings nur von China als Partner und systemischen Wettbewerber („partner and systemic competitor“), nicht direkt von einem Rivalen (BDI 2019).
Das Chinabild der Deutschen wird nun zunehmend stärker von sich verstärkenden außenpolitischen Konfrontationen geprägt. Im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprechen sich Teile der neuen Bundesregierung, speziell Abgeordnete der Grünen und der FDP, für einen härteren Kurs ggü. China aus. Bundeskanzler Scholz reiste am 4. Dezember 2022 mit einer Wirtschaftsdelegation für einen kurzen Besuch nach Peking. In den Gesprächen mit Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang standen internationale Themen, bilaterale Beziehungen und Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt. Die Reaktionen auf den Besuch des Bundeskanzlers und auf die Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Cosco am Hamburger Hafen machten deutlich, dass die Meinungen zum Umgang mit China in Deutschland weit auseinandergehen.
Die deutsche Außenpolitik wird nicht nur durch die Position der USA und durch die Politik der EU-Kommission geprägt. Sie ist auch ein Spiegel der deutschen Gesellschaft, in der verschiedene Akteure und Milieus, zum Teil aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen und persönlicher Befindlichkeiten, verschiedene Sichtweisen auf China einnehmen. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock postuliert eine „werteorientierte Außenpolitik“, allerdings bleibt noch im Unklaren, wie wünschenswerte Erfolge, zum Beispiel im Bereich der politischen Meinungsfreiheit und der Menschenrechte, erzielt werden können und ob eine sehr konfrontative Strategie zielführend wäre oder ob ein solches Vorgehen viel eher Chancen für Dialoge vergeben könnte. Letztlich wird der mögliche Einfluss der deutschen und internationalen Politik auf chinesische Innenpolitik vermutlich immer noch deutlich überschätzt und viele konfrontativen Diskurse können als Profilierungen in der deutschen Innenpolitik oder sollen als Signale an die USA verstanden werden. Zur Zeit der Drucklegung standen die Verabschiedungen von China Strategien des Außenministerium und des Wirtschafts- und Klimaministeriums kurz bevor. Von der deutschen Wirtschaft waren dazu kritische Stimmern zu vernehmen. Auch aus der Wissenschaft kommt Kritik, denn die zahlreichen und intensiven wissenschaftlichen Kooperationen finden nur auf sehr wenigen Seiten Erwähnung.
Das Thema Digitalisierung ist ein weiterer neuralgischer Punkt in den Beziehungen mit China. Einerseits ist Deutschland bestrebt, die Digitalisierung weiter voranzutreiben, um neue Formen der Kommunikation, Produktion und Entwicklung von international wettbewerbsfähigen Unternehmen und Geschäftsmodellen voranzubringen. Andererseits ist der Schutz der persönlichen Daten in Deutschland ein besonders sensibles Thema, das einige Geschäftsmodelle und Strategien zur Effizienzsteigerung von Prozessen in Behörden in ihrer Umsetzung stark behindert. China bleibt ein wichtiger Lieferant von Produkten, die Deutschland für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie benötigt. Auch viele Rohstoffe aus China sind für Deutschland kaum zu ersetzen. Bei Magnesium beträgt der Anteil der Importe aus China etwa 50 Prozent, bei den seltenen Erden 45 Prozent.
China hat besonders in den letzten zehn Jahren große technologische Fortschritte gemacht. Gleichzeitig ist es bestrebt, moderne Technologien auch für die soziale und politische Kontrolle seiner Bürgerinnen und Bürger und zumindest auch für in China lebende Ausländerinnen und Ausländer einzusetzen, damit politische Freiheiten zu begrenzen und den Weg zum omnipräsenten Staat und zum „Gläsernen Menschen“ zu ebnen (Alpermann und Thünken 2018). Eine solche Vorstellung verbinden viele Deutsche mit den Büchern von Aldous Huxley and George Orwell, die übrigens in China, für manche erstaunlich, erhältlich sind (Hawkins und Wassertrom 2019).
2 China in der Welt aus kultureller Perspektive
China blickt auf eine Geschichte von fast 5000 Jahren zurück. Viele große Zivilisationen sind in dieser Zeit untergegangen. Warum hat die chinesische Zivilisation andere große Zivilisationen überlebt? Diese Frage stellte Die Zeit vor einigen Jahren dem früheren US-amerikanischen Außenminister und Chinakenner Henry Kissinger. Dieser antwortete: „Weil es den Chinesen gelungen ist, ihre Institutionen auf ein kulturelles Muster zu gründen“ (Naß 2011). Bezüge zur alten chinesischen Kultur sind im politischen China, ganz anders als im Westen, seit jeher sehr präsent. Selbst Mao Zedong konnte auf sie nicht verzichten. Mit der wirtschaftlichen Öffnung, die auf der dritten Plenartagung des 11. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (KP) Chinas im Dezember 1978 eingeleitet wurde, erlebten alte Werte und Traditionen der chinesischen Kultur einen allmählichen Aufschwung. Die Formel vom Aufbau einer „Harmonischen Gesellschaft“, die Hu Jintao prägte, greift dabei direkt den Schlüsselbegriff der konfuzianischen Lehre auf: Harmonie (Blume 2005).
Mit einer vom Konfuzianismus geprägten chinesischen Kultur der Gegenwart werden in der deutschen Öffentlichkeit in der Regel Beziehungen und Strukturen assoziiert, die hierarchischer und auch autoritärer sind als die im heutigen Deutschland. Chinaexpertinnen und -experten würden allerdings konstatieren, dass Hierarchie und Autorität in China tendenziell positiver konnotiert sind als hierzulande, wo speziell das Wort „Führer“ durch die Verbrechen Adolf Hitlers, der sich selbst als Führer bezeichnete und bezeichnen ließ, diskreditiert ist. Bei Konfuzius wird stark auf die moralische Vorbildfunktion des Herrschers zurückgegriffen. Handelt der Herrscher unmoralisch, wird auch der Staat zwangsläufig in ein Chaos verfallen. Konfuzius betonte die Rolle und die Aufgabe des einzelnen Menschen in und für die Gesellschaft, weniger die Freiheit des Individuums, wie sie die europäische Aufklärung postulierte. Der Konfuzianismus als die Lehre von Konfuzius bildet weiterhin das Fundament der chinesischen Erziehung, speziell im familiären Umfeld und bezogen auf den Erwerb von Bildung. Er wird in jüngster Zeit wiederbelebt und dient als Grundlage des kulturellen Selbstverständnisses. Dagegen hätten der Daoismus, der Legalismus und der Buddhismus die chinesische Erziehung weit weniger eigenständig beeinflusst (Reich und Wei 1991).
Begriffe wie Identität und Kultur spielen in politischen Diskursen in Deutschland und in anderen Staaten eine zunehmend bedeutendere Rolle. China ist auf solche Diskurse sehr gut vorbereitet und unternimmt einige Anstrengungen, die Bedeutung der chinesischen Kultur für die Entwicklung eines stabilen Staats- und Gemeinwesens mit hoher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit herauszustellen, speziell in der Auseinandersetzung mit westlichen Gesellschaften, denen in China von manchen politischen Analysten eine Identitätskrise bescheinigt wird. Eine solche würde von Zentrifugalkräften befördert, die wiederum durch ein rivalisierendes Mehrparteiensystem akzentuiert würden. China setzt dem politischen Pluralismus ein Modell der konsultativen Demokratie entgegen und betont dabei die Beteiligungsmöglichkeiten für fachliche Experten und für verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die in den wichtigsten politischen Institutionen politisch gut repräsentiert seien. Die Stärken des Modells werden von wirtschaftsnahen chinesischen Denkfabriken gesehen (Wang 2021).
„Kultur ist die neue Währung der Macht“, lautet die These von Christopher Coker, die er in seinem Buch The Civilisational State (2018) aufstellt. Statt politischer Ideologien stehen nun kulturelle Identitäten im Mittelpunkt von Auseinandersetzungen. Auch Francis Fukuyama konstatiert diese Verschiebung in seinem Werk Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition (2018). Die These von „Kultur als neuer politischer Währung“ hat Bezüge zu der von Samuel Huntington angestoßenen Debatte zum Kampf der Kulturen (1996). Es ist das umstrittenste, aber wahrscheinlich bis heute einflussreichste politikwissenschaftliche Werk der Nachkriegszeit. Adrian Pabst konstatiert, dass wir gerade das Ende der liberalen Weltordnung und den Aufstieg des Zivilisationsstaates („Civilisational State“) erleben, der von sich beansprucht, nicht nur eine Nation oder ein Territorium, sondern eine außergewöhnliche Zivilisation zu repräsentieren (Pabst 2019). Der Begriff des „Civilisational State“ wurde nicht nur vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping gebraucht. Auch der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan haben sich darauf bezogen – zwei, die in den Augen vieler Deutscher als „Widersacher des Westens“ gelten. Dies hat mit dazu beigetragen, dass das Konzept des Zivilisationsstaates in wissenschaftlichen Kreisen in Deutschland eher diskreditiert ist. Auch China steht tendenziell im Verdacht, mit diskursiven Rückgriffen auf die chinesische Kultur und die zivilisatorischen Errungenschaften die Selbstbestimmung von Minderheiten, speziell der Tibeter und Uiguren, zu unterdrücken.
Das Chinabild in Deutschland wird inzwischen auch stark vom kulturellen Austausch geprägt, vom Handeln und Verhalten von Chinesinnen und Chinesen, die in Deutschland leben, und durch berufliche und private Aufenthalte von Deutschen in China. Viele Deutsche, die sich für China interessieren und enge Kontakte zur chinesischen Bevölkerung pflegen, machen im interkulturellen Austausch positive Erfahrungen. Respektvolles und zurückhaltendes Auftreten, Interesse an der deutschen Kultur, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft sind nur einige Eigenschaften, die Chinesinnen und Chinesen zugeschrieben werden. Solche Erfahrungen kontrastieren häufig mit dem Chinabild in den deutschen Medien, das von einer kritischen politischen Berichterstattung geprägt ist.
Viele Chinesinnen und Chinesen in Deutschland sind positive Botschafter ihres Landes, sie sind stolz auf dessen wirtschaftliche und kulturelle Errungenschaften. Kein Land hat jemals einen schnelleren wirtschaftlichen Aufstieg erlebt. In den Jahren 2000 bis 2010 erreichte China ein Wirtschaftswachstum zwischen 8 und 14 % und stieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf (Macrotrends 2022). Chinesinnen und Chinesen in Deutschland vertreten ihr Land heute ganz anders als jene wenigen, die vor mehreren Jahrzehnten nach Deutschland kamen und damals ein relativ armes Land repräsentierten. Der persönliche Austausch hat in den letzten Jahrzehnten stetig und stark zugenommen, zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie.
Zu Beginn des Jahres 2020 war China als Ursprungsland der Covid-19-Erkrankungen in der deutschen Öffentlichkeit durch omnipräsente Medienberichterstattung so stark präsent, dass der Faktor „persönlicher Austausch“ kurzfristig stark ins Hintertreffen geriet. Der Titel „Corona-Virus. Made in China“ des Nachrichtenmagazins Der Spiegel vom 1. Februar 2020 (Fahrion et al. 2020) hat viele in Deutschland lebende Chinesinnen und Chinesen provoziert und war auch in den sozialen Medien Chinas Thema.Footnote 1
Wie erklärt sich die zunehmende Polarisierung des Chinabildes in Deutschland? Gespräche mit Deutschen und Chinesen, die sich im interkulturellen Austausch engagieren, legen nahe, dass das Chinabild der Deutschen, die über eigene Erfahrungen in und mit China verfügen, die kulturellen Wahrnehmungen stärker mit einbezieht und dass sich so ein tendenziell positives, differenzierteres Gegengewicht zur kritischen Chinaberichterstattung in Deutschland herausbilden kann. Junge Chinesinnen und Chinesen gelten in Deutschland als beruflich ehrgeizig und zielstrebig, aber auch als wissenschaftlich und kulturell sehr interessiert. Der Andrang chinesischer Studierender an deutschen Universitäten und Kunst- und Musikhochschulen ist schon seit etwa zehn Jahren sehr hoch (Amann 2010). Es gibt inzwischen viele bekannte chinesische Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland leben.Footnote 2 Die Covid-19-Pandemie hat es nun für nachwachsende Kunstschaffende sehr erschwert, ein Studium in Deutschland oder Europa aufzunehmen oder Konzertreisen zu unternehmen. Sollten sich die Reisebedingungen wieder verbessern, ist davon auszugehen, dass auch wieder mehr Kunstschaffende nach Deutschland kommen. Es gibt jedoch Agenturen, die ihnen beim Erwerb der deutschen Sprache und der Integration helfen.Footnote 3
Im Bereich der familiären Erziehung wird der Bildungsehrgeiz, der besonders chinesischen Müttern nachgesagt wird („Tiger Mama“), zwar kritisch gesehen, er bekommt aber auch viel Respekt und zum Teil Bewunderung, wenn er sich in Bereichen zeigt, die dem deutschen Bildungsbürgertum am Herzen liegen, zum Beispiel beim Erlernen eines Musikinstruments.
Solche Erfahrungen im persönlichen Bereich prägen das Chinabild in Deutschland in einem nicht unbedeutenden Maße, und sie relativieren das kritische Bild derjenigen, die selbst oder deren Familie in einem autoritären Herrschaftssystem sozialisiert wurden. Auf der politischen Ebene wird China kommunistisch regiert. In Deutschland wird kommunistische politische Herrschaft mit einem sehr präsenten Zentralstaat assoziiert. Das ist im Fall Chinas allerdings differenziert zu betrachten. Es trifft auf die politische Propaganda und das politische Ordnungssystem zu, jedoch verfügen die einzelnen Provinzen und Städte in China im wirtschaftlichen Bereich über große Handlungsspielräume, die verschiedenen Regionen über ausgeprägte kulturelle Identitäten. Auch die dynamische Privatwirtschaft konnte sich zumindest in den ersten Jahrzehnten des wirtschaftlichen Aufstiegs ohne große staatliche Gängelung entwickeln. Unternehmertum und wirtschaftliche Freiheit gelten nach wie vor als wichtige Grundlagen für Innovation und Entwicklung.
3 China als wirtschaftlicher Akteur
Chinas Globalisierungsgeschichte ist von Höhen und Tiefen geprägt. Die wechselvolle Wirtschaftsgeschichte ist auch heute noch für die Bevölkerung relevant, weil der Wunsch nach wirtschaftlicher Aufholung und einem hohen Lebensstandard eine große Triebfeder für Chinas wirtschaftliche Entwicklung bleibt.
Im 10. Jahrhundert erlebte Chinas eine wirtschaftliche Hochzeit. Schon im 11. Jahrhundert verfügte die chinesische Stahlindustrie über alle Technologien, die in Europa erst bis zum 19. Jahrhundert entwickelt wurden. In den folgenden Jahrhunderten konnte die chinesische Wirtschaft ihre führende Position jedoch nicht durchgehend halten. China blieb seit dem 16. Jahrhundert mehr und mehr hinter dem Wachstum der westlichen Länder zurück und trat spätestens seit dem späten 18. Jahrhundert in eine Phase des Niedergangs ein. Im frühen 19. Jahrhundert verlor es die Position als weltgrößte Wirtschaftsmacht. China war an dem starken Globalisierungsschub des 19. Jahrhunderts kaum beteiligt. Durch die Niederlage im Ersten Opiumkrieg (1839–1842) gegen Großbritannien wurde China zum Abschluss der sogenannten Ungleichen Verträge gezwungen. Es musste seine Märkte öffnen und Opium importieren. Die westlichen Kolonialmächte setzten ihre Wirtschaftsinteressen rücksichtslos durch und erschütterten Chinas Selbstverständnis von der Zentralität und Universalität des Landes zutiefst (Weigelin-Schwiedrzik 2012). Der wirtschaftliche Niedergang und der damit verbundene Ansehensverlust in der Weltöffentlichkeit setzten sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs fort und machten der politischen Führung und vielen Chinesinnen und Chinesen psychologisch zu schaffen.
Der „Große Sprung nach vorn“ (1958–1961) hatte in China unter der Führung von Mao Zedong über viele Jahre Massenarmut produziert und in den Jahren der Kulturrevolution (1966–1976) hatte China vollends den Anschluss an die wirtschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegszeit verloren, die durch starke Wachstumsraten in den USA und in Westeuropa geprägt waren. Chinas wirtschaftlicher Aufholprozess setzte erst nach einer langen Phase großer politischer Umwälzungen und schwerer wirtschaftlicher Rückschläge mit der Preisliberalisierung, der Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen und der wirtschaftlichen Öffnung ab 1978 ein.
China konnte speziell durch seinen Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) im Dezember 2001 die eigene Wirtschaftskraft erheblich ausbauen und zum Exportweltmeister für Waren aufsteigen. Davon haben gerade deutsche Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher stark profitiert. (BDI 2021). China ist inzwischen nach Kaufkraftparität in US-Dollar die größte Volkswirtschaft.Footnote 4 China ist mit großem Abstand das Land mit den größten Exportvolumen weltweit. Es ist beim Umsatz (Exporte plus Importe) der größte Handelspartner Deutschlands (Statistisches Bundesamt 2022). Allerdings haben die Covid-19 Beschränkungen zu größeren Einbußen geführt und es ist im Kontext von Decoupling Rhetorik nicht wahrscheinlich, dass das Handelsvolumen mit China weiter so wächst wie in den letzten Jahrzehnten. Voraussagen dazu sind jedoch schwierig zu treffen, weil diese stark von politischen, auch geopolitischen Entwicklungen abhängen.
Chinas Wirtschaft hat sich dabei von einem Niedrigtechnologiestatus in einen Standort für die Entwicklung vieler Hochtechnologien entwickelt, in vielen Bereichen ist es weltweit führend. Im Rahmen der Industriestrategie „Made in China 2025“ wurden zehn Industrien ausgewählt, in denen China eine weltweite Führungsrolle anstrebt. Dazu zählen Raumfahrt, Schiffbau, Fahrzeugbau, Robotik und Informationstechnik. Die 5G-Entwicklung ist ein entscheidendes Element auf dem Weg zur globalen wirtschaftlichen Führungsmacht, denn es hat das Potenzial, die chinesische Wirtschaft von einer kapital- und arbeitskraftintensiven in eine innovations- und konsumgetriebene Wirtschaft zu transformieren. China hat sich bei der Elektromobilität an die Spitze vorgearbeitet. Bei Halbleitern besteht noch Aufholbedarf. Der Widerstand der USA führt eher dazu, dass China seine Bemühungen verdoppelt (Groth 2019). Mit seinem Zugang zu extrem großen Datenmengen, die die Basis für Künstliche Intelligenz (KI) bilden, hat China große Wettbewerbsvorteile. Es wird eines der ersten Länder mit einem umfangreichen 5G-Netzwerk sein.
China ist ein sehr wichtiger Absatzmarkt für viele deutsche Produkte, speziell für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, aber auch für Produkte von sogenannten Hidden Champions, die weniger bekannte Produkte herstellen, die jedoch gleichzeitig eine große Verbreitung finden und dem guten Ruf Deutschlands in China zuträglich sind. Dazu zählen Produkte aus dem Haushalt- und Sanitärbereich und Artikel für Babys und Kleinkinder. Besonders junge chinesische Mittelschichtsfamilien sind sehr qualitätsbewusst und achten auf hohe Gesundheitsstandards von Produkten für ihre Kinder. Deutschland gilt dabei international als Vorreiter für Qualitätskontrolle von Produkten des täglichen Lebens, speziell im Bereich Nahrung und Kinderspielzeug.
Mit der zunehmenden Bekanntheit deutscher Hersteller in China haben sich seitens chinesischer Investoren auch Begehrlichkeiten entwickelt, die in Deutschland schon seit knapp zehn Jahren kritische Diskussionen hervorrufen. Es geht dabei um die Frage, ob Deutschland chinesischen Investoren unbeschränkten Zugang zu Akquisitionen gewähren soll. Der Aufkauf des Betonpumpenherstellers Putzmeister in Aichtal durch das chinesische Unternehmen Sany und die Übernahmen deutscher Marken wie Goldpfeil oder Junghans und Unternehmensbeteiligungen an der Drogeriekette Rossmann (40 %) haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass eine Diskussion um das Thema Investitionen in Deutschland durch chinesische Investoren entbrannt ist (Emons 2013). Auch die Übernahme von Kuka, einem Hersteller von Industrierobotern, durch Midea schürte in Deutschland die Angst vor China (Doll und Hegmann 2018). Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte Pläne für ein Absenken der Veto-Schwelle des Bundes bei ausländischen Kapitalanteilen an Unternehmen an. Dies würde bedeuten, dass chinesische Investitionen in einigen Bereichen sehr genau geprüft werden. Auch auf EU-Ebene werden neue Gesetzesinitiativen diskutiert, die nichteuropäische Firmen betreffen, die von staatlichen Subventionen profitieren und Unternehmen in EU-Staaten übernehmen wollen. Dabei ist explizit von chinesischen Unternehmen die Rede (Finke 2020).
Der wirtschaftliche Erfolg Chinas hat in Deutschland einerseits die Angst vor Konkurrenz geschürt, andererseits auch das Interesse verstärkt, sich mit der chinesischen Kultur auseinanderzusetzen. Dem Kommunismus als Staatsdoktrin wird weiterhin von der großen Mehrheit der Deutschen – durchaus berechtigt – nicht zugetraut, dass er der eigentliche Wegbereiter für den wirtschaftlichen Erfolg und den weltpolitischen Aufstieg Chinas ist. Nicht der Kommunismus, sondern die Politik der wirtschaftlichen Öffnung und Liberalisierung hat China aus Sicht von Expertinnen und Experten sowie von großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit wirtschaftlich so stark gemacht. Es kann vermutet werden, dass dabei für viele Deutsche die Entwicklungen in der früheren Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eine Rolle spielen. Die DDR war, wie andere früher kommunistische Staaten in Osteuropa, der Bundesrepublik in der Technologieentwicklung weit unterlegen. Dafür wurde unter anderem das planwirtschaftliche Modell unter autoritärer kommunistischer Führung verantwortlich gemacht. Der chinesische Privatsektor – speziell die großen Firmen wie Alibaba, Baidu, BYD, Bytedance, JD, Haier, NetEase und Tencent – spielt in den Augen von Expertinnen und Experten und in der deutschen Öffentlichkeit, speziell in den jüngeren Generationen, eine bedeutende Rolle für Innovation, Technologieentwicklung und Wirtschaftswachstum in China.
4 China als globaler politischer Akteur
Präsident Xi Jinping hat seit Beginn seiner Übernahme des Parteivorsitzes im Oktober 2012 in vielen Reden die Zukunftsgemeinschaft der Menschheit von Staaten und Kulturen als wichtiges Leitkonzept für Chinas Handeln in internationalen Beziehungen betont: „to build a community of shared future for mankind“ (rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ).
Chinesische Diplomatinnen und Diplomaten haben sich wiederholt auf dieses Konzept bezogen, um zu betonen, dass Chinas weltpolitischer Aufstieg keine Bedrohung für andere Nationen und für die globale Ordnung bedeute, sondern dass es darum ginge, gemeinsam Verantwortung für Frieden, wirtschaftliche Entwicklung und den Schutz des Planeten zu übernehmen. Nur multilateral könnten diese Herausforderungen bewältigt werden. Im März 2018 wurde die Verfassung mit einem Satz ergänzt, der sich auf dieses Konzept bezieht.
Das verstärkte Engagement Chinas in den Vereinten Nationen (UN), seine permanente Mitgliedschaft im Sicherheitsrat, seine Unterstützung für UN-Institutionen und -Initiativen und die Bereitstellung von Peacekeeping-Truppen sind Beispiele für Chinas weltpolitisches Engagement. Friedenssicherungsbeiträge sind inzwischen ein wichtiger Bestandteil von Chinas Soft-Power-Strategie im Kontext seines „friedlichen Aufstiegs“ („peaceful rise“) in der Weltpolitik. Seit den Jahren 2003 und 2004 leistet China steigende Beiträge zu Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Die Truppenentsendungen haben sich signifikant erhöht (Institute for Security & Development Policy 2018). Durch sein Engagement im Rahmen der UN-Friedenssicherung versucht Peking Befürchtungen entgegenzutreten, dass sein wachsender Einfluss eine politische Bedrohung für andere Staaten und Regierungen darstellen könnte.
Auch Chinas Beiträge zu wissenschaftlichen Erkenntnissen sind herausragend. China hat nach Angaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 2019 erstmals die USA bei der Zahl der Patentanmeldungen überholt (dpa 2020). China produziert inzwischen mehr wissenschaftliche Fachartikel als die USA. Gemeinsam liegen allerdings die EU-Staaten mit Großbritannien vor China und den USA. Während in den USA überdurchschnittlich viele der Artikel aus den Bio-, Medizin- oder Naturwissenschaften stammen, ist China in den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Chemie häufiger vertreten als andere Staaten. Das geht aus Zahlen zu den Entwicklungen der weltweiten Publikationen in Wissenschaft und Technik hervor, die die National Science Foundation der USA vorgelegt hat (Krapp 2019). In indischen Publikationen sind Computerwissenschaften demnach überdurchschnittlich stark vertreten. In der Forschung gehört China mittlerweile zu Deutschlands wichtigsten Partnern. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland war es 2015 nach den USA das beliebteste Zielland – allerdings mit einem großen Abstand von 2643 zu 704 Wissenschaftlern (Stepan et al. 2018). Die top-ausgestatteten Forschungslabore und die Anzahl der hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in China haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die führenden Universitäten Chinas sind zwar weiterhin nicht unter den ersten 15 platzierten Universitäten weltweiter Rankings, haben jedoch beträchtlich aufgeholt, speziell die Tsinghua, die Peking Universität und die Zhejiang Universität. China ist im Rahmen von Forschungsvorhaben und internationalen Konferenzen in relevante Forschungsfelder involviert. Die Coronakrise hat die Arbeiten der Virologin Shi Zhengli weltweit bekannt gemacht.
Zu den exponierten Forschungsfeldern an chinesischen Universitäten und Instituten gehören inzwischen auch der Klimawandel und eine Nachhaltigkeit- und Klimaschutzpolitik. Die Peking Universität ist beispielsweise eine der strategischen Partneruniversitäten der Freien Universität Berlin im Rahmen der „University Alliance for Sustainability“, die Nachhaltigkeit in Forschung, Lehre und Campus-Management zum Thema gemeinsamen Austausches und von Zusammenarbeit macht.
Übergeordnet könnte man Chinas Bekenntnis zum Multilateralismus als Ausgangspunkt für eine offene Perspektive zur Lösung von globalen Problemen ansehen. China ist in den internationalen Austausch von Waren, Dienstleistungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen inzwischen tief integriert. Mit dem Beitritt zur WTO begann China viele umfangreiche gesetzliche Reformen und hat diese inzwischen zum großen Teil vollzogen. Im Kontext des Handelskonflikts mit den USA betont China auch weiterhin sein Bekenntnis zum Multilateralismus und zum weitgehend freien Handel von Waren.
Chinas aktive Rolle in den UN untermauert dessen Bekenntnis zur Stärkung von Global Governance. Allerdings provoziert dies die USA und zum Teil auch europäische Staaten, die ihren eigenen Einfluss zurückgedrängt sehen. Die Kritik der USA an der angeblichen Abhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von China trieb die kritische Auseinandersetzung auf die Spitze und führte zum Stopp von Zahlungen der USA an die WHO (ARD 2020). Russlands Einmarsch in die Ukraine hat das Verhältnis Chinas zu den USA und zur EU weiter belastet, weil China sich dem westlichen Sanktionsregime ggü. Russland nicht angeschlossen hat, sondern den Handel mit Russland eher noch intensiviert hat. In Deutschland haben einige Akteure, auch in der Bundesregierung, die Sorge, dass China die Einheit mit Taiwan, die von Deutschland offiziell anerkannt wird, durch eine militärische Intervention vertiefen wird und es demzufolge zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit Beteiligung der USA kommen könnte.
Im Rahmen der Gruppe der Zwanzig (G20), der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, spielt China eine aktive Rolle. Der G20-Gipfel in Hangzhou 2016 trug wesentlich zur Aufwertung der Gruppe bei. In Hangzhou brachte China das Thema Sustainable Finance voran, das inzwischen einen großen Schub erfahren hat, speziell auch auf EU-Ebene. Über sein Engagement in bestehenden internationalen Organisationen und Gruppierungen hinaus hat China allerdings auch regionale und selektive Organisationen gegründet oder ist diesen beigetreten, darunter die Asiatische Infrastruktur- und Investitionsbank, die BRICS-Vereinigung und die Shanghai Cooperation Organisation. Insgesamt ist Chinas Engagement in der multilateralen Zusammenarbeit weiterhin hoch und ohne Anzeichen eines Rückzugs aus bestimmten Staaten oder Regionen.
China verfolgt somit eine zweigleisige Strategie: Einerseits engagiert es sich in bestehenden internationalen Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank, andererseits übernimmt es die (Mit-)Gründung neuer Organisationen und Initiativen, in denen es eine Führungsrolle innehat. Dazu gehört vor allem die Idee einer massiven Infrastrukturinitiative entlang der historischen Seidenstraße und anderer Handelsrouten. Die „One Belt, One Road Initiative“ (mittlerweile umbenannt in „Belt and Road Initiative“, BRI), die neue Seidenstraßeninitiative, wurde im Herbst 2013 in zwei Reden von Präsident Xi Jinping lanciert und gilt inzwischen als das bisher weltweit größte Investitions- und Infrastrukturinitiative, noch vor dem Marschallplan zum Wiederaufbau Europas. Schätzungen reichen von einer Billion bis hin zu acht Billionen US-Dollar (Hillmann 2018). Die Initiative ist regional, sektoral und auch finanziell nur ungefähr umrissen, umfasst sechs Korridore und Projektvorhaben in über siebzig Staaten.
Es ist jedoch wichtig, festzustellen, dass die neue Seidenstraßeninitiative weltweit nicht nur positive Resonanz findet. Auf dem Seidenstraßen-Gipfel in Peking 2019, zu dem 37 Staats- und Regierungschefs und insgesamt 5000 Vertreter aus mehr als 100 Staaten kamen (ARD 2019), entschieden sich Deutschland, Frankreich, Großbritannien und andere Länder dagegen, eine Erklärung zur Neuen Seidenstraße zu unterzeichnen. Zu groß waren die Bedenken, dass verbindliche Handelsregeln, faire Ausschreibungen und Transparenz auf der Strecke bleiben. Vor allem in den USA und Westeuropa bilden sich Widerstände gegen Chinas große außen- und entwicklungspolitische Initiative, obwohl einige Regionen, in Deutschland speziell die Stadt Duisburg und das Ruhrgebiet, davon wirtschaftliche profitieren. Italien sich dem Projekt als einziges G7-Land angeschlossen. Mit zahlreichen anderen Staaten ist China allerdings ein Abkommen gelungen: 142 Staaten unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (Green Belt und Road Initiative Centre 2022).
Die Seidenstraßeninitiative steht in Deutschland auch deshalb in der Kritik, weil vermutet wird, dass Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes bei chinesischen Investitionsvorhaben im Ausland, speziell in Zentralasien, hintenanstehen. China geht dieses Thema inzwischen offensiver an. Es steht dabei zunehmend unter Beobachtung von internationalen und nationalen Organisationen. Mehrere UN-Organisationen haben mit China Abkommen in Bezug auf die Seidenstraßeninitiative unterzeichnet, die darauf abzielen, Synergien zwischen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Seidenstraßeninitiative zu schaffen. China Präsident Xi Jinping erklärte in einer Rede bei den Vereinten Nationen im September 2021, dass China keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen wird (Bauchmüller und Giesen 2021). Unbestritten bleibt, dass sich China in der globalen Nachhaltigkeits- und Klimapolitik in den letzten Jahren stark engagiert hat.
5 Chinas Rolle in der globalen Nachhaltigkeits- und Klimapolitik
China spielte bei der Verabschiedung der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung im September 2015 sowie beim Pariser Klimaschutzabkommen im Dezember 2015 eine konstruktive Rolle, indem es als Mittler zwischen den Interessen der Industrie- und der Entwicklungsländer agierte (Kuhn 2018). China ist seinen Ankündigungen und Verpflichtungen im Rahmen internationaler Klimaschutzabkommen bisher nachgekommen beziehungsweise hat diese übererfüllt (Fahrion 2019; Finamore 2018). Bereits im Jahr 2015 hat China eine Taxonomie für sogenannte grüne Geldanleihen (Green Bonds) vorgelegt (GFC 2015). Allerdings steht es nach dem Gipfeltreffen der Conference of the Parties (COP) in Sharm-el-Sheikh in Ägypten nun wieder in der Kritik westlicher Industriestaaten und einzelner Entwicklungsländer, die eine größere finanzielle Beteiligung Chinas an Zahlungen für klimabedingte Schäden in den ärmsten Ländern fordern.
China bezeichnet sich selbst als Staat, der verschiedene Entwicklungsniveaus vereint, vom Entwicklungsland in den Westprovinzen bis zum relativ weit entwickelten Land an der Ostküste. Im Rahmen seines Engagements in der Gruppe der 77 hielt China in Bezug auf die Anpassungsleistungen und Lastenverteilung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern beim Thema Klimaschutz stets das Prinzip der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“ („common but differentiated responsibilities“) hoch. Dennoch war China bereit, bei den Klimaschutzverhandlungen auf internationaler Ebene, speziell in Paris im Dezember 2015, Verpflichtungen zum Klimaschutz einzugehen, wozu die Entwicklungsländer lange nicht bereit waren. Chinas Erfolge bei der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, seine steigende Wirtschaftskraft und die hohen CO2-Emissionen gaben mit den Ausschlag, sich den Forderungen der Industrienationen nicht ganz zu verschließen.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und darauf bezogene Diskurse (Kuhn 2016) erfahren in China ebenso wie die Klimapolitik eine große Aufmerksamkeit. Seit dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping im Jahr 2013 werden die nationalen Diskurse allerdings zunehmend vom Konzept der Ökologischen Zivilisation (Kuhn 2019a) dominiert. Einige sehen das Konzept mit seinen historisch aufgeladenen Verweisen auf die chinesische Philosophie als ein Gegenkonzept zu liberaler Umwelt- und Klimapolitik an. Diese ist in China jedoch facettenreicher, als es orthodoxe Meinungen der Politikgestaltung nahelegen. Die Umsetzung des Konzepts der „ökologischen Zivilisation“ bezieht eine Vielzahl von staatlichen, marktwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren mit ein. Das Konzept wurde im März 2018 in der chinesischen Verfassung verankert und dient als chinesische Vision für eine nachhaltige Entwicklung. Es grenzt sich kaum von internationalen Nachhaltigkeitskonzepten ab, die China ebenso unterstützt, etwa die 2030 Agenda für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Das Konzept der „ökologischen Zivilisation“ betont allerdings spezifische chinesische Charakteristika. Dazu gehören chinesische philosophische und zivilisatorische Traditionen ebenso wie die führende Rolle der kommunistischen Partei bei einer transformativen Nachhaltigkeitspolitik.
6 Ausblick
Wir können beobachten, wie außen- und sicherheitspolitische Diskurse die Perspektiven der Zusammenarbeit der EU mit China beeinträchtigen. In diesem Kontext sind explizite Strategien zum Umgang mit China, wie sie im Auswärtigen Amt und im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erarbeitet werden, nicht unbedingt zielführend, auch wenn grundsätzlich eine gut informierte Reflektion zur Zusammenarbeit mit China geboten ist. Explizite deutsche China-Strategien, die die Zusammenarbeit mit China erschweren, könnten die unterschiedlichen Auffassungen zum Umgang mit China zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland weiter akzentuieren. Daraus könnten dann möglicherweise Strategien großer deutscher Unternehmen folgen, die nicht im Interesse des deutschen Staats sein können. In der Gesamtschau eines komplexen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungsgeflechts ist davon auszugehen, dass die chinesische Regierung und vor allem auch führende chinesische Banken und Unternehmen tendenziell weiter eine vertiefte internationale Zusammenarbeit anstreben, speziell mit Europa. Ein führender chinesischer Think Tank, das CCG, wirbt für eine solche Politik der weiteren Vertiefung der Globalisierung. Auch deutsche Unternehmen, darunter auch einige DAX-Konzerne, investieren weiter beträchtliche Summen in China. Chinesische Zulieferer sind nicht so einfach zu ersetzen, wie es politisch zuweilen gefordert wird. Der wirtschaftliche Preis wäre sehr hoch und würde die Wettbewerbsfähigkeit vieler deutscher Unternehmen beeinträchtigen, Die Alternativen zu China wären politisch zudem oft auch heikel. China hat bereits in vielen Bereichen, die die multilaterale Zusammenarbeit betreffen, großes Engagement gezeigt. Hier sind besonders Ziele, Konzepte und Projekte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des Klimaschutzes, Beiträge zur Armutsbekämpfung in China und weltweit, die Teilnahme an UN-Friedensmissionen, vertiefte Kooperationen in der Wissenschaft und ein festes Bekenntnis zum Multilateralismus zu betonen. Allerdings ist auch davon auszugehen, dass die Reden Xi Jinpings und das erstarkte kulturelle Selbstbewusstsein Chinas die nationalen Diskurse in den nächsten Jahren weiter und vermutlich noch stärker prägen werden. Im Rahmen des Konzepts der „Community of Mankind with a Shared Future“ bedeuten diese zwar einerseits eine fortgesetzte Hinwendung zum Multilateralismus, andererseits sind sie von spezifisch chinesischen Interpretationen und Interessen beeinflusst, die in liberal geprägten Gesellschaften zu Widerspruch und Widerstand führen werden. Dieses Dilemma zu erkennen, bedeutet, dass wir Formen des Dialogs und der politischen Auseinandersetzung suchen und finden sollten, die sich der Komplexität bewusst sind, die Chinas Aufstieg für die Welt bedeutet. Auch wenn Aushandlungsprozesse mit China schwierig sind, kann eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit entscheidend mitwirken, gemeinsame Interessen zu stärken. Sie sollte daher nicht zu leichtfertig politischen oder ideologischen Differenzen geopfert werden.
Notes
- 1.
Für eine Analyse der China-Berichterstattung in den deutschen Medien siehe: Jia, Leutner und Xiao 2021.
- 2.
Der vermutlich bekannteste zeitgenössische chinesische Künstler Ai Weiwei hat Deutschland im Jahr 2019 zunächst jedoch Richtung Großbritannien verlassen, nicht ohne eine persönliche Abrechnung mit der Berlinale und der deutschen Gesellschaft vorzunehmen (Peitz und Kuhn 2019). Ai Weiwei lebt heute überwiegend in Portugal.
- 3.
In Berlin fördert zum Beispiel die Akademie für Künste ASK Berlin die Integration junger Musikerinnen und Musiker.
- 4.
Berechnungsgrundlage für das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt (Purchasing Power Parity – PPP) ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Danach hat China die USA etwa im Jahr 2015 als größte Volkswirtschaft überholt.
Literatur
Alpermann, Björn, und F. Thünken 2018. Technologie gegen den Werteverfall? Chinas „soziales Bonitätssystem“ im Kontext der Modernisierung. Forschung & Lehre 6: 474–476.
Amann, Melanie. 2010. Virtuosen aus Fernost. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/campus/musikstudium-virtuosen-aus-fernost-1966948.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
ARD. 2019. Gipfel zu „Neuer Seidenstraße“. Chinas Charmeoffensive. [Fernsehsendung]. tagesschau vom 26. April 2019.
ARD. 2020. USA stellen Zahlungen an WHO ein. 15. April 2020. https://www.tagesschau.de/ausland/trump-who-zahlungen-103.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
Bauchmüller, Michael, und C. Giesen. 2021. Klimapolitik. China stoppt den Bau von Kohlekraftwerken im Ausland. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/china-kohlekraftwerke-klimaschutz-1.5417980. Zugegriffen: 20. August 2022.
Blume, Georg. 2005. Die Schule der revolutionären Harmonie. Die Zeit 20.
Bundesverand der Deutschen Industrie (BDI). 2019. China – Partner and Systemic Competitor. https://english.bdi.eu/article/news/china-partner-and-systemic-competitor/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). 2021. China in der Welthandelsorganisation. https://bdi.eu/artikel/news/china-in-der-wto/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Coker, Christopher. 2018. The Rise of the Civilizational State. Cambridge: Polity Press.
Doll, Nikolaus, und G. Hegmann. 2018. Fall Kuka schürt Angst vor China. https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article184526304/Fall-Kuka-schuert-Angst-vor-China.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
dpa. 2020. China überholt die USA erstmals bei Zahl der Patentanmeldungen. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12381115-china-ueberholt-usa-erstmals-zahl-patentanmeldungen. Zugegriffen: 20. August 2022.
Elsner, Wolfram. 2020. Das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer eins ist anders! Frankfurt a.M.: Westend Verlag.
Emons, Oliver. 2013. Ausverkauf der Hidden Champions? https://www.boeckler.de/pdf/mbf_emons_china1.pdf. Zugegriffen: 20. August 2022.
European Commission. 2019. EU-China: A strategic outlook. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf. Zugegriffen: 15. Januar 2022.
Fahrion, Georg. 2019. „China stapelt oft tief und übertrifft sich dann selbst“. https://www.spiegel.de/politik/ausland/klimaschutz-china-stapelt-oft-tief-und-uebertrifft-sich-dann-selbst-a-1287623.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
Fahrion, Georg, et al. 2020. Corona-Virus. Made in China. Wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird. Der Spiegel 6/2020.
Finamore, Barbara. 2018. Will China Save the Planet? Cambridge: Polity Press.
Finke, Björn. 2020. Gleiche Chancen für alle. Süddeutsche Zeitung, 18. Juni.
Fukuyama, Francis. 2018. Identity. Comtemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. London: Profile Books.
GFC (Green Finance Community of China Society of Finance and Banking). 2015. China Green Bond Endorsed Project Catalogue (2015 Edition). http://www.greenfinance.org.cn/displaynews.php?cid=79&id=468. Zugegriffen: 20. August 2022.
Green Belt and Road Initiative Centre. 2022. Countries of the Belt and Road Initiative (BRI). https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri. Zugegriffen: 4. Januar 2022.
Groth, Sabine. 2019. Made in China 2025. China auf dem Weg zum High-Tech-Land. https://www.dasinvestment.com/made-in-china-2025-china-auf-dem-weg-zum-high-tech-land/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Hamilton, Clive, und M. Ohlberg. 2020. Die lautlose Eroberung: Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. München: Deutsche Verlags-Anstalt (DVA).
Hawkins, Amy, und J. Wasserstrom. 2019. Why 1984 Isn’t Banned in China. Censorship in the country is more complicated than many Westerners imagine. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/01/why-1984-and-animal-farm-arent-banned-china/580156/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Hillman, Jonathan. 2018. How Big Is China’s Belt and Road?.Centre for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/how-big-chinas-belt-and-road. Zugegriffen: 20. August 2022.
Huntington, Samuel. 1996. The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Institute for Security & Development Policy. 2018. China’s Role in UN Peacekeeping. https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Jia, Changbao, M. Leutner, und M. Xiao. 2021. Die China-Berichterstattung in deutschen Medien im Kontext der Corona-Krise. STUDIEN 12. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Studien_12-21_China-Berichterstattung_web.pdf. Zugegriffen: 20. August 2022.
Kafsack, Hendrik. 2019. „Systemischer Rivale“: Die EU schlägt neue Töne gegenüber China an. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/systemischer-rivale-die-eu-schlaegt-neue-toene-gegenueber-china-an-16096186.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
Körber-Stiftung. 2020. Transatlantische Partnerschaft verliert an Rückhalt: 36 Prozent der Deutschen finden enge Beziehungen zu China wichtiger als zu den USA. https://koerber-stiftung.de/presse/mitteilungen/transatlantische-partnerschaft-verliert-an-rueckhalt-36-prozent-der-deutschen-finden-enge-beziehungen-zu-china-wichtiger-als-zu/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Krapp, Claudia. 2019. EU Länder publizieren mehr als China und die USA. https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/eu-laender-publizieren-mehr-als-china-und-usa-1837/. Zugegriffen: 20. August 2022.
Kuhn, Berthold. 2014. „Against all Odds“. Chinas weltpolitischer Aufstieg aus dem Blickwinkel der westlichen Politikwissenschaft. WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik, Spezial 13.
Kuhn, Berthold. 2015. Policies, Collaboration and Partnerships for Climate Protection in China. In The Road to Collaborative Governance in China, Hrsg. Y. Jing, 71-94. New York: Palgrave Macmillan.
Kuhn, Berthold. 2016. Sustainable Development Discourses in the P.R. China. Journal of Sustainable Development, Vol. 9, No. 6: 158–167.
Kuhn, Berthold. 2017. Sustainable Development in the Context of the One Belt One Road Initiative. In The Belt and Road Initiative and Europe, Hrsg. P. Huang und C. Zhao, 68–77. Peking: Shishi Publishing House.
Kuhn, Berthold. 2018. China’s Commitment to the Sustainable Development Goals: An Analysis of Push and Pull Factors and Implementation Challenges. Chinese Political Science Review 3: 359–388.
Kuhn, Berthold. 2019a. China’s Rise and Chinese Values: China’s Growing Influence and Its Critics. Expert Comment. Berlin: Dialogue of Civilisations Research Institute.
Kuhn, Berthold. 2019b. Ecological Civilisation in China. Expert Comment. Berlin: Dialogue of Civilisations Research Institute.
Li, Jing. 2015. A climate for change: how China went from zero to hero in fight against global warming in just 6 years. South China Morning Post, 27. Nov.
Macrotrends. 2022. China GDP Growth Rate 1961–2022. https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/gdp-growth-rate. Zugegriffen: 15. Januar 2022.
Naß, Matthias. 2011. Kalter Krieg: Der Anfang einer neuen Zeit. Die Zeit 22.
Pabst, Adrian. 2019. China, Russia and the return of the civilisational state. https://www.newstatesman.com/2019/05/china-russia-and-return-civilisational-state. Zugegriffen: 20. August 2022.
Peitz, Christiane, und N. Kuhn. 2019. Ai Weiwei schimpft auf Deutschland – und die Berlinale. https://www.tagesspiegel.de/kultur/kuenstler-will-berlin-verlassen-ai-weiwei-schimpft-auf-deutschland-und-die-berlinale/24888682.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
Reich, Kersten, und Y. Wei. 1991. Konfuzius und die Bestimmung der chinesischen Lehr- und Lernmethoden - einige grundlagenkritische Überlegungen. http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/reich_works/aufsatze/reich_14.pdf. Zugegriffen: 20. August 2022.
Statistisches Bundesamt (Destatis). 2022. Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland (vorläufige Ergebnisse). 2021. Wiesbaden.
Stepan, Mattias, A. Frenzel, J. Ives, und M. Hoffmann. 2018. China kennen, China können. Berlin: Mercator Institut für China Studien (MERICS).
Wang, Huiyao. 2021. “Consultative Democracy” a Key Part of China’s Approach to Democracy. https://news.cgtn.com/news/2021-10-30/-Consultative-democracy-a-key-part-of-China-s-approach-to-democracy-14MvvaFdeaQ/index.html. Zugegriffen: 20. August 2022.
Weigelin-Schwiedrzik, Susanne. 2012. Chinas Aufstieg: Der geteilte Himmel. ZEIT Geschichte 1: 16–18.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Kuhn, B.M. (2023). China in der Welt aus deutscher Perspektive. In: Hu, C., Triebel, O., Zimmer, T. (eds) Im Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdverstehen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_4
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-40030-9
Online ISBN: 978-3-658-40031-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)