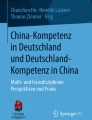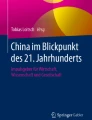Zusammenfassung
Konfuzius-Institute als staatliche chinesische Kultur- und Bildungsinstitutionen haben zwar einen allgemeinen Auftrag. Jedes Institut bestimmt jedoch durch die von seinen Partnerinstitutionen eingesetzten Gremien die eigenen individuellen Strategien, Schwerpunkte, Zielsetzungen und schließlich die Programmplanung. Dies geschieht in einem intensiven Austausch zwischen chinesischen und deutschen Mitarbeiter*innen. Der Beitrag schildert den Profilbildungsprozess des Leibniz-Konfuzius-Instituts Hannover und erläutert anhand konkreter Beispiele, wie kulturelle Bildung und Chinakompetenzvermittlung in einer deutsch-chinesischen Einrichtung erfolgt.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
Konfuzius-Institute sind offizielle chinesische Kultur- und Bildungsinstitutionen. Nach einer Umorganisation im Sommer 2020 auf chinesischer Seite liegt die Trägerschaft aller Konfuzius-Institute nun bei der Chinese International Education Foundation, die dem chinesischen Bildungsministerium untersteht und beim Ministerium für zivile Angelegenheiten registriert ist.
1 Konfuzius-Institute: allgemeine Ziele, Aufgaben und Organisation
Konfuzius-Institute sind Beispiele für chinesisch-internationale Kooperationen im Kultur- und Bildungsbereich. Auf verschiedenen Ebenen wird hier für ein gemeinsames Ziel zusammengearbeitet. Die Gründung eines Konfuzius-Instituts geht auf die gemeinsame Initiative einer chinesischen und einer ausländischen Hochschule zurück. Zumeist haben die beiden Hochschulen bereits länger bestehende Partnerschaften miteinander, die durch ein gemeinsam betriebenes Institut intensiviert werden sollen. Es wird eine Plattform für Sprach-, Wissens- und Kulturvermittlung und für den wissenschaftlichen Austausch geschaffen. Konfuzius-Institute stellen langfristig angelegte Kooperationen jenseits der fachwissenschaftlichen Zusammenarbeit dar.
Die strategische Ausrichtung, die Zielsetzung und die Programmplanung eines jeden Konfuzius-Instituts obliegt dem Board of Strategic Directors, einem von Repräsentant*innen beider Partnerhochschulen besetzten Gremium. Hier beginnt die persönliche Ebene der Zusammenarbeit, die dann in der praktischen Umsetzung zum alltäglichen Geschäft wird. Für die Verwaltungstätigkeit und die Organisation der einzelnen Programme ist das Direktorium verantwortlich. Die beiden Direktor*innen werden jeweils von ihren Hochschulen ernannt bzw. entsandt und leiten gemeinsam ein deutsch-chinesisches Team.
Die Zielsetzungen der Konfuzius-Institute sind sehr allgemein gefasst. Die seit 2020 für die Genehmigungen zur Einrichtung eines Konfuzius-Instituts zuständige Chinese International Education Foundation setzt die Ziele wie folgt: „(…) communicating Chinese, deepening international understanding of Chinese language and culture, and promoting people-to-people exchanges between China and the rest of the world.“Footnote 1 Die konkreten Zielsetzungen des einzelnen Instituts ergeben sich aus den lokalen Gegebenheiten, dem Bedarf der lokalen Hochschule und den Profilen und Interessen der jeweiligen Partnerinstitutionen. So hat jedes Institut zwar einen allgemeinen Auftrag der Sprach- und Kulturvermittlung. Die Profil- bzw. Schwerpunktbildung erfolgt jedoch individuell an jedem Institut durch die eigenen Gremien.
Konfuzius-Institute konzipieren Angebote zum Ausbau von Chinakompetenz, sowohl im Bereich der Sprachausbildung, der Kulturvermittlung und des persönlichen und akademischen Austauschs auf verschiedenen Ebenen. Es geht dabei nicht um die Vermittlung eines beschönigenden Chinabildes oder gar um Propaganda, wie es den Konfuzius-Instituten häufig vorgeworfen wird. Ziel ist eine möglichst umfassende Wissensvermittlung für ein heterogenes Publikum und unterschiedliche Zielgruppen.
2 Das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover
Gegenwärtig gibt es in Deutschland 19 Konfuzius-Institute, von denen 16 als „Hochschul-Joint-Ventures“ betrieben werden. Das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover (LKIH) wurde 2017 als gemeinsames Projekt der Leibniz Universität Hannover und der Tongji-Universität Shanghai gegründet. In der Programmplanung, Organisation und Profilbildung profitierte das LKIH besonders vom Input seiner deutschen Direktorin Prof. Dr. Steffi Robak, die als Professorin für Bildung im Erwachsenenalter den wissenschaftlichen Hintergrund für die Gestaltung und Strukturbildung einbrachte sowie die kommunikative Einbindung in die Leibniz Universität hinein absicherte. Dazu gehörten auch kultur- und bildungstheoretische Fundierungen bezüglich transkultureller Bildung und Kompetenzentwicklung (Robak et al. 2020) sowie Inputs bezüglich relevanter Themen für Forschung und Wissenschaftsaustausch, etwa im Rahmen von Tagungsplanungen.
Unter ihrer Anleitung entwickelte das deutsch-chinesische Direktorium das Leitbild, formulierte seine Mission und entwickelte konkrete Arbeitsweisen und Kriterien für die Programmgestaltung. Außerdem wurde auch die methodische Basis für die Programmangebote geschaffen. Das Ergebnis dieses intensiven gemeinsamen Profilbildungsprozesses waren klare Zielformulierungen und Arbeitsgrundlagen.
2.1 Leitbild, Programmgestaltung
Das Leitbild nennt die ethischen Prämissen, denen das Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover sich verpflichtet: Transparenz, Autonomie der Programmerstellung, Neutralität, Wissenschaftskommunikation und -austausch auf Augenhöhe. Als eine gemeinnützige Bildungs- und Kulturinstitution widmet es sich der bedarfsgerechten Vermittlung von Wissen zu China. Die Stärkung des bildungspolitischen, kulturellen und akademischen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen China und anderen Ländern ist das Ziel, ebenso die Unterstützung der Forschungskooperation mit chinesischen Partnern durch die Vermittlung von spezifischem Wissen und Chinakompetenzen.
In der Programmgestaltung steht die Balance von kultureller Bildung im Übergang zu transkultureller Kompetenzentwicklung im Zentrum. Dabei wird ein offener Kulturbegriff vertreten, der sowohl die Künste, die Geschichte, die Lebensweisen und Praktiken bis hin zu Werten, Normen, Erfahrungen und Interpretationsweisen von Kulturen einschließt. Aber nicht nur in der nach Außen gerichteten Programmgestaltung spielen dieses Kulturverständnis und die Wissensvermittlung als Grundlagen für die Fähigkeit zur gemeinsamen Ausgestaltung kultureller Praktiken eine wichtige Rolle. Auch intern in der eigenen täglichen Zusammenarbeit sind diese Leitlinien Grundlagen der transnationalen und -kulturellen Kooperation.
In der strategischen Planung des übergreifenden Programms wurden die verschiedenen Formate und Elemente des Angebotes drei Säulen zugeordnet, die unterschiedliche Zugänge zu China-relevantem Wissen symbolisieren. Die erste Säule ist das Fenster nach China. So, wie man die Außenwelt aus der sicheren und vertrauten Umgebung der eigenen Wohnung durch ein Fenster betrachten kann, werden hier niederschwellige Angebote gemacht, die einen Einblick und einen einfachen Einstieg in die chinesische Sprache und Kultur gewähren. Dazu gehören das Sprachkursprogramm, kulturelle Workshops und Events wie z. B. Veranstaltungen anlässlich des Frühlings- oder des Mondfestes, Konzerte oder Ausstellungen.
Die zweite Säule ist die Brücke nach China. Auf Brücken begegnen sich Menschen, die von zwei verschiedenen Ufern aufgebrochen sind. Man besucht sich gegenseitig, lernt sich kennen und tauscht sich aus. Angebote wie Tandemprogramme, Summer-/Wintercamps in China sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Studierende sowie interkulturelle Kompetenztrainings und Vorträge sind die Brückenbauer.
Die dritte Säule ist die Tür nach China. Durch die Tür betritt man einen anderen Raum, ein Haus oder bildlich gesehen eine andere Welt. Man gelangt mitten hinein in die neue Umgebung und setzt sich intensiv mit ihr auseinander. Es ist das Bild für Stipendienangebote, für China-Reisen und für den akademischen Austausch, der von Konferenzen, Lehrveranstaltungen zum Erwerb von China-Kompetenz und der Unterstützung gemeinsamer Forschungsprojekte belebt wird.
Besonderes Augenmerk wurde in der Profilgestaltung auf die konkrete Formulierung der Kriterien für die Programmplanung gelegt. Sie basiert auf den Prämissen Aktualität, Grundlagenwissen, Bedarfsspezifik und Adressatenspezifik. Die Kriterien fordern ein ausgeglichenes Verhältnis der Angebote der drei Säulen (Fenster, Brücke, Tür) untereinander. Potenzielle und bereits identifizierte Zielgruppen müssen mit entsprechenden Angeboten und adäquaten Veranstaltungsformen und -formaten wie z. B. Vorträge, Seminare, Unterricht, Exkursionen, Tagungen, etc. angesprochen werden. Zeiten und Orte müssen zielgruppengerichtet ausgewählt werden. Kreativität ist bei der Entwicklung innovativer Veranstaltungsformate gefordert. Das kann z. B. die Koppelung von Event- und Bildungsformaten sein, die Identifizierung und Beteiligung an besonderen Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit anderer Organisatoren, digitale Formate, Konzerte, Ausstellungen etc.
Wichtig ist auch die Auslegung des Begriffs China-Kompetenz und die entsprechende Orientierung in den Angeboten. Inhaltlich müssen die Angebote Aktualität und thematische Breite aufweisen. Behandelte Themen sollten gesellschaftliche Relevanz haben und von unterschiedlichen Perspektiven aus betrachtet werden. Es muss Raum für eine offene Diskurskultur gegeben werden, in dem Themen kritisch und reflektiert diskutiert werden können.
Die Vernetzungen und Kooperationen mit themenaffinen Partnern sollte zur Schaffung von Synergieeffekten verfolgt werden. Und natürlich muss eine Qualitätssicherung erfolgen, mit der transparenten Evaluierung von Veranstaltungen, Dozierenden und Lehr-/Lernmaterialien.
2.2 Arbeit in einem deutsch-chinesischen Team
Für die Umsetzung dieser Vorgaben und die Transformation in konkrete Angebote sind das Direktorium und das Team zuständig. Wie kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit in einem deutsch-chinesischen Team aussehen? Ein auf Vertrauen beruhendes Arbeitsklima muss sich entwickeln. Dabei ist es von Vorteil, wenn das Team längerfristig zusammenarbeiten kann. An Konfuzius-Instituten ist dies allerdings nicht immer gegeben, da sowohl Lehrkräfte als auch chinesische Direktor*innen nach wenigen Jahren an ihre entsendenden Hochschulen zurückkehren. Besonders für die Direktor*innen, die zumeist Professuren bekleiden, kann eine zu lange Abwesenheit Nachteile für ihre akademische Karriere bedeuten. Eine glückliche Konstellation am Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover erlaubt es, dass ein Kernteam schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten kann. Hier ist – sicher auch aufgrund der gut miteinander harmonisierenden Persönlichkeiten – ein freundschaftliches Arbeitsumfeld gewachsen, in das auch entsendete Kräfte problemlos integriert werden konnten. Man hatte über die Jahre Gelegenheit, einander zu beweisen, dass jeder mit einer hohen Arbeitsmoral ausgestattet ist, und das Wohl und erfolgreiche Agieren des Instituts im Fokus hat. Vor allem aber ist man mit Spaß und Vergnügen bei der Sache. Die gemeinsame Freude über eine gute, kreative Idee oder eine gelungene Veranstaltung ist eine hervorragende Teambuilding-Maßnahme.
Persönliches Engagement, Vertrauen und Verlässlichkeit sind die Grundpfeiler jeder gut funktionierenden Zusammenarbeit. Diese Erkenntnis gilt aber nicht nur für chinesisch-deutsche Teams, sondern sind auf alle möglichen Konstellationen anwendbar. Die Grundlagen für erfolgreiches, kollegiales Zusammenwirken mit Spaß an der Arbeit und zufriedenen Mitarbeiter*innen unterscheiden sich zwischen Deutschland und China nicht. Insofern sollte man nicht so sehr den binationalen Charakter – und damit die Unterschiede – betonen, sondern vielmehr die übergreifenden, verbindenden Faktoren, die zwischenmenschliche Beziehungen universell angenehm machen.
Das kommt auch dem gemeinsamen Ziel zugute. Bezogen auf die Arbeit am LKIH bedeutet das: Eine sinnvolle Programmplanung und Umsetzung mit dem Ziel einer effektiven China-bezogenen Wissensvermittlung ist nur im deutsch-chinesischen Austausch möglich, im Zusammenbringen von spezifischen Kenntnissen zu Zielgruppen, Bedarfen, Lernkulturen, gesellschaftlichen und juristischen Normen und Regelungen einerseits und von inhaltlichen Kompetenzen, Vernetzungen und finanziellen und intellektuellen Ressourcen andererseits. Das Aufeinanderbeziehen eigener kreativer Ideen und spezifischer ästhetischer Empfindungen sowie das Zusammenspiel unterschiedlicher Blickwinkel machen erst die Attraktivität des Gesamtprogramms aus. Ein Beitrag zu mehr China-Kompetenz ist somit nicht nur das Ergebnis der Planung, also ein Angebot, um Wissen über China erwerben zu können. Auch der Arbeitsprozess ist für die Akteure ein beständiges und bereicherndes von- und miteinander Lernen.
3 Fallbeispiele
An einigen Beispielen sei hier die zielgruppenspezifische Programmplanung und Angebotserstellung des LKIH erläutert.
3.1 Sprache und Kultur: Chinesischkurse und Kulturveranstaltungen
Die Säule „Fenster nach China“ symbolisiert den Bereich „Sprache und Kultur“. Der Chinesischunterricht an den Konfuzius-Instituten ist auf die HSK-Prüfungen, die offiziellen Prüfungen zur Feststellung der Chinesischkenntnisse, ausgerichtet. Dadurch sind die Zielsetzungen und Standards, aber auch Organisation und Konzeption weitestgehend konstant. Weiterentwickelt wird besonders das Unterrichtsmaterial und die Fortbildung der Lehrkräfte. Durch den Input der von den Partnerinstitutionen entsandten Lehrkräfte, die eine akademische Ausbildung im Bereich Chinesisch als Fremdsprache haben, werden die didaktischen Methoden mit modernen Elementen der Sprachvermittlung regelmäßig aufgefrischt.
Die Planung des kulturellen Programms ist vielschichtiger. Es gilt eine harmonische Balance zwischen traditionellen und modernen Kulturelementen zu finden, kreative Formate zu entwickeln und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Darin müssen natürlich identitätsrelevante Elemente wie Tee-Zeremonie, Taiji/Qigong, Kalligrafie oder traditionelle Musik einen Platz haben. Das wird auch vom Publikum verlangt. Dabei ist aber Vorsicht geboten, da die Gefahr besteht, selbst Klischees zu bedienen. Daher sollten diese traditionellen Kulturelemente nicht nur um ihrer selbst willen dargestellte werden, sondern als authentischer Teil der chinesischen Gesellschaft, als gelebte Tradition. Ein rein museales Element hat nur dann eine Berechtigung, wenn es den Zugang zur Beschäftigung mit China erleichtert. Mit etwas Bekanntem kann die Schwelle zum Unbekannten gesenkt werden. Am Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover wurden diese Faktoren als „Aha“- und „Oh“- Effekte bezeichnet: Den „Aha“-Effekt erreicht man, wenn dem Publikum etwas vage Bekanntes präsentiert wird, dieses vorhandene (Teil-)Wissen aufgegriffen und in einen größeren Kontext gestellt wird. Der „Oh“-Effekt gibt das Staunen der Teilnehmer*innen wieder, wenn neue, unerwartete Informationen vermittelt werden.
Tatsächlich stellt man auch fest, dass Angebote aus dem traditionellen Segment besser angenommen werden, als Veranstaltungen mit modernen Elementen. Die Besucherzahlen bei einer Kun-Oper oder einer Show mit traditionellen Liedern und Tänzen lagen zwischen 200 und 400, während sich zu den Rockkonzerten junger chinesischer Bands nur einige Dutzend einfanden. Das mag zum einen an den Altersgruppen liegen, die bestimmte Kategorien bevorzugen und dann auch tatsächlich diese Veranstaltungen besuchen. Es hat aber auch damit zu tun, dass noch ein Weg gefunden werden muss, eine (emotionale) Verbindung zur chinesischen Gegenwartskultur herzustellen. Auch das ist die Aufgabe eines Konfuzius-Instituts.
3.2 Austausch und Begegnung: Summer-/Wintercamps in China
Die Säule „Brücke nach China“ wird durch den Bereich „Austausch und Begegnung“ repräsentiert. Ein wichtiger Programmpunkt hier sind die Summer- bzw. Wintercamps für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende.
Schon seit 2009 organisierte das Konfuzius-Institut Hannover als federführendes Institut in Zusammenarbeit mit anderen Konfuzius-Instituten in Deutschland und mit chinesischen Partnern (Hauptpartner waren die Bildungsministerien der Provinzen Anhui und Shandong und die Tongji-Universität Shanghai) jährlich das zweiwöchige „Chinese-Bridge Summercamp für Schülerinnen und Schüler aus Deutschland“. Nachdem im Jahr 2017 die Partnerschaft mit der Leibniz Universität Hannover eingegangen worden war, wurden auch regelmäßig Summer- bzw. Wintercamps für Universitätsstudierende an der Tongji-Universität organisiert. Hier nahmen auch Studierenden der anderen Partner-Konfuzius-Institute der Tongji-Universität aus Korea, Japan und Italien teil. Das förderte auch den internationalen Austausch zwischen Nachwuchsakademiker*innen, erweiterte ihre Horizonte und entwickelte ihre interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten. Das sollte auch der Vertiefung des Verständnisses für die kulturelle Vielfalt und die historische Entwicklung verschiedener Länder und Gesellschaften dienen sowie der Motivation, den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu begegnen.
Neben Sprachkursen, Besichtigungsprogrammen und Messe- und Unternehmensbesuchen bieten die China-Camps den Teilnehmenden auch die Möglichkeit, mit chinesischen Wissenschaftler*innen über Fachthemen zu diskutieren, sich auszutauschen und zu vertiefen. Die Vorträge konzentrieren sich auf die Besonderheiten verschiedener Bereiche der chinesischen Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Technologie und der deutsch-chinesischen Beziehungen sowie auf die Analyse und Reflexion dieser Besonderheiten und der aktuellen Weltlage. Die Diskussionsrunden bieten den Studierenden Chancen zum Dialog mit Professor*innen, um das Verständnis von aktuellen Entwicklungsthemen bzw. -herausforderungen Chinas wie Digitalisierung und Innovation oder inklusives Wachstum auszubauen.
Die Summercamps für deutsche Schüler*innen bieten außerdem die Möglichkeit, sich persönlich mit gleichaltrigen chinesischen Jugendlichen zu treffen. Schüler*innen der gleichen Altersgruppe bilden Partnerschaften und organisieren individuell ihre außerschulischen Aktivitäten zusammen. Dazu gehören auch Besuche chinesischer Familien und die Teilnahme an Familienaktivitäten, um etwas über das alltägliche Leben in China zu erfahren.
Die zweiwöchigen Summer- bzw. Wintercamps soll den Teilnehmer*innen die Möglichkeit geben, verschiedene Aspekte von Sprache, Kultur und Gesellschaft hautnah zu erfahren und zu reflektieren. Das Programm ist so konzipiert, dass Städte unterschiedlicher Größe und Struktur kennengelernt werden können, z. B. Metropolen wie Peking und Shanghai und Provinzstädte wie Hefei, Qingdao, Xi‘an, Suzhou oder Hangzhou. In Zukunft sollen auch mittelgroße Städte sowie ländliche Projekte einbezogen werden.
Rückmeldungen aus Gesprächen mit Betreuer*innen, Schüler*innen und Studierenden, die an den Camps teilgenommen haben, bewerteten das Programm im Allgemeinen positiv. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass sie durch ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen in der Lage waren, die verschiedene Seiten der Entwicklung Chinas, die Komplexität und Vielfalt der chinesischen Gesellschaft zu erfahren und ihre China-Kompetenz zu erhöhen. Aus Sicht der Organisatoren sollten diese allgemeinen Camps in Zukunft durch themenspezifische Camps ergänzt werden. Hier muss auf Themen fokussiert werden, die für chinesische und deutsche Studierende von gemeinsamem Interesse sind, zum Beispiel der gesellschaftliche Wandel durch die Digitalisierung, Jugendliche und der Einfluss von Social Media, die Interaktion zwischen Stadt und Land, kulturelles Erbe zur Förderung individueller Lebenswerte und kultureller Identität etc. Um eine nachhaltigere Wirkung zu erzielen, wird auch über die Einrichtung eines dauerhaften (virtuellen) Campus nachgedacht, auf dem ein ständiger Austausch und Aktualisierung der Themen auch über die kurze Zeit der Camps hinaus möglich wäre.
3.3 Wissenschaft und Lehre: Konferenzen und Studienbescheinigung China-Kompetenz
Die Säule „Tür nach China“ umfasst den Bereich „Wissenschaft und Lehre“. Die Gründung des Leibniz-Konfuzius-Institutes und die Partnerschaft mit der Leibniz Universität Hannover ermöglicht die systematische und spezifische Weiterentwicklung von Themen und Feldern der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Partneruniversität Tongji in Shanghai für die Bereiche Forschung, Wissenschaftsaustausch und Lehre.
Im November 2017 wurden in einem Workshop mit Professor*innen der Leibniz Universität, die bereits in Forschungsprojekten mit chinesischen Partnern zusammenarbeiteten, Themencluster entwickelt, die zukünftig von Interesse für die gemeinsame Forschung zwischen Deutschland und China sein würden: „Digitalisierung“, „Kultur, Bildung, Zivilgesellschaft“, „Transnationale Innovation“ und „Resiliente Infrastruktur“. Ausgehend von globalen gesellschaftlichen Transformationsprozessen, die sowohl in China als auch in Deutschland wirksam werden, entstanden neuartige Thematiken, die in beiden Ländern in spezifischer Weise wissenschaftlich beforscht und analysiert werden. Um diese Transformationen und ausgewählte interdisziplinäre Forschungszugänge exemplarisch auszuloten, fand im November 2018 eine internationale Fachtagung an der Leibniz Universität Hannover statt. Anliegen war es, in den vier während der Workshops erarbeiteten Clustern Ausschnitte der innovationsfähigen und transkulturellen Forschung zu zeigen und somit die breite Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland auf verschiedenen Ebenen abzubilden.
Der Titel der Tagung lautete: „Interdisziplinäre Zugänge zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit China-Deutschland in transkultureller Perspektive“. Die ersten drei Cluster nahmen dabei die oben genannten Transformationsprozesse als Perspektive in den Blick und beschäftigten sich mit aktuellen Themenfeldern, die Vermittlung und Austausch zum Ziel haben und gleichzeitig Gemeinsamkeiten in der Forschung aufzeigten. Eine explizit komparative Perspektive wurde in Cluster 4 eingenommen. Die Cluster waren so strukturiert, dass jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Leibniz Universität Hannover und der Tongji-Universität sowie darüber hinaus zu Wort kamen. Das vorrangige Ziel der Tagung war, den Austausch der Wissenschaftler*innen untereinander zu fördern und Perspektiven für weitere (interdisziplinäre) Kooperationen zu eröffnen.
Diese Konferenz kann auch als Fortsetzung der internationalen Tagung „China-Kompetenz in Deutschland und Deutschland-Kompetenz in China: Multi- und transdisziplinäre Perspektiven und Praxis“, die im Dezember 2017 an der Tongji-Universität in Shanghai stattfand, verstanden werden. 2020 erschien der Tagungsband unter dem Titel Forschungszusammenarbeit China-Deutschland: Interdisziplinäre Zugänge und transkulturelle Perspektiven. (Robak et al. 2020)
2018 organisierte das LKIH in Kooperation mit Institutionen der Leibniz Universität und der Tongji-Universität eine zweite internationale Konferenz, die sich auf das Cluster „Kultur-Bildung-Zivilgesellschaft“ konzentrierte: „Kulturerbe, Erinnerungskultur und kulturelle Bildung: China und Deutschland im transnationalen Vergleich“. Kulturelle und gesellschaftliche Transformationsprozesse kennzeichnen die deutsche und chinesische Gesellschaft und stellen diese vor die Herausforderung, neue soziale Wirklichkeiten und Identitätsbildungsprozesse in heterogenen und sich ausdifferenzierenden Gemeinschaften zu gestalten und auszuhandeln. Immer öfter wird im Prozess der Re-Definition sozialer Zugehörigkeiten und der Frage nach nationalstaatlichen Identitäten dabei auf das Konzept des kulturellen Erbes zurückgegriffen, welches oft als Bezugspunkt für eine einheitliche kulturelle Identität herangezogen wird. Die Bezugnahme auf kulturelles Erbe gestaltet sich jedoch in der Regel als ein ambivalenter Prozess und markiert daher einen zentralen Ausgangspunkt der kritischen Reflexion von Konstruktions- und Aushandlungsprozessen von kulturellem Erbe auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene. In der Hoffnung, Traditionen zu erhalten oder zu generieren in Form der Vergegenwärtigung kulturellen Erbes, eröffnen sich somit auch neue Problemhorizonte: Hierzu gehören die Exklusion von nicht der Definition eines bestimmten Kulturerbes entsprechenden Gruppen und Individuen, die in einer verbreitet auf ökonomische Nutzungsformen spezialisierten Gesellschaft häufig unhinterfragt hingenommen werden.
Die deutsch-chinesische Tagung dazu möchte diese Mechanismen reflektieren und eruieren, welche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nutzung und Vermittlung des Modells des kulturellen Erbes liegen und wie diese Aneignungsprozesse in China und Deutschland gestaltet werden. Darüber hinaus erfolgt eine kritische Evaluation der Chancen und Potenziale, aber auch der Risiken und Probleme, die mit der Implementierung in Institutionen und der politischen Instrumentalisierung des Begriffs verbunden sind.
In Zusammenhang mit der Gründung des LKIH hat das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur Mittel für den Auf- und Ausbau der China-Kompetenz an der Leibniz Universität Hannover bereitgestellt. Mit dieser Förderung wurde an der LUH eine befristete halbe Stelle für die Konzeptentwicklung eingerichtet. Die neue Mitarbeiterin, die als Beauftragte für China-Kompetenz eingestellt wurde, erstellte eine Bedarfsanalyse, die ermitteln sollte, welches China-bezogene Wissen die Forschenden und leitenden Angestellten für die Studierenden als sinnvoll erachteten. (Stroth 2020) Diese Erschließung diente als Grundlage für eine an das spezifische Profil der LUH ausgerichtete Angebotserstellung. Die LUH setzt ihren Schwerpunkt auf die Ingenieurswissenschaften und versteht sich als eine technische Hochschule, gleichzeitig stellt die Philosophische Fakultät den größten Fachbereich dar. Es gibt keine China-bezogene Fachdisziplin, allerdings umfangreiche und teilweise langwährende Projektkooperationen mit chinesischen Hochschulen.
Das Ergebnis der Erschließung stellte einen Bedarf an chinesischen Sprachkenntnissen, an Soft-Skills und interkulturellen Kompetenzen (z. B. Kommunikationsmuster, Vorstellungen zu Zeitplanung) und an Allgemeinwissen über China sowie an konkreten Kenntnissen zum kulturellen Hintergrund, sozialen Strukturen, Lernkulturen sowie zur chinesischen Hochschullandschaft und zum Wissenschaftssystem fest. Darüber hinaus wünschte man sich Möglichkeiten für den direkten Austausch in Form von längerfristigen Auslandsaufenthalten. (Stroth 2020, S. 346–349)
Auf dieser Basis wurde als Angebot im Bereich Lehre die „Studienbescheinigung China-Kompetenz“ entwickelt, in der bereits bestehende Angebote integriert und neue konzipiert wurden. Seit dem Wintersemester 2019/20 haben Studierende aller Fachrichtungen in Bachelor- wie Masterstudiengängen die Möglichkeit, diese Studienbescheinigung als berufsrelevante Zusatzqualifikation zu erwerben. Sie umfasst die vier Module Sprachkurse, Ringvorlesung, Seminar und Praxismodul. Leistungen müssen binnen drei Semestern in drei der vier Module eingebracht werden, wobei der Besuch einer Ringvorlesung obligatorisch ist. Die Ringvorlesung wird im Rahmen des Gasthörendenstudiums der LUH angeboten und deckt damit auch einen externen Bedarf an wissenschaftlich aufbereiteten Informationen über China ab. Die hohen Anmeldezahlen in jedem Semester belegen das Interesse an China auch in der außeruniversitären Öffentlichkeit. Für die Vorträge wie auch für die Leitung des Seminars werden China-Expert*innen aus Deutschland und China eingeladen.
Das Modul des Spracherwerbs wird im Wesentlichen durch die Chinesischkurse des Leibniz Language Centres abgedeckt, die von Lehrkräften des LKIH geleitet werden. Diese können auch durch das LLC-Tandem-Programm erweitert werden, mit dem neben dem Praktizieren der erworbenen Sprachkenntnisse auch durch das gemeinsame Lernen Erfahrungen mit der jeweils anderen Lernkultur gemacht werden können.
Das Praxismodul wurde vor der Pandemie vor allem durch die zweiwöchigen Camps an der Tongji-Universität abgedeckt. Zwar bemüht sich die Tongji redlich, durch die Organisation von internationalen Online-Camps die Begegnung mit und den Austausch zwischen Chinesisch-Lernenden aus aller Welt aufrechtzuerhalten. Die Erfahrungen, China bei einer physischen Präsenz vor Ort mit allen Sinnen wahrnehmen zu können und mit Leuten von Angesicht zu Angesicht zu interagieren, kann so natürlich nicht ersetzt werden.
4 Fazit und Fragen für die Zukunft
Die Europäische Union hat in ihrer China-Strategie 2019 der Volksrepublik drei Rollen zugewiesen: Je nach Kontext kann das Land Partner, Konkurrent oder systemischer Rivale sein. (Europäische Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 2019, S. 1) Doch wo und wann und für wen nimmt es welche Rolle ein? Will man mit chinesischen Institutionen, Unternehmen oder auch Individuen lieber zusammenarbeiten, sie überbieten oder in die Schranken weisen? Und wer oder was bestimmt die Spielregeln sowohl im Miteinander als auch in der Auseinandersetzung? Auf der Basis einer Jahrzehnte langen Erfahrung in verschiedenen deutsch-chinesischen Kooperationen sei hier eine Lanze für das Miteinander gebrochen, für die Partnerschaft, in der beide Seiten gleichberechtigt die Spielregeln festsetzen. Gute Partnerschaften müssen wachsen. Das gegenseitige Vertrauen, die Gewissheit, dass beide Partner nicht nur das eigene Wohl, sondern auch die Befindlichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen des anderen berücksichtigen, muss sich etablieren. Auch Rückschläge, Kontroversen, Misserfolge und Meinungsverschiedenheiten können bei einem stabilen Vertrauensverhältnis überwunden werden. Die Basis dafür – das hat die Erfahrung gezeigt – ist ein gutes persönliches Verhältnis der Akteure, die die Partnerschaft tragen.
Konfuzius-Institute müssen sich in Zukunft als innovative Einrichtung der gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Hochschulen positionieren. Angesichts gegenwärtiger Kontroversen wollen sie die Positionen und Perspektiven beider Seiten vermitteln und eine bessere Rolle als Plattform spielen. Und sie wollen in einem komplexen Konglomerat von unterschiedlichen Ansprüchen ihre Eigenverantwortung und Individualität deutlich machen.
Die korrespondierende Autorin (KA) ist Lin Cai
Notes
- 1.
Siehe die Webseite der Chinese International Education Foundation: https://www.cief.org.cn/zjkzxy. Zugegriffen: 28. Februar 2022.
Literatur
Europäische Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. 2019. EU-China – Strategische Perspektiven. Straßburg.
Robak, Steffi, B. Zizek, C. Hu, und M. Stroth, Hrsg. 2020. Forschungszusammenarbeit China-Deutschland. Interdisziplinäre Zugänge und transkulturelle Perspektiven. Bielefeld: transkript.
Stroth, Maria. 2020. China-Kompetenz an der Leibniz Universität Hannover. Ergebnisbericht zur Bedarfserschließung. In Robak et al. 2020, S. 315–354.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Cai, L., Grieß, B. (2023). Schauen. Erfahren. Vertiefen. Vermittlung von China-Kompetenz an einer deutsch-chinesischen Kultur- und Bildungsinstitution. In: Hu, C., Triebel, O., Zimmer, T. (eds) Im Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdverstehen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_15
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-40031-6_15
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-40030-9
Online ISBN: 978-3-658-40031-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)