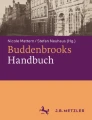Zusammenfassung
Die Literaturgeschichte wird von zwei Seiten aus bedrängt: Einerseits von einem methodologischen Nationalismus, der durch künstliche Grenzziehungen den Blick verengt und Nationalismen verstärkt und andererseits von einer grenzenlosen Weltliteratur, in der lokale Besonderheiten drohen, durch eine vorschnelle Internationalisierung der Literatur verloren zu gehen. Labels wie »österreichische«, »deutsche« oder »deutschsprachige Literatur« verhindern und ermöglichen zugleich die Beschreibung von Besonderheiten des literarischen Betriebs und in weiterer Folge von Texten. Der Beitrag präsentiert den literatursoziologischen Zugang der Feldtheorie Pierre Bourdieus als Lösungsvorschlag für dieses Dilemma. Gleichzeitig wird argumentiert, dass eigenständig wahrgenommene »Literaturen« immer erst Effekte literarischer Felder und der Durchsetzung spezifischer Wahrnehmungskategorien sind und nicht deren Ursache und gerade die Literaturwissenschaft hier nicht nur stille Beobachterin ist, sondern ganz im Gegenteil aktive Beteiligte bei der Konstruktion ihres eigenen Gegenstandes. Als Beispiel für die methodischen Vorschläge dient das österreichische literarische Feld nach dem Zweiten Weltkrieg, wodurch auch die mögliche Positionierung einzelner Akteur*innen in mehreren literarischen Feldern gleichzeitig in den Blick genommen werden kann.
Der Beitrag präsentiert vorläufige Forschungsergebnisse aus dem derzeit in Arbeit befindlichen Forschungsprojekt Das österreichische literarische Feld in der Nachkriegszeit. Neue Autonomie zwischen Kulturpolitik und österreichischer Identitätskonstruktion, dessen Gegenstand die Rekonstruktion des österreichischen literarischen Feldes zwischen 1945 und Mitte der 1970er Jahre sowie die Herausarbeitung der relevanten Feldgrenzen und »Feldeffekte« ist. Im Zuge der Beschäftigung mit dem Gegenstand der sogenannten »österreichischen Literatur« ist dabei die Notwendigkeit deutlich geworden, sich eingehender mit der Problematik der Literaturgeschichtsschreibung, ihrer Aktualität und der Konstruktion und Abgrenzung unterschiedlicher »Literaturen« voneinander auseinanderzusetzen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Vgl. für die problematische Debatte zu einer ‚österreichischen‘, ‚deutschen‘ oder ‚deutschsprachigen‘ Literatur die Ausführungen bei Verena Holler (2003) und zur künstlichen Schaffung des Nationalstaates sowie damit einhergehend einer einheitlichen ‚nationalen Kultur‘ aus feldtheoretischer Perspektive die Ausführungen bei Bourdieu (2017, S. 223–224 und S. 279).
- 2.
Für die Wechselwirkung zwischen dem literarischen Feld und nationalstaatlicher Politik bzw. dem »Feld der Macht« in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg vgl. die Ausführungen bei Leschanz (2022b).
- 3.
Denkbar ist freilich auch die Entstehung von literarischen Feldern ganzer Sprachräume. Ob sich diese in einem gewissen Zeitraum ausbilden ist jedoch im Einzelfall herauszuarbeiten, wie bei jedem Feld. Der Einwand der starken Einflüsse des Nationalstaates ist jedenfalls auch hier zu beachten, jedoch keinesfalls ein genereller Ausschlussgrund für Felder ganzer Sprachräume. Exemplarisch sei hier auf die Diskussion zu einem möglichen frankophonen Literaturraum verwiesen (Einfalt 2006, S. 175–196).
- 4.
Besonders deutlich wurde gerade erst unlängst durch die Corona-Krise vor Augen geführt, wie stark der Nationalstaat mit seinen Durchgriffsrechten nach wie vor auf die Lebensrealität der Akteur*innen wirken kann. Man denke nur an die völlig unterschiedlichen Maßnahmen zur Unterstützung von Künstler*innen in unterschiedlichen Ländern oder die unterschiedlichen Regeln für Aufführungen, Lesungen etc., ganz zu schweigen von den Reise- und Verkehrsbeschränkungen zwischen einzelnen Nationalstaaten.
- 5.
Bei der tatsächlichen forschungspraktischen Umsetzung dieser Einbettung des literarischen Feldes ins Feld der Macht handelt es sich leider nach wie vor um eine gewisse Leerstelle in der feldtheoretischen Forschung. Ich habe versucht, anhand des Beispiels des österreichischen literarischen Feldes anderenorts (Leschanz 2022b) zu skizzieren, wie eine solche Machtfeldverortung aussehen kann.
- 6.
Für den österreichischen Spezialfall hat beispielsweise Birgit Scholz (2007) herausgearbeitet, wie die Literatur am Prozess der neuen österreichischen Identitätsbildung beteiligt war und wie Teile dieses gesamtgesellschaftlichen Diskurses in verschiedene Texte unterschiedlicher Autor*innen dieser Zeit eingeflossen sind.
- 7.
Gelingt eine solche Durchsetzung und Etablierung nicht, droht die Abqualifizierung als Amateur:in und damit oftmals das Ende einer Laufbahn, allein schon aufgrund fehlender Veröffentlichungsmöglichkeiten, Medienpräsenz etc. und nicht zuletzt Einkommen.
- 8.
An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass natürlich auch gerade die Bezugnahme auf international anerkannte Vorbilder ebenso eine Positionierungsstrategie darstellt. Es gibt Größen innerhalb der literarischen Welt, die global für alle „verfügbar“ sind, wenn die Wertschätzungen auch je nach Feld und Zeit schwanken. Ob diese Strategie jedoch Erfolg hat oder nicht ist wiederum abhängig von den Verhältnissen der einzelnen literarischen Felder. (Bourdieu 2004, S. 36–38) Die lokale Ebene schlägt hier tendenziell die globale, denn wenn im unmittelbaren Lebens- und Wirkungsbereich der Akteur*innen keine Existenz als zum Beispiel Autor*in möglich ist, hilft es auch nichts, sich auf ansonsten international anerkannte Schriftsteller*innen zu beziehen. Der Umweg über ein anderes literarisches Feld kann hier Abhilfe schaffen (zum Beispiel jenes eines anderen Landes), wie es nicht selten vorkommt. Gleichzeitig darf darüber nicht die unglaublich hohe Dunkelziffer an Akteur*innen vergessen werden, die niemals anerkannte Positionen im Feld erreichen und besetzen konnten und damit immer nur ‚Amateur*innen‘ blieben, weil feldintern keine Akkumulation symbolischen Kapitals erreicht werden konnte.
- 9.
Durch die Berücksichtigung dieser Mehrfachpositionierungen werden die wichtigen Forschungsergebnisse keineswegs in ihrer Bedeutung gemindert. Es wird jedoch ermöglicht, die Positionsgebundenheit der Literaturgeschichtsschreibung sichtbar zu machen, die immer durch die Feldgebundenheit der Forscher*innen vorhanden ist und im Fall einer Mehrfachpositionierung in unterschiedlichen Feldern nochmals verstärkt.
- 10.
Ein noch viel bekannteres Beispiel für diesen Effekt stellt die Person Jean-Paul Sartres dar, der durch seine dominanten Positionen in Literatur, Philosophie/Wissenschaft und als öffentlicher Intellektueller im journalistischen Feld eine so zentrale Machtposition festigen konnte, wie sie nur sehr selten auftritt. Die verschiedenen Spitzenpositionen ermöglichen dabei auch immer, sich gegenseitig zu bestärken und, falls in einer Auseinandersetzung notwendig, auf ein anderes Feld auszuweichen, wenn auf einem anderen eine Niederlage droht. (Bourdieu 2001a, S. 333–339) Diese Effekte symbolischer Herrschaft und Gewalt sind für die kulturellen Felder viel zu wenig untersucht und sollten bedeutend mehr Aufmerksamkeit erlangen, spielen sie doch eine wichtige Rolle bei der Herstellung von »Wissen« und Diskurshoheit.
- 11.
Mitverantwortlich waren dafür freilich auch Veränderungen des sozialen Raumes als Ganzes, politische Veränderungen mit Auswirkungen auf die Förderpolitik usw.
- 12.
Bezogen auf die grafische Darstellung des Feldes, an dem sich links der herrschende autonome Pol des Feldes befindet, von dem etablierte »Avantgarden« in Bourdieus Schema dazu tendieren, in die »Mitte«, hin zum heteronomen Pol, zu wandern und zu »verbürgerlichen«. (Bourdieu 1997, S. 48; 2001a, S. 203).
- 13.
Seit den 1990er Jahren haben sich Versuche von Akteur*innen im literarischen Feld gehäuft, diese etablierten Feldspitzen »rechts zu überholen«, also durch eine »ökonomischere« Logik der größeren Zugänglichkeit (ohne dabei jedoch wirklich auf Tuchfühlung mit der sogenannten »Massenliteratur« zu gehen). (Tommek 2015, S. 217–316) Diese Versuche waren bisher allesamt zum Scheitern verurteilt, was zu einem großen Teil auch daran liegen mag, dass die herrschende illusio des literarischen Feldes (zumindest in den hier beschriebenen) immer noch aufseiten der autonomen Kunst steht. Versuche, mithilfe »ökonomischerer« Strategien (also durch leichtere Zugänglichkeit, dem Fokus auf »Geschichten erzählen« usw.) die etablierte Feldspitze abzulösen, geraten dadurch in Konfrontation nicht nur mit Akteur*innen, die dem autonomen Pol näher stehen, sondern auch mit der gesamten Geschichte des Feldes und der etablierten symbolischen Herrschaft der künstlerischen Felder, die aufseiten des autonomen Pols steht. Diese Übermacht, kommend von der »autonomen Geschichte« des Feldes, konnte bislang noch nicht gebrochen werden und steht als etablierte und legitime, das heißt als »natürlich« empfundener »common sense« an der Seite der autonomen Akteur*innen, so sehr sich diese auch über Ökonomisierungstendenzen beklagen (was durchaus zu recht erfolgen kann). »Symbolisch« sind sie nach wie vor herrschend, wofür Elfriede Jelinek das leuchtende Beispiel darstellt.
- 14.
Nur als Ergänzung zur mehrfachen Positionierung in unterschiedlichen literarischen Feldern: Abzugrenzen von jenen Akteur*innen, die tatsächlich in unterschiedlichen literarischen Feldern aktiv sind, sind jene, die nur als diskursives Wissen in ihrer »Autorfunktion« (Foucault 2008) sozusagen als »Säulenheilige« angerufen werden, ohne selbst jedoch Teil der Auseinandersetzung oder des Feldes zu sein. Während Peter Handke sehr wohl im österreichischen literarischen Feld und in jenem (West)Deutschlands aktiv war beziehungsweise ist (zu denken sind auch noch weitere), waren es William Shakespeare und Ernest Hemingway zum Beispiel nie. Das bedeutet nicht, dass der Bezug auf sie nicht trotzdem Teil einer Durchsetzungsstrategie sein kann. Man muss hier also unterscheiden zwischen tatsächlichen Doppel- und Mehrfachpositionen und reinen Instrumentalisierungen mit Bezug auf spezifisches »Wissen« innerhalb der (Feld)Diskurse.
- 15.
- 16.
Hier ist noch zusätzlich die wichtige Frage zu beachten, ob in West- und Ostdeutschland unterschiedliche Felder existiert haben oder nicht.
Literatur
Apfl, Peter (2015): Konsequente Textreduktion zur Entlastung der SchülerInnen. Das österreichische Schullesebuch seit 1945 als Knotenpunkt sozio-kultureller Diskurse. Dissertation. Universität Wien. Vergleichende Literaturwissenschaft.
Bachleitner, Norbert (2022): Literatur und Buchmarkt in Österreich im achtzehnten Jahrhundert: ein eigenständiges Feld? In: Haimo Stiemer und Karsten Schmidt (Hg.): Bourdieu in der Germanistik. Berlin: De Gruyter, S. Bachleitner, S. 227–250 sowie Leschanz, S. 301–324
Beer, Siegfried (1998): Die Besatzungsmacht Großbritannien in Österreich 1945–1949. In: Alfred Ableitinger, Siegfried Beer und Eduard G. Staudinger (Hg.): Österreich unter alliierter Besatzung 1945–1955. Wien, Köln, Graz: Böhlau (Studien zu Politik und Verwaltung, 63), S. 41–70.
Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 658).
Bourdieu, Pierre (1997): Das literarische Feld. Die drei Vorgehensweisen. In: Louis Pinto (Hg.): Streifzüge durch das literarische Feld. Konstanz: UVK (Édition discours, 4), S. 33–147.
Bourdieu, Pierre (2001a): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1539).
Bourdieu, Pierre (2001b): Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1695).
Bourdieu, Pierre (2004): Die gesellschaftlichen Bedingungen der internationalen Zirkulation der Ideen. In: Pierre Bourdieu und Joseph Jurt (Hg.): Forschen und Handeln. Vorträge am Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ; (1989–2000) = Recherche et action. 1. Aufl. Freiburg im Breisgau: Rombach (Rombach Wissenschaften Reihe Litterae, 125), S. 35–48.
Bourdieu, Pierre (2010): Homo academicus. 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1002).
Bourdieu, Pierre (2014): Die Ökonomie der symbolischen Güter. In: Pierre Bourdieu: Schriften. Kunst und Kultur. Zur Ökonomie symbolischer Güter. Schriften zur Kultursoziologie 4, Band 12.1. 1. Aufl. Hg. v. Franz Schultheis und Hella Beister. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 2106), S. 187–223.
Bourdieu, Pierre (2015): Das literarische Feld. Kritische Vorbemerkungen und methodologische Grundsätze. In: Pierre Bourdieu: Schriften. Kunst und Kultur. Kunst und künstlerisches Feld. Schriften zur Kultursoziologie 4, Band 12.2. 1. Aufl. Hg. v. Franz Schultheis, Stephan Egger und Bernd Schwibs. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 2126), S. 309–337.
Bourdieu, Pierre (2017): Über den Staat. Vorlesungen am Collège de France 1989–1992. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2221).
Bourdieu, Pierre; Wacquant, Loïc J. D. (2006): Reflexive Anthropologie. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1793).
Casanova, Pascale (2004): The world republic of letters. First Harvard University Press paperback edition. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press (Convergences : inventories of the present).
Cillia, Rudolf de; Reisigl, Martin; Wodak, Ruth (2013): The Discoursive Construction of National Identities. In: Ruth Wodak (Hg.): Critical Discourse Analysis. Volume III: Doing CDA/Case Studies. Los Angeles: SAGE (SAGE benchmarks in language and linguistics, / ed. by Ruth Wodak ; Vol. 3), S. 119–144.
Einfalt, Michael (2006); Pierre Bourdieus Konzept des literarischen Feldes und das Problem des frankophonen Literaturraums. In: Hillebrand, Mark; Lilge, Andrea; Krüger, Paula; Struve, Karen (Hg.): Willkürliche Grenzen. Das Werk Pierre Bourdieus in interdisziplinärer Anwendung. Bielefeld: Transcript, S. 175–196.
Foucault, Michel (2008): Was ist ein Autor? (Vortrag). In: Michel Foucault und Daniel Defert (Hg.): Schriften zur Literatur. Orig.-Ausg., 1. Aufl., [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1675), S. 234–270.
Foucault, Michel (2013): Archäologie des Wissens. 16. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 356).
Holler, Verena (2003): Felder der Literatur. Eine literatursoziologische Studie am Beispiel von Robert Menasse. Frankfurt am Main: Peter Lang (Europäische Hochschulschriften Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur, 1861).
Holler, Verena (2008): Autonomie und Heteronomie – das Profane und das Kulturelle. Überlegungen zum österreichischen Literaturbetrieb der letzten Jahre. In: LiTheS - Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 1 (1), S. 52–71.
Leschanz, Christoph (2022a): Der Nationalstaat als überholte Ordnungskategorie im Zeitalter der Weltliteratur? Ein methodischer Vorschlag zur Abgrenzung verschiedener literarischer Felder als Alternative. In: Paul Ferstl, Sandra Folie, Christoph Leschanz, Theresa Mallmann und Daniel Syrovy (Hg.): Vom Sammeln und Ordnen. Berlin: Weidler (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, 211), S. 263–283.
Leschanz, Christoph (2022b): Im Feld der Macht – das Beispiel des österreichischen literarischen Feldes in der Nachkriegszeit In: Haimo Stiemer und Karsten Schmidt (Hg.): Bourdieu in der Germanistik. Berlin: De Gruyter, S. SEITEN ergänzen und Verlagsstandort prüfen!
Pelinka, Anton (1995): „Vorwort. Österreich ist nicht gleich Österreich ist nicht gleich…“, in: Inszenierungen. Stichwörter zu Österreich. Wien: Sonderzahl, S. 7–11.
Polt-Heinzl, Evelyne (2018): Die grauen Jahre. Österreichische Literatur nach 1945 – Mythen, Legenden, Lügen. Wien: Sonderzahl.
Scholz, Birgit (2007): Bausteine österreichischer Identität in der österreichischen Erzählprosa 1945–1949. Innsbruck, Wien und Bozen: Studienverlag.
Sperl, Alexander (2018): Das Österreichbild der Zweiten Republik im Spiegel der audiovisuellen Medien und Lehrpläne. In: Alois Ecker und Alexander Sperl (Hg.): Österreichbilder von Jugendlichen. Zum Einfluss audiovisueller Medien. 1. Auflage. Wien: New Academic Press (Austriaca), S. 57–62.
Suppanz, Werner (1998): Österreichische Geschichtsbilder. Historische Legitimationen in Ständestaat und Zweiter Republik. Köln, Weimar, Wien: Böhlau (Böhlaus zeitgeschichtliche Bibliothek, 34).
Tommek, Heribert (2015): Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur. Studien zur Geschichte des literarischen Feldes in Deutschland von 1960 bis 2000. Berlin: De Gruyter (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, 140). Online verfügbar unter http://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9783110359084.
Wagnleitner, Reinhold (1991): Coca-Colonisation und Kalter Krieg. Die Kulturmission der USA in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik (Österreichische Texte zur Gesellschaftskritik, Bd. 52).
Wimmer, Michael (2020): Das Phantom der Demokratie. Eine kleine Geschichte der österreichischen Kulturpolitik. In: Michael Wimmer (Hg.): Kann Kultur Politik? Kann Politik Kultur? Warum wir wieder mehr über Kulturpolitik sprechen sollten. [1. Auflage]. Berlin: De Gruyter (Edition: Angewandte), S. 122–134.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Leschanz, C. (2023). Feldtheorie und Literaturgeschichte: Herausforderungen, Möglichkeiten und Mehrfachpositionierungen von Akteur*innen. In: Magerski, C., Steuerwald, C. (eds) Literatursoziologie. Literatur und Gesellschaft. Literatursoziologische Studien. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39816-3_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-39816-3_4
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-39815-6
Online ISBN: 978-3-658-39816-3
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)