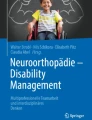Zusammenfassung
Der Beitrag befasst sich mit methodischen und methodologischen Überlegungen zur Forschung mit Menschen mit Komplexer Behinderung. Unter Bezugnahme auf das Forschungsprojekt Teilsein & Teilhaben wird insbesondere der Frage nachgegangen, wie teilhabeorientierte Forschung mit Menschen mit Komplexer Behinderung gestaltet werden kann. Die zentrale Erkenntnis lautet, dass sich der Ausschluss des Personenkreises aus der Teilhabeforschung nur verhindern lässt, wenn Teilhabe im und am Forschungsgeschehen von allen Beteiligten in achtsamer Weise gestaltet wird. Der Beitrag schließt mit den sich daraus ergebenden methodologischen Konsequenzen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
1 Einleitung
Der vorliegende Beitrag stellt die methodischen und methodologischen Überlegungen und Entwicklungen hinsichtlich einer teilhabeorientierten Forschung mit Menschen mit Komplexer Behinderung vor. Entstanden sind diese im Rahmen der Forschungsarbeit des Projektes Teilsein & TeilhabenFootnote 1 (2016–2019, Universität zu Köln). Das Projekt untersuchte die Lebenswelten Erwachsener mit Komplexer Behinderung mit dem Ziel, anhand theoretischer und empirischer Erkenntnisse Handlungsempfehlungen für eine teilhabeorientierte Begleitung und Pflege des Personenkreises zu erarbeiten. Im Kontext des vorliegenden Beitrags kann nicht der vollständige theoretische Rahmen vorgestellt werden, allerdings soll einführend in aller Kürze das zugrundliegende Verständnis von Teilhabe skizziert werden, da es sich als konstituierend für die weiteren Überlegungen erweist.Footnote 2 Dieses Vorhaben stellt sich als besonders herausfordernd dar, insofern Teilhabe ein äußerst vielfältiger und mehrdimensionaler Begriff ist, dem sich zu nähern allein einen wertvollen Beitrag darstellen würde. So sei vorweggenommen, dass hier nur eine Facette und gleichzeitig eine Grunddimension von Teilhabe betrachtet wird, die anthropologisch-(sozial-)ethische Dimension.
Basierend auf der Theorie der Gabe des Philosophen Marcel Mauss wurde im Rahmen des Projektes der Versuch einer Annäherung an ein nichtausschließendes Verständnis von Teilhabe unternommen, da der im Projekt und auch in diesem Beitrag anvisierte Personenkreis als besonders betroffen von Ausschluss und Nichtteilnahme bezeichnet werden kann (vgl. Fornefeld, 2008).
Ausgehend von der Annahme, dass jedem Menschen die Fähigkeit gegeben ist, sich an den Anderen zu wenden und mit ihm einen wechselseitigen Beziehungsprozess zu gestalten, wird Teilhabe verstanden als soziale Bindung, als der Moment der Begegnung, in dem sich Geben, (An-)Nehmen und Erwidern zu einer untrennbaren Einheit verbinden und durch die Erwiderung des Gegebenen immer ein Moment des Teilhabens entsteht. Diesem Grundgedanken folgend, kann Ausschluss verhindert werden, denn Teilhabe ist auf diese Weise immer möglich, es entsteht ein nichtausschließendes Teilhabeverständnis. Fornefeld (2019, S. 6) formuliert hierzu zwei zentrale Aussagen:
„1. Teilhabe ist Gabe, d. h. sie wird durch das soziale Band zwischen den Menschen bzw. durch das soziale Leben selbst gebildet.
2. Teilhabe entsteht durch die im Beziehungsvollzug gegebene wechselseitige Anerkennung.“
So verstanden, entsteht Teilhabe nicht im „‚Mitdenken‘, sondern nur in der gebenden und erwidernden Gabe-Beziehung. Man kann einen anderen erst ‚Mitdenken‘, wenn man mit ihm in Beziehung getreten ist und die Bindung zu ihm erfahren hat. Teilhabe wird lebendig und umsetzbar, wenn sie als das verstanden wird, was Menschen von alters her miteinander verbindet: die soziale Bindung.“ (ebd., S. 8).
Damit ergeben sich auch für Forschungskontexte Haltungs- und Handlungsimplikationen: Um eine teilhabeorientierte Gestaltung zu ermöglichen, muss in jeder Situation Teilhabe gelebt und ausgehandelt werden. Sie muss dann „aktiv und vor dem Hintergrund der Dynamik des individuellen Lebens der einander begegnenden Menschen und auf der Grundlage der kulturellen und sozioökonomischen Bedingungen der Gesellschaft, in der sie leben“ (ebd., S. 9) gestaltet werden. Die Forschungskonzeption des Projektes Teilsein & Teilhaben wurde unter dieser Perspektive entwickelt und durchgeführt.
2 Teilsein & Teilhaben: Teilhabeorientierte Forschung zur Alltagsgestaltung von Menschen mit Komplexer Behinderung
Ziel des Projekts Teilsein & Teilhaben war, das Handlungsfeld der Pflege und Assistenz bei Menschen mit Komplexer Behinderung unter der Perspektive der Teilhabe aus den individuellen Sichtweisen der beteiligten Personengruppen zu fokussieren bzw. als Ausgangspunkt für weitere Ansätze festzulegen. Basierend auf einer theoretischen Grundlegung und multiperspektivischen Erfassung von Alltagsaktivitäten wurden Handlungsempfehlungen für die Praxis erarbeitet, um fundierte Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zur Umsetzung der geforderten Teilhabeorientierung zu entwickeln.
Der Komplexität dieser Anforderungen war nur durch verschiedene Ansätze im Sinne einer Methodentriangulation zu begegnen. Von wesentlicher Bedeutung waren dabei vor allem die Reflexionsprozesse im Sinne einer Transition der empirischen (Teil-)Erkenntnisse auf die Theorie (und umgekehrt) (vgl. Abb. 1).
Der Forschungsprozess war zirkulär ausgerichtet und verfolgte einen transdisziplinären Ansatz, indem Prozessschritte, Instrumententwicklungen und Erhebungsergebnisse nach jedem Teilschritt den beteiligten Expert*innen aus der Praxis vorgestellt, mit ihnen diskutiert und weiterentwickelt wurden. Dieses methodische Konstrukt wird als Forschungswerkstatt bezeichnet.
3 Planungs- und Konzeptionierungsphase
3.1 Arbeit mit der Forschungswerkstatt
Seit 2006 existiert am Lehrstuhl Pädagogik und Rehabilitation von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung der Universität zu Köln (UzK) eine Forschungswerkstatt, an der Vertreter*innen verschiedenster Institutionen der Behindertenhilfe mit unterschiedlichen Funktionen teilnehmen, um Austausch und Verknüpfung wissenschaftlicher Themen und konkreter Fragestellungen aus der Praxis zu ermöglichen. Aus diesen Kooperationstreffen wurde die Zielperspektive des Projekts entwickelt und ein Großteil der Projektpartner*innen akquiriert. Mit weiteren Projektpartner*innen entstand die „neue“, dem Projekt angegliederte Forschungswerkstatt aus dem wissenschaftlichen Team der UzK und sieben Projektpartner*innen (mit jeweils einer*m pädagogische*n und einer*m pflegerische*n Ansprechpartner*in), die jeweils die Institution im Kontext der Eingliederungshilfe vertraten.
Neben einer regelmäßigen Informationsweitergabe an die Projektpartner*innen war das vorrangige Ziel der Forschungswerkstatt die Begleitung und Evaluation der erhobenen Erkenntnisse im transdisziplinären Diskurs. Durch die interdisziplinäre Reflexion von Daten und Ansätzen können unterschiedliche Muster bei der Dateninterpretation berücksichtigt und monokausale Sichtweisen vermieden werden. Nach Hoffmann & Pokladek (2010, S. 2) liegt dem Format der Forschungswerkstätten der Gedanke zugrunde,
„dass die beiden zentralen Aktivitäten qualitativer Sozialforschung – die der Datenerhebung und der Datenanalyse – einen kommunikativen Charakter haben und die Wirksamkeit der Datenanalyse gesteigert werden kann, wenn sie innerhalb der Interaktionen einer Arbeitsgruppe vollzogen wird (…).“
Im vorliegenden Projekt gewährleistete dieser Forschungsansatz (auch) den regelmäßigen Austausch individueller konzeptioneller, didaktischer, struktureller und pädagogischer Fragestellungen aus Theorie und Praxis, die kontinuierlich den weiteren Forschungsprozess mitbestimmten.
3.2 Auswahl der Studienteilnehmer*innen
Der Personenkreis Menschen mit Komplexer Behinderung ist in seinen individuellen Bedarfslagen und Teilhabemöglichkeiten außerordentlich heterogen. Um die unterschiedlichen Bedürfnislagen und teilhabeorientierten Anforderungen differenziert zu erheben, wurden sechs Fallgruppen mit spezifischen Bedarfen aus dem Personenkreis gebildet. Trotz der ethischen Prämisse, dass jeder dieser Menschen in seinem Wirken und Wesen einzigartig ist, war für die vorliegende Forschungsarbeit eine kriteriengestützte Fallauswahl unerlässlich, da auch bei diesen Menschen repräsentative Merkmale vorliegen, die Rückschlüsse auf eine bestimmte Gruppe von Menschen erlauben. Folgende sechs Fallgruppen wurden im Projekt fokussiert:
Menschen mit Komplexer Behinderung einschließlich
-
1.
Mehrfachbehinderung
-
2.
Multimorbidität
-
3.
alterungsbedingter Abbauprozesse
-
4.
herausfordernder Verhaltensweisen
-
5.
psychischer Störungen
-
6.
frühkindlichem Autismus
Um eine möglichst genaue Zuordnung zu einer Fallgruppe zu ermöglichen, wurden Merkmale als Ein- und Ausschlusskriterien generiert, die wiederum in einer Forschungswerkstatt anhand von exemplarischen Einzelfällen vorgestellt und diskutiert wurden. Am Beispiel der Fallgruppe 3 ‚Menschen mit Komplexer Behinderung und alterungsbedingten Abbauprozessen‘ soll dieses Vorgehen konkretisiert werden: Mögliche Einschlusskriterien wären hier neben dem Vorliegen einer geistigen Behinderung (und eingeschränkter Verbalsprache) ein Mindestalter von fünfzig Jahren, eine vorliegende Verrentung bzw. Austritt aus arbeitsbezogenen Beschäftigungsangeboten, altersbedingte Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen, eine geringe Belastbarkeit und mögliche (altersbedingte) Zusatzerkrankungen, wie Osteoporose, Diabetes oder weitere Sinnesbeeinträchtigungen. Etwaige Ausschlusskriterien wären hier beispielsweise diagnostizierte demenzielle Erkrankungen.
Orientiert an wissenschaftlichen Grundlagen (u. a. ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health), wurden individuelle Lebensfelder/-bereiche (Motorik und Orientierung, Kommunikation, Selbstversorgung und häusliches Leben, soziale Beziehungen und Aktivitäten, medizinische Diagnosen, Möglichkeiten der Einwilligung und weitere Anmerkungen) skizziert, zu denen eine personenbezogene Beschreibung ergänzt werden sollte. Mit diesem „Anforderungsprofil“ waren die Projektpartner*innen gefordert, in ihren Einrichtungen die Personen auszuwählen, die den gemeinsam formulierten Kriterien unter Berücksichtigung der folgenden probandenbezogenen, strukturbezogenen und einrichtungs- bzw. projektpartnerbezogenen Aspekten besonders entsprachen:
-
Die Zustimmung der teilnehmenden Personen musste gewährleistet sein, worauf unter Abschn. 3.4 noch vertiefend eingegangen wird.
-
Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Einrichtungen sollte eine gendergemäße Verteilung beachtet werden, d. h., möglichst jeweils eine weibliche und eine männliche Person pro Fallgruppe wurde ausgewählt.
-
Die beteiligten Personen mit Komplexer Behinderung sollten über einen möglichst breiten Unterstützerkreis verfügen, um multiperspektivisch die individuellen Bedarfslagen zu berücksichtigen.
-
Um ein möglichst ganzheitliches Bild ihrer Lebenswirklichkeiten abbilden zu können, sollten die jeweiligen Personen in ihren verschiedenen Lebensfeldern (Arbeit, Wohnen, Freizeit, Familie) begleitet werden können.
3.3 Ermittlung repräsentativer Einzelfälle
Die Projektpartner*innen stellten 35 Einzelfälle zur Teilnahme am Projekt vor, wobei zunächst nur die Zustimmung der gesetzlichen Betreuer*innen und einiger Vertreter*innen der Unterstützerkreise vorlag und die Personen selbst seitens der professionellen Unterstützer*innen informiert und diejenigen mit offensichtlichem Interesse zur Teilnahme motiviert wurden. Zur Sichtung, Analyse und Reduzierung entwickelte das wissenschaftliche Forscher*innen-Team verschiedene ICF-basierte Kriterien und entsprechende Synopsen zu jedem individuellen „Fall“ und nahm auf der Basis projektrelevanter Faktoren (Zugehörigkeit zu Fallgruppe, Geschlecht, Alter etc.) eine Priorisierung zur Diskussion mit der Forschungswerkstatt vor (vgl. Abb. 2).
Die beteiligten Projektpartner*innen in der Praxis wurden gebeten, die schriftlichen Befragungen und Einwilligungen der Unterstützerkreise zu organisieren, die individuellen Einwilligungsmöglichkeiten der Studienteilnehmer*innen zu eruieren und Ideensammlungen zur aktiven Beteiligung der Teilnehmer*innen anzudenken. Insgesamt wurden so 15 Einzelfälle und ihre Unterstützerkreise zur Projektteilnahme angefragt (zur Entwicklung vgl. Abb. 2).
3.4 Exkurs: Zur Situation der Stellvertretung im Kontext von Forschung mit Menschen mit Komplexer Behinderung
Der nicht unmittelbare Einbezug des betroffenen Personenkreises ist durch sein Angewiesensein zu begründen. In der Begleitung und Unterstützung alltäglicher Lebensinhalte sind Menschen mit Komplexer Behinderung häufig abhängig davon, dass ihre Bedürfnisse erkannt und erfüllt werden. Diese Fremdbestimmung kann nur durch eine reflektierte Haltung als angemessene Stellvertretung im Sinne der Betroffenen gestaltet werden, was auch für teilhabeorientierte Forschungskontexte gilt.
Menschen mit Komplexer Behinderung gelten zwar als nicht einwilligungsfähig (vgl. Damm, 2016), die Absprache von Entscheidungs- und Einwilligungsfähigkeit entspricht jedoch längst nicht mehr dem wissenschaftlichen Konsens (vgl. u. a. Watson, 2016; Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, 2016). So fordert eine partizipativ ausgerichtete Forschung, auch diesem Personenkreis von Anfang an Möglichkeiten der Mitwirkung an Forschungsprozessen zu bieten (vgl. Dederich, 2017, S. 7 f.).
Menschen dieses Personenkreises können durchaus signalisieren, ob sie einem Forschungsvorhaben zustimmend oder ablehnend gegenüberstehen. Bei Menschen mit Komplexer Behinderung spielt allerdings eine vertrauensvolle Beziehung eine besonders wichtige Rolle bei der (informierten) Einwilligung (vgl. Hauser, 2016, S. 89), und häufig bietet das Forschungsdesign nicht die (zeitlichen) Bedingungen für eine vertrauensvolle Beziehungsbasis zwischen Forschenden und Studienteilnehmer*innen. Aus diesem Grund sollten vertraute Personen den Studienteilnehmer*innen den Sinn des Forschungsvorhabens verständlich vermitteln (ebd.). In den meisten Fällen erfolgt die Zustimmung zur Teilnahme dann auf Basis einer Stellvertreter*innen-Entscheidung. Bei dieser Proxy-Einwilligung muss unbedingt abgewogen werden, „inwieweit die StellvertreterInnen die Bedürfnisse der potenziellen TeilnehmerInnen einschätzen können und die Interessen der potenziellen Teilnehmenden vertreten können“ (ebd.).
Tatsächlich ist das einmalige Einholen des Einverständnisses vor dem Forschungsprozess zwar juristisch empfehlenswert, wird jedoch zunehmend durch eine prozesshafte Einwilligung ersetzt, die anhand wiederholter und dialogisch gestalteter Einwilligungen der Dynamik qualitativer Forschungsprozesse entspricht (vgl. Unger, 2014, S. 26). Für forschungsmethodische Überlegungen folgt daraus, dass
-
kontinuierlich zu überprüfen und zu reflektieren ist, ob der*die Studienteilnehmer*in (noch) zur Mitwirkung am Forschungsprozess bereit ist;
-
es erforderlich sein kann, auch andere Vertrauenspersonen einzubeziehen, um ebenjene Bereitschaft einzuschätzen;
-
eine solche Einwilligung nicht immer schriftlich erfolgen kann, aber immer dokumentiert werden sollte (Feldnotizen, Forschungstagebuch).
Für die Durchführung einer teilhabeorientierten Forschung sind die beschriebenen Schritte unabdingbar, sie weisen aber auch auf eine noch nicht gelöste Problematik hin, der auch der vorliegende Ansatz (noch) nicht vollständig begegnen kann: die Gestaltung einer voraussetzungslosen Beteiligung an Forschung. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, in dem sich ihm kontinuierlich und auf verschiedenen Wegen angenähert wird. Das vorliegende Design ist ein Schritt in diese Richtung.
4 Erhebungsphase
4.1 Schriftliche Befragung
Die erste Erhebungsphase diente dazu, Teilhabe- und Kommunikationsmöglichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse der Studienteilnehmer*innen aus der Perspektive der Unterstützer*innen zu erfahren, um anhand dieser Ergebnisse einen individuellen Einstieg in das forschungsmethodische Vorgehen gestalten zu können. Bei der schriftlichen BefragungFootnote 3 wurden verschiedene Instrumente berücksichtigt: ein Fragebogen zur persönlichen Einschätzung der zukünftigen Studienteilnehmer*innen, eine schriftliche Befragung zur Erhebung ihrer Kommunikationsmöglichkeiten und -situationen und eine Befragung zu ihren exemplarischen Tagesabläufen in Tabellenform. Diese Erkenntnisse zu verbalsprachlichen, kognitiven und emotionalen Möglichkeiten beeinflussten die weitere Entwicklung zusätzlicher Instrumente. Die mithilfe des thematischen Codierens (vgl. Flick, 2002, S. 271 ff.) analysierten Bedarfe, Wünsche und Interessen führten zu individuumsbezogenen Gestaltungen der Fallwerkstätten.
4.2 Die Fallwerkstätten
Für alle teilnehmenden Studienteilnehmer*innen wurden individuelle Fallwerkstätten durchgeführt, die aus verschiedenen Bausteinen mit jeweils verschiedenen Zielgruppen und Methoden bestanden. Bei einem ersten Treffen (siehe Abschn. 4.2.1) waren (soweit möglich) alle professionellen Unterstützer*innen beteiligt, die die Studienteilnehmer*innen im Alltag begleiten. Organisiert und durchgeführt wurde das Treffen von zwei wissenschaftlichen Forscher*innen, die im weiteren Verlauf mit den Einzelfällen betraut waren. Die betroffene Person selbst nahm an diesem Treffen nicht teil, da eine Teilhabe zu diesem Zeitpunkt nicht individuumsadäquat gestaltet werden konnte, aber das Kennenlernen der Studienteilnehmer*innen fand direkt im Anschluss statt (siehe Abschn. 4.2.2).
4.2.1 Arbeit mit dem Unterstützerkreis (Fokusgruppen-Diskussion und Netzwerkkarte)
Zur Klärung offener Fragen der ersten Erhebungsphase wurde in sogenannte Fokusgruppen-Diskussionen übergeleitet, um mit den professionellen Unterstützer*innen die individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und sozialen Beziehungen der Studienteilnehmer*innen aus der Stellvertreter*innenperspektive genauer zu definieren und etwaige Anforderungen an Teilhabe aus Sicht der Assistent*innen möglichst detailliert zu erheben. Als Gesprächsimpulse wurden offene Fragen diskutiert, aber auch Textsegmente aus den schriftlichen Befragungen zur Verfügung gestellt, um ergänzende individuelle Sichtweisen zu erschließen.
Ein weiteres Mittel zur Gestaltung der Diskussion (Befragung) war die Unterstützerkreiskarte (Netzwerkkarte), mit deren Hilfe „ego-zentrierte Netzwerke mit einer Visualisierung erhoben [werden können]. Wichtige Bezugspersonen werden je nach Nähe und Distanz im Raum um Ego platziert, sowie eventuell nach Sektoren getrennt und Verbindungen zwischen ihnen als Linien gezogen“ (Fuhse, 2018, S. 147). So ergibt sich eine Verbindung von strukturierten und narrativen, themenoffenen Erzählanstößen, und die Netzwerkkarte funktioniert selbst als Erzählanstoß (vgl. Höfer et al., 2006). Zudem ist eine Visualisierung „auch ein hervorragendes Medium für einen gemeinsamen Reflexionsprozess zwischen Forscher/in und Interviewpartner/in“ (Straus, 2010, S. 527), die mit Namen, aber auch wichtigen Gegenständen, Orten o.Ä. gefüllt werden kann.
4.2.2 Entwicklung und Arbeit mit der Gabe
Der Aspekt der Freiwilligkeit zur Teilnahme am Forschungsprojekt nahm einen zentralen Stellenwert ein, und so wurde ein Instrument entwickelt, das in seiner individuellen Ausgestaltung einen angemessenen Zugang zum Forschungsprozess für die teilnehmenden Personen bot. In Übereinstimmung mit dem (eingangs) definierten Teilhabeverständnis wurde die sogenannte ‚Gabe‘Footnote 4 erstellt, deren vorrangiges Ziel in der Entwicklung einer Visualisierungsmöglichkeit zur Abbildung des Projektvorhabens mit den unterschiedlichen Erhebungsphasen besteht. Dieses Medium, das als Geschenk (Gabe) bei der teilnehmenden Person verblieb, sollte einen Einblick in den gesamten Projektverlauf ermöglichen, durch den sich die Struktur der einzelnen Begegnungen (Erhebungstage und -methoden) erschloss und die über den gesamten Prozess eine Erinnerungsmöglichkeit darstellte. Gleichzeitig bot sich so die Gelegenheit einer persönlichen Begegnung und Interaktion und damit auch die Möglichkeit eines Aushandlungsprozesses, denn nach dem zugrundeliegenden Verständnis muss Teilhabe immer wieder neu ausgehandelt und gestaltet werden, was sich als konstituierende Prämisse auch für den Forschungsprozess erwies. Besonders berücksichtigt wurden bei der Gestaltung der ‚Gabe‘ daher die unterschiedlichen Aneignungsebenen der einzelnen Teilnehmer*innen mit ihren individuellen kommunikativen und schriftsprachlichen Kompetenzen. Diese Scheibe (vgl. Abb. 3) entspricht mit ihrer Unterteilung in vier Felder den vier Forschungsphasen, in deren Mitte ein Feld der Personalisierung durch ein Foto der teilnehmenden Person mit der begleitenden Forschungsperson dient. Das Feld ist drehbar an der Scheibe befestigt und mit einer Pfeilspitze versehen, die auf die jeweilige Projektphase fokussiert werden kann.
Bei der weiteren Projektplanung wurde berücksichtigt, dass dieselbe Person bei den weiteren Forschungsphasen aus Gründen der Kontinuität anwesend war. Das erste Feld der Scheibe stellt das Kennenlernen und den Startpunkt dar. Hierzu wurden zwei Holzfiguren in verschiedenen Farben mit Klettverschluss an der Scheibe befestigt, die für Rollenspiele o.Ä. wieder abgenommen werden konnten. Ziel der ersten Phase war die Ermittlung individueller Wünsche, Interessen und Vorlieben und das Kennenlernen von Personen und Orten aus dem Lebensalltag der Teilnehmenden, um weitere Teilnahmemöglichkeiten zu ermitteln und je nach (verbal)sprachlichen Fähigkeiten Fragen und Anregungen zu klären. Eine Drehung der Pfeilspitze auf das zweite Feld stellt den Bezug auf den Tag der teilnehmenden Beobachtung her und symbolisiert mit zwei festen Bändern in den Farben der Holzfiguren den Kontakt miteinander in unterschiedlichen Variationen. Die haptische Auseinandersetzung bildet einen Zugang zueinander und kann durch verbalsprachliche Impulse begleitet werden. Das dritte Feld symbolisiert den zweiten Tag der Beobachtung mit dem Videographieren relevanter Situationen. Auf dieses Feld wurde (gemeinsam) eine Spiegelfolie geklebt, die das „Von-außen-Betrachten“ durch die Videokamera versinnbildlichen und der teilnehmenden Person eine Außenperspektive ermöglichen soll. Das vierte Feld bildet den personenzentrierten Abschluss des Projekts ab. Nach der Phase der Datenauswertung wurden die Erkenntnisse des Projekts probandenbezogen gemeinsam präsentiert und teilhabeorientiert erprobt. Eine kleine Holzkiste symbolisierte hier die möglichen Ansatzpunkte einer teilhabeorientierten Situationsgestaltung, auf die in Abschn. 5.2 vertiefend eingegangen wird.
4.3 Leitfadengestützte Interviews mit nahen Bezugspersonen (Eltern)
In der Erhebungsphase zur Vorbereitung der Begleitung im Feld wurden teilstrukturierte Interviews mit nahestehenden Bezugspersonen geführt, um mittels eines Leitfadens und den darin verorteten Themenfeldern ein Gerüst zur Datenerhebung und -analyse zu ermöglichen. Die Situationen wurden offen gestaltet, um weitere sich ergebende wichtige Themen miteinzubeziehen oder bei der Auswertung einzelne Themen herausfiltern zu können (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 372). Dabei ist die jeweils befragte Person immer der Mittelpunkt und „nicht nur Datenlieferant, sondern er determiniert als Subjekt das Gespräch qualitativ und quantitativ mit. (…) So erfolgt (…) eine Wirklichkeitsdefinition durch den Befragten“ (Lamnek & Krell, 2005, S. 351).
In den meisten Fällen wurden die Eltern oder langjährige professionelle Begleiter*innen zur Lebensgeschichte der Studienteilnehmer*innen befragt. So konnte den unterschiedlichen Perspektiven der professionellen Unterstützer*innen und der wissenschaftlich Forschenden eine weitere hinzugefügt werden, mit einer von den bisherigen Erkenntnissen relativ unabhängigen Deutung und Analyse von Erlebnissen und Erfahrungen der Studienteilnehmer*innen aus Kindheit und Adoleszenz.
Bei der Konstituierung des Interviewleitfadens waren vor allem Fragen zu biografischen Erfahrungen zentral. Gerade bei Menschen mit Komplexer Behinderung mangelt es häufig an Umfeldwissen zu prägenden Erlebnissen, was durch deren institutionalisierte Lebenswege und fehlende Dokumentationen zu begründen ist. Biografisches Wissen ist allerdings von größter Bedeutung, wenn es um die Annäherung an subjektive Perspektiven von Menschen geht, die in ihrer Ausdrucksweise eingeschränkt sind. So lag ein weiterer Schwerpunkt auf der Befragung zu deren möglichen Bedürfnissen. Gerade hier ist die Multiperspektivität bedeutsam, da vor allem Eltern und professionelle Unterstützer*innen häufig andere Maßstäbe, Kriterien oder Priorisierungen setzen und nur möglichst viele Perspektiven eine Annäherung an den Menschen in seiner komplexen Bedürftigkeit garantieren. So wurden körperliche und soziale Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, interessengeleitete Aktivitäten und Erfahrungen sowie Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Teilhabemöglichkeiten thematisiert.
In einer Zwischenauswertung wurden die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Daten im Hinblick auf detaillierte Forschungsperspektiven für die Begleitung im Feld analysiert.
4.4 Begleitung im Feld
Basierend auf den Erkenntnissen der ersten Erhebungsphase und der Erkenntnisse der Unterstützer*innenbefragungen wurden die sogenannten Teilhabe-Tage konzipiert, die aus einer Begleitung des Alltags der teilnehmenden Personen und einer Annäherung an deren Lebenswelten mittels verschiedener methodischer Ansätze bestand.
4.4.1 Teilnehmende Beobachtung
In persönlichen Begegnungen mit den beteiligten Menschen mit Komplexer Behinderung wurden an zwei Tagen (vom Aufstehen bis zum Schlafengehen) von zwei Vertreter*innen des Forscherteams Beobachtungen durchgeführt, die sich auf Teilhabemöglichkeiten an Alltagsaktivitäten fokussierten. Teilhabe, verstanden als soziale Bindung, die sich im Moment des Gebens, Nehmens und Erwiderns zeigt, wird in allen Situationen sichtbar, in denen Menschen interagieren. Hauptkriterium der Beobachtung war dementsprechend die Identifikation ebendieser Momente und die möglichst genaue Beschreibung der Begegnung/Interaktion. So wurden soziale Interaktionen zwischen Menschen und Handlungsweisen Einzelner oder Gruppen differenziert beobachtet und dokumentiert. Nach den zwei Tagen der Alltagsbegleitung fand ein systematisches Teamfeedback statt, in dem die beobachteten Situationen und Aspekte zwischen den Forscher*innen diskutiert und anschließend mithilfe konsensuell und diskursiv entwickelter Handlungs- und Deutungsmuster interpretiert wurden. Handlungen und Interaktionen konnten hinsichtlich Länge, involvierter Personen oder Stimmungen und hinsichtlich ihres Potenzials an Teilhabeorientierung gedeutet werden (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 333) und ggf. durch den Abgleich mit weiteren Daten oder auch einem erneuten Abgleich mit den Beteiligten verifiziert werden (z. B. Rücksprache mit den professionellen Unterstützer*innen, Analyse der schriftlichen Befragung und der Interviews mit Angehörigen, Betrachtung der nachfolgend beschriebenen Videographien, aber auch eine erneute Begegnung mit den Personen selbst).
Dieses konsensuell ausgerichtete Moment ist von besonderer Bedeutung bei Annäherungen an fremde Perspektiven und bei Aushandlungsprozessen hinsichtlich der Auswertung und Interpretation von Beobachtungen aus subjektiver und selektiver Wahrnehmung (vgl. Gehrau & Weischer, 2017, S. 28). In der teilnehmenden Beobachtung werden Forschende zu Teilnehmenden der Beobachtungssituation, was wiederum zu hohen Anforderungen an die Reflexion der Rolle der Forschenden als auch an die Gestaltung der Situation selbst führt. Gleichzeitig ist diese Beobachtung ein Zugang der Annäherung an „fremde“ Lebenswelten, eine „Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz, zu der es gehört, die Perspektive der Untersuchungspersonen übernehmen zu können, aber gleichzeitig als Zeuge der Situation Distanz zu wahren. Ohne Nähe wird man von der Situation zu wenig verstehen, ohne Distanz wird man nicht in der Lage sein, sie sozialwissenschaftlich zu reflektieren“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 46).
Alle Beobachtungen wurden in Protokollen festgehalten und mittels einer „dichten Beschreibung“ (Geertz, 1983) verschriftlicht. Sowohl kontextuelle Bedingungen als auch konkrete Handlungen aller Beteiligten wurden berücksichtigt und in vollständigen, nachvollziehbaren und analysierbaren Interaktionsabläufen dargestellt (vgl. Friebertshäuser & Panagiotopoulou, 2013).
4.4.2 Videographie
Um die Einsichtnahme in den Alltag von Menschen mit Komplexer Behinderung mittels teilhabeorientierter Beobachtung zu validieren, wurden am zweiten Tag der Feldbegleitung Videographien von ausgewählten Alltagssituationen der Studienteilnehmer*innen erstellt. Bei Videographien handelt es sich um „die Untersuchung ‚natürlicher‘ Interaktionssituationen (…). Mit der Betonung des ethnographischen Aspekts der Videoanalyse – als Videographie – wird dabei besonderer Wert auf die Beachtung der Erhebungssituation und des ethnographischen Hintergrundwissens gelegt“ (Knoblauch & Schnettler, 2007, S. 585). Die Auswahl der Situationen erfolgte auf Basis vorangegangener Beobachtungen in Absprache mit begleitenden Unterstützungspersonen und unter Berücksichtigung der (informierten) Einwilligung und der Persönlichkeitsrechte weiterer Beteiligter. Um die Berücksichtigung der Studienteilnehmer*innen zu fokussieren, wurde in den meisten Fällen zumindest eine Essenssituation aufgezeichnet, da hier individuelle Bedürfnisse und Bedarfe und unterschiedliche Aspekte von Kommunikation sichtbar werden. Vor allem bei Letzterem zeigt sich ein großer Mehrwert von Videographien, denn „audiovisuelle Aufzeichnungen lassen Aspekte des Forschungsfeldes analysierbar werden, die bei Einsatz von herkömmlichen Datenerzeugungsweisen unzugänglich bleiben mussten. Es werden ‚mikroskopische‘ Analysen einzelner Details möglich, die mit klassischen (rekonstruktiven) Erhebungsmethoden nicht zum Datum gemacht werden konnten.“ (ebd., S. 587) Gerade bei Menschen mit Komplexer Behinderung und ihrer häufig eingeschränkten Verbalsprache sind körpereigene Kommunikationsformen (z. B. Mimik, Gestik) von besonders großer Bedeutung. In der Beobachtung erscheinen diese Ausdrucksmöglichkeiten häufig flüchtig und vielfältig interpretierbar bzw. werden vollständig übersehen. Durch eine Videoaufzeichnung lassen sie sich wiederholt betrachten und im Diskurs zwischen den an der Auswertung beteiligten Forscher*innen und ggf. Mitgliedern der Unterstützerkreise multiperspektivisch deuten, wodurch ein weiterer Vorteil der Videographie in der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und multiperspektivischen Zugänglichkeit für den validierenden Diskurs liegt.
4.4.3 Informelle Gespräche
Eine dritte Form der Datenerhebung während der Teilhabe-Tage waren informelle Gespräche mit Mitbewohner*innen, Kolleg*innen und professionellen Unterstützer*innen, die dadurch gekennzeichnet sind, „dass sie sich zufällig in unterschiedlichen sozialen Feldern ergeben. Sie zeichnen sich durch eine weitgehende Unstrukturiertheit von Seiten des/der InterviewerIn aus. Es sind vielmehr die Befragten, die den zentralen Beitrag zur Strukturierung des Gesprächs leisten“ (Halbmayer & Salat, o. J.). Diese informellen Gespräche wurden anhand von Gedächtnisprotokollen verschriftlicht und bilden eine weitere gewinnbringende Datenquelle. Zusätzliche Informationen, Verweise und Hintergründe konnten so bei der Auswertung miteinander in Bezug gesetzt und mit den Erkenntnissen aus Beobachtung und Videographie zusammengeführt werden. Neben den forschungsmethodologischen Vorteilen boten die informellen Gespräche auch die Möglichkeit zum Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen der Beteiligten, was wiederum zum Gelingen des gesamten Projekts beitrug.
5 Auswertungsphase
5.1 Qualitative Inhaltsanalyse
Aus dem multimethodischen Vorgehen der Datenerhebung ergaben sich verschiedene Datenquellen: schriftliche Befragungen, Transkripte der Interviews und Videographien, dichte Beschreibungen der Beobachtungsprotokolle und informelle Gespräche. Da alle Daten in schriftlicher Form vorlagen, wurde eine Auswertung mittels Qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2016) zur Strukturierung und Analyse der umfangreichen Datenmenge durchgeführt. Mit der Qualitativen Inhaltsanalyse wird das Kommunikationsmaterial systemisch bearbeitet, weshalb sich diese Methode besonders gut für größere Datenmengen eignet. Durch die Zusammenführung von deduktiven und induktiven Kategorien können Thesen, Inhalte und Aspekte den ausgearbeiteten Theorien zugeordnet werden (Abb. 4).
Orientiert an den Zielformulierungen des Projekts wurden theoriegeleitet die folgenden Auswertungsperspektiven eingenommen:
-
Bedürfnisse von Menschen mit Komplexer Behinderung;
-
Anforderungen in professioneller Unterstützung und Begleitung;
-
strukturelle Aspekte professioneller Unterstützung und Begleitung;
-
(Möglichkeiten) teilhabeorientierte(r) Situationsgestaltung.
Die deduktiven Perspektiven wurden durch induktive Kategorien aus dem Material ergänzt oder in Teilen ersetzt. Die Datenquellen wurden aufgearbeitet und die aussagekräftigsten Textabschnitte mit Codes versehen, wobei nur durch die reflektierte, diskursive und transdisziplinäre Auseinandersetzung die Vielzahl an Codes zu Kategorien zusammengefasst werden konnte. Unter dem übergeordneten Aspekt des Teilhabeverständnisses wurde eine Zusammenführung von Theorie und Empirie ermöglicht und eine Auswertung des Materials unter diesen Perspektiven sichergestellt. So entstand zum einen das sogenannte Bedürfnisspektrum, welches die verschiedenen (teilhabeorientierten) Bedürfnisse von Menschen mit Komplexer Behinderung abbildet, und zum anderen ein Katalog von Anforderungen, die sich (daraus) für die Gestaltung professioneller Unterstützung ergeben. Einen Überblick über die Ergebnisse gibt der Projektbericht (Fornefeld et al., 2020) und weitere Publikationen, die in diesem Zusammenhang zur Veröffentlichung vorbereitet werden.
5.2 Entwicklung von Teilhabeangeboten
Um die Ergebnisse an die beteiligten Personen zurückzugeben, wurden verschiedene Instrumente und Materialien entwickelt, die adressat*innengemäß in die Praxis transferiert wurden. Die Analyse der individuellen (personenbezogenen) Perspektiven und Ergebnisse wurde in Individuellen Teilhabebüchern festgehalten, die neben dem Überblick zum Forschungsprozess individuumsbezogene Erkenntnisse zu Kommunikations-, Teilhabe- und Unterstützungsmöglichkeiten beinhalten und an die professionellen Unterstützer*innen übergeben wurden. Hierzu wurde jeweils eine weitere Fallwerkstatt durchgeführt, zu der alle Beteiligten eingeladen waren. Darüber hinaus wurden auf der Basis der Ergebnisse individuelle personenbezogene Teilhabeangebote erstellt, um den angestrebten Theorie-Praxis-Transfer sicherzustellen. Hierbei handelte es sich häufig um Kommunikationsangebote wie Über-mich-Bücher, Entscheidungshilfen, aber auch persönliche Geschichten oder musikalische Beiträge. Die so entwickelten und auf Basis der Bedürfnisse und Aneignungsmöglichkeiten der Betroffenen gestalteten, individuellen und teilhabeorientierten Angebote wurden im Anschluss an die Fallwerkstätten mit den Studienteilnehmer*innen durchgeführt und dem Unterstützungsnetzwerk überlassen.
5.3 Evaluation der Ergebnisse in Theorie und Praxis
Neben der Präsentation der Ergebnisse in der Forschungswerkstatt wurden zwei weitere Diskurs- und Evaluationsphasen durchgeführt. So wurde im Rahmen einer internationalen Tagung (siehe dazu Fornefeld et al., 2020, S. 58) eine wissenschaftliche Evaluation durchgeführt. Zusätzlich fand an einem projektinternen Fachtag ein transdisziplinärer Austausch mit Teilnehmenden aus verschiedenen Einrichtungen der beteiligten Projektpartner*innen statt, um Möglichkeiten eines Transfers der Ergebnisse auf die Praxis zu überprüfen.
6 Fazit
Mit dem Forschungsprojekt Teilsein & Teilhaben wurde neben den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Teilhabe des Personenkreises Menschen mit Komplexer Behinderung ein Beitrag zum Diskurs einer teilhabeorientierten Forschung mit diesem Personenkreis angestrebt. Für den deutschsprachigen Raum gilt leider immer noch häufig, dass Menschen mit Komplexer Behinderung aus teilhabeorientierten Forschungsprozessen exkludiert und in der Partizipativen Forschung nur marginal berücksichtigt werden (vgl. Keeley et al., 2019). Die Erfahrungen des Forschungsprojekts beweisen, dass ein solcher Ausschluss vermieden werden kann, indem die Beteiligung aller an allen Prozessen des Forschungsgeschehens Beteiligten in achtsamer Weise gestaltet wird. Ein wichtiger Faktor ist der Einbezug möglichst vieler Unterstützer*innen aus den Lebenswelten des Personenkreises, um authentische und fundierte Grundlagen für ein teilhabeorientiertes Forschungssetting zu schaffen. Entsprechend des Teilhabeverständnisses des Projekts zeichnete sich die Untersuchung in allen Erhebungsphasen durch die Ermöglichung der aktiven Beteiligung des Personenkreises am Feldgeschehen und das Mit(er)leben der Alltagswelt der Menschen mit Komplexer Behinderung durch die Forschenden aus.
Aus den Erfahrungen des Projekts lassen sich weitere Implikationen für die (Partizipative) Teilhabeforschung ableiten. So sind zunächst „teil-partizipative Anstrengungen, in denen eine intensive Partizipation vorerst begründet auf eine bestimmte Phase oder einen bestimmten Bereich des Projektes reduziert wird“ (Keeley et al., 2019, S. 100) als erster wichtiger Schritt zur Sicherung einer stärkeren Beteiligung des Personenkreises als sinnvoll einzuschätzen. Perspektivisch können so barrierefreie Methoden weiterentwickelt und damit auch Qualitätsaspekte Partizipativer Forschung vertieft werden (vgl. Gebert, 2014, S. 267). In der übergreifenden Zusammenführung verschiedener Disziplinen und ihren Forschungstheorien (soziologisch, pädagogisch, kommunikationstheoretisch etc.) liegt die zukünftige Chance, innovative und kreative Zugänge weiterzuentwickeln und zu optimieren, um eine stärkere Beteiligung von Menschen mit Komplexer Behinderung an Forschungsprojekten zu ihrer Lebenssituation voranzutreiben.
Neben forschungsmethodischen Entwicklungsprozessen sind es aber auch methodologische Überlegungen, die Forschende in diesem Bereich in den nächsten Jahren kritisch diskutieren und weiterentwickeln sollten. So erscheint das Moment der Selbstreflexion als übergeordnet wichtig, zum einen bezogen auf das individuelle Handeln der einzelnen Forscher*innen, „zum andern muss der Prozess des Forschens in seiner Gestalt, mit seinen Grenzen, den unterschiedlichen Interessenslagen aller beteiligten Akteure und deren Beziehung zueinander permanent reflektiert werden“ (Keeley et al., 2019, S. 100). So könnte es gelingen, die „Reproduktion von Machtungleichgewichten aufzuweichen“ (vgl. Kremsner, 2017, S. 140), was einen wesentlichen Beitrag gerade im Kontext Partizipativer Forschung darstellen würde.
Einen weiteren signifikanten Schwerpunkt bildet die zunehmende Auseinandersetzung mit forschungsethischen Fragen in teilhabeorientierten Forschungsprozessen, um diese forschungsmethodisch fundiert und forschungsmethodologisch reflektiert zu gestalten.
Alle diese Schritte führen in ihren unterschiedlichen Bereichen zu einer stärkeren Beteiligung von Menschen mit Komplexer Behinderung (auch) an Forschungsprozessen, die vor allem unter der Perspektive teilhabeorientierter Forschung als zwingend notwendig erscheint.
Notes
- 1.
Zum Projektteam gehörten Prof. Dr. Barbara Fornefeld, Dr. Caren Keeley, Timo Dins, Stefanie Smeets und Alexandra Schaad. Gefördert wurde das Projekt durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und unterstützt durch KUBUS e. V.
- 2.
- 3.
Schriftliche Befragungen als Methode qualitativer Sozialforschung bieten wie qualitative Interviews subjektive „Einblicke in nicht direkt beobachtbare psychische Prozesse oder Strukturen der befragten Personen (z. B. Meinungen, Einstellungen, Denkprozesse, Wissen)“ (Hussy et al., 2010, S. 68 zit. n. Herfter & Brock, 2013, S. 251). Zur Generierung dieser Äußerungen werden teil- oder halbstrukturierte Fragebögen mit offenen Fragen eingesetzt, die die Befragten in eigenen Worten schriftlich beantworten. Sie bilden damit das Pendant zu qualitativen Interviewleitfäden.
- 4.
Zur Theorie der Gabe siehe Fornefeld (2019).
Literatur
Damm, R. (2016). Einwilligungsunfähige Personen. Rechtskonzept der Einwilligungsfähigkeit und Teilhaberecht. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 59 (9), 1075–1084. doi: https://doi.org/10.1007/s00103-016-2396-6
Dederich, M. (2017). Ethische Aspekte der Forschung an Menschen mit geistiger Behinderung. Teilhabe, 56(1), 4–10.
Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. 5. Aufl. Berlin: Springer.
Flick, U. (2002). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 6. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Fornefeld, B., Keeley, C., Dins, T., Smeets, S., & Schaad, A. (2020). Abschlussbericht des Modellprojektes „Teil sein & Teil haben“®. Köln. doi: https://doi.org/10.18716/kups.11815
Fornefeld, B. (2019). Teilhabe ist Gabe. Zum Verständnis von Teilhabe im Kontext von Erwachsenen und alternden Menschen mit komplexer Behinderung. Teilhabe, 58 (1), 4–9.
Fornefeld, B. (Hrsg.) (2008). Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik. München: Reinhardt.
Friebertshäuser, B., & Panagiotopoulou, A. (2013). Ethnographische Feldforschung. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 4. Aufl. (S. 301–322). Weinheim: Beltz Juventa.
Fuhse, J. (2018). Soziale Netzwerke. Konzepte und Forschungsmethoden. 2. Aufl. Konstanz: UTB.
Gebert, T. (2014). Partizipative Forschung mit Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Im Spannungsfeld von Teilhaberecht und Wissenschaftlichkeit. Behindertenpädagogik, 53 (3), 251–272.
Geertz, C. (1983). Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Gehrau, V., & Weischer, C. (Hrsg.). (2017). Die Beobachtung als Methode in der Soziologie. Konstanz: UTB.
Halbmayer, E., & Salat, J. (o.J.). Qualitative Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie (Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Universität Wien). http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/qualitative/qualitative-sitemap.html. Zugegriffen: 30. Januar 2017.
Hauser, M. (2016). Qualitätskriterien für die Inklusive Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. In T. Buchner, O. Koenig & S. Schuppener (Hrsg.), Inklusive Forschung. Gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten forschen (S. 77–98). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Herfter, C., & Brock, M. (2013). Der Fragebogen. In B. Drinck (Hrsg.), Forschen in der Schule. Ein Lehrbuch für (angehende) Lehrerinnen und Lehrer (S. 251–299). Opladen: UTB.
Höfer, R., Keupp, H., & Straus, F. (2006). Prozesse sozialer Verortung in Szenen und Organisationen. Ein netzwerkorientierter Blick auf traditionale und reflexiv moderne Engagementformen. In B. Hollstein & F. Straus (Hrsg.), Qualitative Netzwerkanalyse. Konzepte, Methoden, Anwendungen (S. 527–538). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Hoffmann, B., & Pokladek, G. (2010). Das spezielle Arbeitsbündnis in qualitativen Forschungswerkstätten. Merkmale und Schwierigkeiten aus der Perspektive der TeilnehmerInnen. Zeitschrift für Qualitative Forschung, 11(2), 197–217.
Keeley, C., Munde, V., Schowalter, R., Seifert, M., Tillmann, V., & Wiegering, R. (2019). Partizipativ forschen mit Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf. Teilhabe, 58 (4), 96–102.
Knoblauch, H., & Schnettler, B. (2007). Videographie. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), Qualitative Marktforschung (S. 585–599). Wiesbaden: Gabler.
Kremsner, G. (2017). Vom Einschluss der Ausgeschlossenen zum Ausschluss der Eingeschlossenen. Biographische Erfahrungen von so genannten Menschen mit Lernschwierigkeiten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Kuckartz, U. (2016). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.
Lamnek, S., & Krell, C. (2005). Qualitative Sozialforschung. 4. Aufl. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. 4. Aufl. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
Straus F. (2010). Netzwerkkarten – Netzwerke sichtbar machen. In C. Stegbauer & R. Häußling (Hrsg.), Handbuch Netzwerkforschung (S. 527–538). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Unger, H. von (2014). Forschungsethik in der qualitativen Forschung. Grundsätze, Debatten und offene Fragen. In: H. von Unger, P. Narimani & R. M'Bayo (Hrsg.), Forschungsethik in der qualitativen Forschung. Reflexivität, Perspektiven, Positionen (S. 15–39). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Watson, J. (2016). The right to supported decision-making for people rarely heard (PhD thesis, Deakin University). http://dro.deakin.edu.au/view/DU:30088820. Zugegriffen: 15. Dezember 2020.
Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer (2016). Stellungnahme zur Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsassistenz in der Medizin. http://www.zentrale-ethikkommission.de/downloads/StellEntscheidung2016.pdf. Zugegriffen: 21. September 2018.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Keeley, C. (2022). Zugänge zur Teilhabeforschung mit Menschen mit Komplexer Behinderung: Methodologische und methodische Überlegungen zur Beteiligung eines nicht berücksichtigten Personenkreises. In: Wansing, G., Schäfers, M., Köbsell, S. (eds) Teilhabeforschung – Konturen eines neuen Forschungsfeldes. Beiträge zur Teilhabeforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38305-3_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-38305-3_12
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-38304-6
Online ISBN: 978-3-658-38305-3
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)