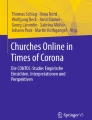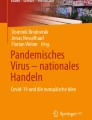Zusammenfassung
Dieses Kapitel ordnet die volkswirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie ein. Dabei werden zunächst die Wertschöpfungsverluste, die sich auf mehrere hunderte Milliarden Euro beziffern lassen, in der Systematik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung betrachtet. Obwohl die kurzfristigen Schäden wie Einkommens- oder Beschäftigungsverluste der Pandemie quantifiziert werden können, sind die langfristigen Auswirkungen auf das Wachstumspotenzial in Deutschland nur abzuschätzen. Der Ausbruch der Pandemie in 2020 wirkt im Vergleich zur Finanzkrise von 2009 wie ein exogener globaler Schock, der strukturelle Veränderungen in der Volkswirtschaft auslöst, ohne selbst dort verursacht zu sein. Die langfristigen ökonomischen Auswirkungen sind vor allem angebotsseitig und haben im Jahr 2021 bereits zu deutlichen Bremseffekten beim Wirtschaftswachstum geführt. Schon jetzt ist aber absehbar, dass „Narbeneffekte“ in der Ökonomie über die Pandemie hinaus entstanden sind.
Ergänzend dazu werden wichtige ökonomische und soziale Folgewirkungen wie Bildungsverluste, der Anstieg der Staatsquote oder der Verlust an Lebensjahren durch die Lockdown-Maßnahmen erörtert. Auch wenn genaue Abschätzungen dieser Effekte nur schwer möglich sind, werden diese post-Corona für eine umfassendere Einordnung der Pandemieschäden notwendig werden.
Abschließend werden die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Kohäsion überblicksartig aufgeführt, um den Blick über die rein messbaren volkswirtschaftlichen Größen hinaus zu öffnen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene gesellschaftliche Erosionspotenziale hervorgehoben, wobei es sich hier nur um eine Momentaufnahme handelt.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
1 Ökonomische Schäden
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020 haben sich substanzielle Wertschöpfungsverluste ergeben − bedingt unter anderem durch die Lockdown-Maßnahmen.
1.1 Kurzfristige Wertschöpfungsverluste in der Systematik der VGR
Nach einer Schätzung von Grömling et al. (2021) belaufen sich diese Wertschöpfungsverluste auf bereits über 300 Milliarden Euro. Das preisbereinigte BIP ist im Jahr 2020 mit 4,6 Prozent fast so stark wie nach der Finanzkrise eingebrochen. Im Gegensatz zur Finanzkrise brachte die Pandemie aber auch Beschäftigungsverluste mit sich, die wiederrum Einkommenslücken hinterlassen haben. Auch wenn durch umfangreiche Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld eine stärkere Zunahme der Arbeitslosigkeit verhindert werden konnte, lag die Erwerbstätigenquote im Jahr 2020 rund einen Prozentpunkt unter dem Wert des Vorjahrs. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen war zwischenzeitlich im Jahr 2020 um 4,7 Prozent zurückgegangen und damit so stark eingebrochen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Im April 2020 hatte das konjunkturelle Kurzarbeitergeld mit knapp sechs Millionen Anträgen den Höhepunkt erreicht.
Der Wirtschaftseinbruch hat die einzelnen Sektoren aber mit unterschiedlicher Härte getroffen. Abb. 4.1 zeigt den Effekt des exogenen Corona Schocks in der Logik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR von zwei Seiten: Der Entstehungsseite und der Verwendungsseite. Dabei zeigt sich eine fortschreitende Spaltung der Volkswirtschaft während des Pandemieverlaufs. Während die Auswirkungen des ersten Lockdowns im zweiten Quartal 2020 besonders das Verarbeitende Gewerbe, die sonstigen Dienste (zum Beispiel Kultur- und Freizeitwirtschaft) oder die unternehmensnahen Dienstleistungen deutlich getroffen haben, konnte die Bauwirtschaft, die Finanzwirtschaft aber auch das Wohnungswesen nahezu durchgehend die wirtschaftliche Aktivität von 2019 aufrechterhalten.
Eine große Errungenschaft war das Offenhalten der Industrie trotz der sonstigen Lockdown-Maßnahmen im zweiten Halbjahr 2020, da hier die Wertschöpfungsverluste wegen der Hub-Funktion des Verarbeitenden Gewerbes über Netzwerke, Cluster und Lieferbeziehungen mit dem Dienstleistungssektor besonders stark gesamtwirtschaftlich durchgeschlagen hätten. Aber auch innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes kam es zu einer deutlichen Spaltung. Während mit Ausnahme des Maschinenbaus große Teile der Industrie bereits zum Jahresende 2020 die Einbußen weitgehend kompensieren konnte, durchlebte die Automobilindustrie mit Ihren vielfältigen Verflechtungen im Industrie- und Dienstleistungssektor im ersten Halbjahr 2021 einen weiteren enormen Produktionsrückgang, der zu einer tiefen Rezession in diesem Bereich führte (Grömling et al. 2021).
Die industrielle Rezession bestand aber schon vor der Corona-Pandemie und ist Ausdruck struktureller Anpassungslasten – bedingt durch technologische Veränderungen, Präferenzverschiebungen sowie geopolitische Rahmenbedingungen (Hüther et al. 2021).
Exemplarisch können dafür die Corona Effekte als auch die strukturellen Veränderungen am deutschen Arbeitsmarkt überblicksartig dargestellt werden. Im Vergleich zu anderen Krisen bleibt in der Pandemie der volkswirtschaftliche Kapitalstock weitgehend stabil, es kommt aber mit Verzögerung zu Lieferengpässen und zu einer Verknappung des Arbeitsangebots, woraus sich mittelfristige Auswirkungen auf den Potenzialoutput ergeben. Obwohl eine hohe Arbeitslosenquote im Jahr 2020 durch den extensiven Einsatz von Kurzarbeitergeld verhindert werden konnte, kam es zu mehreren strukturell wirksamen Veränderungen.
Einerseits haben Unternehmen in großem Umfang auf Neueinstellungen verzichtet; viele Weiterbildungsmaßnahmen als auch Ausbildungsverhältnisse sind entweder auf Eis gelegt worden oder überhaupt nicht zustande gekommen. Andererseits haben viele Arbeitnehmer sich während der Krise eine neue Beschäftigungsperspektive gesucht und die Branche gewechselt. Aktuell steht die Arbeitslosenrate mit etwa 5,4 Prozent fast so niedrig wie vor der Corona Krise und im Juli 2021 kam es zum stärksten Rückgang der Arbeitslosenquote (um etwa 90.000 Personen) seit den Hartz Reformen. Es deutet also vieles darauf hin, dass der schon länger diagnostizierte Fachkräftemangel bereits wieder dominiert und wir in den nächsten Jahren einen zunehmenden Mangel an Arbeitskräften sehen werden, der die Angebotsproblematik zusätzlich verschärft und das Wirtschaftswachstum restringiert. Hinzu kommt, dass während der Corona Krise die Zuwanderungen deutlich gesunken sind. Die allgemein bekannte aber in der Politik überhaupt nicht diskutierte Herausforderung des demografischen Wandels wird dadurch verschärft. So werden uns bis 2030 über drei Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter verloren gehen und ambitionierte Reformen zur Hebung der Arbeitskräftepotenziale in Deutschland notwendig machen (Hüther et al. 2021).
Auf der Verwendungsseite der VGR sehen wir, dass uns bisher vor allem der anziehende Welthandel und dadurch steigende Exporte als auch ein erhöhter Staatskonsum durch die Krise getragen haben. Während die Exporte um 77 Prozent des Ausgangsniveaus von 2019 eingebrochen waren, liegen sie im Herbst 2021 nur noch drei Prozent darunter. Die expansive Fiskalpolitik hat den Staatskonsum ab dem zweiten Quartal 2020 um über vier Prozent über das Niveau von 2019 ansteigen lassen und einen positiven Impuls für die konjunkturelle Belebung gehabt.
Allerdings haben die Konjunkturpakete zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie auch eine klaffende Lücke im Haushalt hinterlassen. Lag die Schuldenstandquote Ende 2019 noch unterhalb des Maastricht Kriteriums von 60 Prozent, könnte Sie Ende 2021 bei etwa 75 Prozent liegen. Beim privaten Konsum markiert das Jahr 2020 insgesamt betrachtet den größten Einbruch in Deutschland in den letzten Dekaden; das Infektionsgeschehen und die Geschäftsrestriktionen haben diesen im Jahr 2020 um etwa 7 Prozent im Schnitt zurück gehen lassen. Hier wird besonders das Auflösen der krisenbedingten Ersparnisse und dessen Effekte auf den Inlandskonsum im letzten Drittel des Jahres 2021 in Deutschland aber auch in den USA und Ländern der Eurozone zu beobachten sein. In den USA kommt hinzu, dass die Fiskalpakte zur Corona-Bekämpfung noch einmal deutlich umfangreicher als hierzulande waren, was bereits einen Konsumboom seit Anfang des Jahres ausgelöst hat.
Ein großes Problem zeigt sich im nach wie vor stark beeinträchtigen Niveau der Ausrüstungsinvestitionen. Während die gut laufende Bauwirtschaft auch auf der Verwendungsseite sichtbar wird, konnte die im zweiten Quartal 2020 entstandene Lücke bei den Ausrüstungsinvestitionen aufgrund der vorherrschenden pandemiebedingten Verunsicherungen nicht geschlossen werden und hat sich im Jahr 2021 weiter verhärtet. Ob und inwieweit eine Normalisierung der Investitionstätigkeit stattfinden wird, hängt davon ab, wie hartnäckig die vielseitigen aktuellen Angebotsbeschränkungen die Investitionsneigung bei den Unternehmen weiter dämpfen werden. Das setzt nicht nur eine Verfügbarkeit von Vorleistungsgütern, sondern auch eine investitionsfreundliche Wirtschaftspolitik der neuen Bundesregierung am Standort Deutschland voraus.
Im Vergleich zur Finanzkrise hat sich der Welthandel deutlich schneller erholt als zunächst erwartet (vgl. dazu Abb. 4.2).
Hatte es im Nachgang der Finanzkrise fast zwei Jahre gebraucht, bis das Vorkrisenniveau erreicht war, ist die erhoffte V-Entwicklung während der Corona Krise zumindest beim Welthandel eingetreten. So war im Januar 2021 das Vorkrisenniveau bereits erreicht worden. Die wachsende Divergenz zwischen Nachfrage und Produktion signalisiert aber zunehmend ausgeprägte Angebotsrestriktionen im Jahr 2021. So haben Vorleistungsengpässe, aber auch der schnell wieder spürbare Mangel an Arbeitskräften und vor allem Fachkräften in den konsumnahen Branchen wie der Gastronomie oder der Logistikbranche die wirtschaftliche Erholung im 1. Halbjahr 2021 bisher gebremst.
Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll, können aber nur mit Verzögerungen abgearbeitet werden. Der Halbleitermangel ist nur ein Beispiel der vielfältigen Beschaffungsprobleme, mit denen sich deutsche Unternehmen gerade befassen müssen. Die außergewöhnlichen Anpassungslasten auf der Angebotsseite − vor allem in der Industrie und Bauwirtschaft − haben sich auch in der Preisentwicklung – vor allem bei Import und Erzeugerpreisen – niedergeschlagen und dem Thema Inflation im Jahr 2021 eine hohe Bedeutung verliehen. Im September wird der Verbraucherpreisindex voraussichtlich bei 4,1 Prozent liegen, nachdem die Inflationsrate im August schon bei 3,9 Prozent lag. In der Spitze könnten noch Werte von fünf Prozent erreicht werden.
Im Rückblick zeigt sich, dass die Pandemie in unterschiedlicher Weise die volkswirtschaftliche Angebotsseite und Nachfrageseite beeinträchtigt hat: Der Pandemieschock im Frühjahr 2020 verursachte über eine Stillstandsökonomie einen symmetrischen Angebots- und Nachfrageschock. Mit dem Lockern des ersten Lockdowns lösten sich – fiskalpolitisch weltweit gestützt – die Nachfrageprobleme und ermöglichten ein Hineinwachsen der Produktion in die freien Kapazitäten. Infolge des zweiten Lockdowns und den dabei zum Tragen kommenden unterschiedlichen Strategien in Europa (Risikoadaption im Zeichen der Impfkampagne), in Ostasien (Zero-Covid-Politik mit der Folge allfälliger massiver Lockdowns und unzulänglicher Impfung) und in den USA (langes Festhalten an geschlossenen Grenzen) kam es zu massiven angebotsseitigen Störungen der Lieferketten und damit der globalen Wertschöpfungsketten.
1.2 Langfristige ökonomische und soziale Auswirkungen
Schon jetzt ist absehbar, dass ‚Narbeneffekte‘ in der Ökonomie durch die pandemiebedingt harten Lockdownmaßnahmen entstanden sind, die uns noch über das Jahr 2021 hinausbegleiten werden. Während die unmittelbaren Auswirkungen massiv waren und die Ökonomien weltweit hart sowie messbar getroffen haben, sind die langfristigen Folgen nur schwer abzuschätzen. Die strukturellen Anpassungslasten auf der Entstehungsseite umfassen zuerst die Effekte der Pandemie auf das Humankapital und damit verbunden das Arbeitskräftepotenzial im Arbeitsmarkt als auch die fehlende private und öffentliche Investitionstätigkeit in den Kapitalstock.
Die Bildungsverluste spielen eine zentrale Rolle für das zukünftige Wachstumspotenzial. In der Krise wurden Schulen geschlossen, Unterricht in den Universitäten fand vorwiegend online statt und viele Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen konnten nicht durchgeführt werden. Es wurden digitale Missstände an Schulen und Universitäten deutlich. Der entstandene Bildungsverlust als auch die zunehmende Bildungslücke zwischen bildungsfernen und bildungsnahen Elternhäusern wird nachhaltige Folgen für das zukünftige Humankapital der Volkswirtschaft in Deutschland haben.
Die UN schätzt, dass allein im Jahr 2020 weltweit mehr als 90 Prozent der Schulen geschlossen waren, was in etwa 1,57 Milliarden Kinder betroffen hat. Zwar fand in vier von fünf Ländern Fernunterricht statt, doch gleichwohl wurden 500 Millionen Kinder weltweit von dieser Möglichkeit ausgeschlossen (Joffe 2021).
Azevedo et al. (2021) haben versucht, den Effekt von Schulschließungen zu beziffern und finden dabei, dass ein weltweiter Schulausfall von fünf Monaten zu Lernverlusten führen könnte, die einen Gegenwartswert von zehn Billionen US-Dollar haben. Hinzu kommt die Verschärfung von Ausgrenzungen und Ungleichheiten durch Schulschließungen bei vulnerablen Gruppen wie ethnischen Minderheiten, Menschen mit Behinderung und Mädchen. Diese Gruppen sind von Schulschließungen stärker betroffen.
In Krisen entwickelt sich die Investitionstätigkeit in der Regel prozyklisch, was problematisch ist für die mittelfristigen Wachstumsaussichten sowie die zukünftige Innovationsfähigkeit. Positiv zu bewerten ist, dass sowohl die Konjunkturpakete in Deutschland aus dem Sommer 2020 als auch der nun umzusetzende EU-Wiederaufbaufonds „NextGenerationEU“ mittelfristig angelegte Investitionsprogramme enthalten, die dazu beitragen können, dass die Volkswirtschaften aus der Krise herauswachsen (Hüther und Jung 2021).
Seit langem bestehen aber vielfältige öffentliche Investitionsbedarfe in die physische Infrastruktur zur Bewältigung des Klimawandels als auch für den Ausbau der digitalen Netzwerke. Diese transformatorischen Aufgaben stehen einer langen Phase unzureichender öffentlicher Investitionstätigkeit gegenüber. Das preisbereinigte Bruttoanlagevermögen der Gemeinden, welche Hauptträger der öffentlichen Investitionen sind, lag 2019 nur fünf Prozent höher als 2000 (Hüther und Jung 2021).
Es bleibt offen, wie unter dem straffen Korsett der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse die geschätzten jährlichen Investitionsbedarfe von etwa 45 Milliarden Euro geschultert werden können. Ein Ansatz stellt hierbei der auf zehn Jahre angelegte Deutschlands- oder Investitionsfonds des Bundes dar. Dieser könnte als rechtlich selbstständige Person mit eigener Kreditermächtigung einen transparenten und verlässlichen Rahmen für nachhaltige öffentliche Investitionen schaffen.
Die Corona-Pandemie hat auch den strukturellen Wandel in den einzelnen Sektoren beschleunigt. So zeichnet sich ein Strukturwandel im privaten und sozialen Konsum ab, der bereits vor der Pandemie stattfand, sich nun aber nochmals verschärft hat. Der Umsatz von Geschäftsmodellen im Einzelhandel, die sich auf den Versand und den Vertrieb über das Internet spezialisiert haben, ist bereits seit 2015 stark gestiegen und hat während der Pandemie nochmals neue Wachstumsrekorde verzeichnet. Von Januar 2020 bis April 2021 ist der Umsatz im Versand- und Internet-Einzelhandel um rund 58 Prozent angestiegen. In der gleichen Zeit ist der Umsatz in Verkaufsräumen (ausgenommen Nahrungsmittel) im Einzelhandel um etwa 27 Prozent gesunken. Damit einhergehend wird ein Aussterben der Innenstädte befürchtet, allerdings hat sich das in den Immobilienpreisen bisher nicht gezeigt. Diese sind mit wenigen Ausnahmen auch während der Pandemie weiter gestiegen. Zudem haben kulturelle Veranstaltungen, Messen und Sportevents nach anderen Formaten suchen müssen; noch ist unklar, ob und wie die Rückkehr zu dem Vorkrisenniveau gelingen wird. Das gilt auch für den Tourismus und generell das Reiseverhalten.
Im Pandemiejahr 2020 hat es einen beachtlichen Anstieg der Staatsquote – gemessen als Ausgaben des Staates in von Hundert des BIP – gegeben. Während die Staatsquote im Jahr 2019 noch bei etwas mehr als 45 Prozent lag, ist sie im darauffolgenden Jahr sprunghaft auf über 51 Prozent angestiegen (Hüther und Jung 2021).
Ganz im Sinne der historischen Analyse von Peacock und Wiseman (1961) kann ein sogenannter „Displacement-Effekt“ beobachtet werden, demnach ein geringerer Steuerwiderstand oder Widerstand gegen verstärkte Verschuldung in Krisenzeiten zu höheren Staatsquoten führt. Dabei handelt es sich historisch betrachtet meistens um eine Niveauverschiebung, die meist nach der Krise infolge von Remanenzeffekten bestehen bleibt. Übernimmt der Staat langfristig einen höheren Anteil an der gesamten Wertschöpfung, hat dies weitreichende Folgen für die Organisation in der Marktwirtschaft. Dazu gehört beispielsweise die Effizienz der Güterallokation, die Abhängigkeit der Lieferketten vom Staat und eine erhöhte Lenkungswirkung auf die Unternehmen. Somit könnte die Innovationsfähigkeit der Unternehmen zukünftig stark eingeschränkt sein.
Sumner et al. (2020) versuchen, die Auswirkungen der globalen BIP-Kontraktion durch die Corona-Pandemie auf die internationalen Armutsgrenzen zu bestimmen. Die Schätzungen zeigen, dass die weltweite Armut erstmals seit 1990 wieder ansteigen könnte, und je nach Armutsgrenze könnte dieser Anstieg eine Umkehrung der weltweiten Fortschritte bei der Armutsbekämpfung um etwa ein Jahrzehnt bedeuten. In Regionen wie dem Nahen Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika könnten die negativen Auswirkungen manche Länder auf das Armutsniveau vor 30 Jahren zurück katapultieren.
Neben den vielfältigen langfristigen ökonomischen Auswirkungen gilt es, einen Blick über die rein messbaren volkswirtschaftlichen Größen hinaus zu werfen. Auch wenn die sozialen Auswirkungen schwer abzuschätzen sind, spielen sie eine wichtige Rolle durch ihre Interdependenzen mit dem Sozialkapital und dem Humankapital in einer Volkswirtschaft als auch für die gesellschaftliche Kohäsion, die wir im nächsten Abschnitt noch darstellen werden.
Langfristige Folgen von erhöhter Einsamkeit und Isolation durch die Corona-Pandemie und daraus resultierende Lockdown-Maßnahmen sind beachtlich, denn sozialer Kontakt war unerwünscht und zugleich waren viele soziale Orte (Unternehmen, Schulen etc.) geschlossen. Räumliche und soziale Isolation können insbesondere zu einer starken Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Alzheimer- und demenzkranken Patienten beitragen. Hinzu kommt, dass wichtige Operationen und Krebsbehandlungen aufgeschoben worden sind und eine deutliche Zunahme von Suiziden und Depressionen beobachtet werden konnte. Daten aus den USA zeigen, dass die Pandemie und die darauf gefolgte Rezession mit einem Anstieg von zehn bis 60 Prozent von Todesfällen durch Verzweiflung (Suizid, Drogen-Überdosis etc.) im Jahr 2020 einhergegangen ist (Mulligan 2020).
Auch konnte für die USA gezeigt werden, dass die durch Covid-19 verursachte Rezession wahrscheinlich langfristige Effekte auf die Mortalität und Lebenserwartung der Bevölkerung hat (Bianchi et al. 2020).
Ausgegangen wird hier von mehr als 0,8 Millionen zusätzlichen Toten in den nächsten 15 Jahren bedingt durch die wirtschaftliche Rezession.
Untersuchungen belegen, dass soziale Isolation oder Einsamkeit die körperliche und geistige Gesundheit, die kognitive Leistungsfähigkeit und die allgemeine Lebenserwartung beeinflusst (Spreng et al. 2020).
Ein ebenfalls wenig beachteter Aspekt von freiheitseinschränkenden Maßnahmen ist der Verlust von Lebensqualität. Freiheitsentzug durch Zwangsmaßnahmen wie Ausgangssperren, Einschränkungen in Konsum- und Reisefreiheiten und weniger soziale Kontakte hat direkte Effekte auf die Stimmung und Lebensqualität der Bevölkerung (Greyling et al. 2020).
In einem Umfrageexperiment zeigen Windsteiger et al. (2021), dass die individuelle Präferenz für Freiheit im Zusammenhang mit einschränkenden Maßnahmen eine gute Erklärung für den Verlust von subjektiver Lebenszufriedenheit darstellt. Darüber hinaus tritt der Zufriedenheitsverlust insbesondere dann ein, wenn Menschen Informationen über die (oft überschätzt) dargestellte Letalität von Covid-19 erhalten.
2 Gesellschaftliche Kohäsion
Das gesellschaftspolitische Spannungsfeld divergenter Ansprüche an staatliches Handeln in einer pandemiebedingten Ausnahmesituation liegt damit auf der Hand, da der Staat am Versuch, einen absoluten Gesundheitsschutz zu bieten, zwangläufig scheitern muss (Bardt und Hüther 2021).
Denn auch mit strikten Lockdowns oder einer „Zero-Covid“-Strategie, die die Gesundheitsrisiken einer Covid-19 Erkrankung minimieren sollen, werden nicht nur ökonomische Kollateralschäden in Kauf genommen, sondern ergeben sich wie oben diskutiert eben auch schwerwiegende gesundheitliche Nebenwirkungen. Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, bei der Entscheidung über gesundheitspolitische Maßnahmen Abwägungen anzustellen, indem aktiv Kosten-Nutzen Überlegungen gemacht werden (Obst und Schläger 2021).
Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen entwickeln jedoch aus ihren jeweiligen Lebensrealitäten heraus eine unterschiedliche Risikowahrnehmung. Die Moralisten des Lockdowns, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben um jeden Preis zum Stillstand zu bringen versuchen, und die Corona-Leugner, die eine Existenz der Pandemie grundsätzlich in Frage stellen, bilden dabei die Extrempole. Die Unversöhnlichkeit, mit der die unterschiedlichen Interessen aufeinanderprallen, ist eine der gesellschaftspolitisch schmerzhaften Beobachtungen, die sich durch den Pandemieverlauf zieht.
In Deutschland stieß die harte Eindämmungspolitik im Frühjahr 2020 und deren sukzessive Lockerung über den Sommer auf breiten Zuspruch in der Bevölkerung: In einer Umfrage des Pew-Research Instituts aus 2020 rangiert Deutschland, wo 88 Prozent der Befragten angeben, „das Land habe im Umgang mit der Pandemie einen guten Job gemacht“, im internationalen Vergleich am oberen Ende der Skala, vgl. dazu Abb. 4.3.
„Das eigene Land hat […] einen guten Job gemacht.“ (Angaben in v. H., Quelle: eigene Darstellung; vgl. Devlin und Connaughton 2020)
Trotz dieser grundsätzlich positiven Einschätzung der Krisenpolitik – was sich im Pandemieablauf indes deutlich verschlechterte – sehen die Befragten die gesellschaftliche Kohäsion wesentlich kritischer. In Deutschland geben lediglich 39 Prozent an, „das Land sei jetzt vereinter als vor dem Ausbruch der Pandemie“. Der Anteil derjenigen, die eine weitere Spaltung der Bevölkerung wahrnehmen, steigt im Jahr 2021 auf 77 Prozent (Devlin et al. 2021).
Im internationalen Vergleich schneiden lediglich die USA unter Präsident Trump mit ihrer auf Konfrontation ausgerichteten Pandemiepolitik deutlich schlechter ab, vgl. Abb. 4.4.
„Das Land ist jetzt vereinter als vor dem Ausbruch der Pandemie.“ (Angaben in v. H.; Quelle: eigene Darstellung; vgl. Devlin und Connaughton 2020)
Ein großer Kritikpunkt lautet, die Parlamente hätten die Kritik an der außerordentlichen Corona-Politik nicht in angemessenem Maße gespiegelt und so das Vertrauen unterschiedlicher Gruppen verspielt. Inwiefern dies tatsächlich der Fall war, darüber wird nicht zuletzt politikwissenschaftlich leidenschaftlich gestritten (Florack et al. 2021).
In jedem Fall bestätigte sich die These der Krise als „Stunde der Exekutive“, die in den Vordergrund trat, nachdem sie über Notfallverordnungen neue Entscheidungsbefugnisse zugeteilt bekommen hatte. Mit den „Querdenkern“ formierte sich zudem eine sichtbare und physisch schlagkräftige Protestbewegung, die mit größeren Demonstrationen auf sich aufmerksam machte. Immer wieder kam es dabei von Coronaleugnern zu Verstößen gegen Masken- und Abstandsgebote. Das gewaltsame Durchbrechen der Absperrungen um den Reichstag stellt den vorläufigen traurigen Höhepunkt dieser sozio-ökonomisch höchst heterogenen Bewegung dar (Nachtwey et al. 2020).
Politisch blieb dieser Corona-Protest hingegen weitestgehend bedeutungslos. Zwar versuchte die Protestpartei „Die Basis“, den „Querdenkern“ politisch eine eigene Plattform zu bieten, doch schaffte sie es nicht, die internen Spannungen einzuhegen, sodass die Partei bei der Bundestagswahl 2021 ohne nennenswerten Erfolg blieb. Auch der Versuch der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, sich den „Querdenkern“ anzubiedern, zahlte sich bei der Wahl nicht in breiten Stimmzuwächsen aus.
Nichtsdestotrotz gehen die gesellschaftspolitischen Spaltungspotenziale weit über die kleinen Gruppen der Coronaleugner und Lockdown-Moralisten hinaus. Obwohl im Herbst 2020 über zwei Drittel der Deutschen das Gefühl artikulierten, es werde genug oder sogar zu viel gegen die Pandemie getan, gaben über die Hälfte der Befragten an, „die Regierung solle weitreichende Maßnahmen ergreifen, auch wenn dadurch der übliche parlamentarische Prozess übergangen wird“. Lediglich ein Viertel der Menschen war dabei nicht bereit, ein solches Übergehen der pluralistischen Verfahren in den Parlamenten in Kauf zu nehmen (Diermeier und Niehues 2021).
Damit zeigt sich, wie aus dem weit fortgeschrittenen Beharren auf der eigenen Wahrnehmung ein kompromissloses Politikverständnis resultiert. Kritisiert wird in diesem Kontext insbesondere die Moralisierung, auf deren Grundlage eine solche wahrgenommene Prävalenz der eigenen Position beruht. Gerade die Forderung nach einer Verwissenschaftlichung der Politik („follow the scientists“ bzw. „follow the science“), bei der die Verfahren der Demokratie an die Erkenntnisse „der Wissenschaftler oder Wissenschaft“ angepasst gehören, ist in ihrem Demokratieverständnis höchst fragwürdig. Nicht nur wird so die Kontingenz des demokratischen Verhandelns in Frage gestellt, das ja zum Ziel hat, um ein vorher unbekanntes Ergebnis zu ringen. Auch verliert sich im Nebel der engen eigenen Präferenzen der Blick auf nachgelagerte Problemfelder (Merkel 2021).
Schließlich verbirgt sich hinter diesen Forderungen nicht zuletzt ein − im Sinne Karl Poppers – höchst fragwürdiges Wissenschaftsverständnis.
Für die Post-Pandemieperiode ist das angespannte gesellschaftspolitische Stimmungsbild eine schwere Last. Nicht nur die starke Einschränkung der Grundrechte, sondern auch die stellenweise stark eingeschränkte Handlungsfähigkeit des Staates haben das Vertrauen in demokratische Institutionen gestört. Die polarisierte Lage hat die Egoismen der eigenen Position gestärkt und wird in Zukunft die politische Kompromissfindung erschweren. Die Fähigkeit zur Kompromissfindung wird jedoch in den kommenden Jahren gefragter sein denn je. Schließlich muss der langfristige Umgang mit Covid-19 gesamtgesellschaftlich angegangen werden. Dann folgen die drängenden Fragen der Dekarbonisierung, des demografischen Wandels sowie des Systemkonflikts mit der chinesischen Volksrepublik. Für all diese Problemlagen bedarf es eines Anerkennens der Pluralität legitimer Ansprüche über den eigenen Tellerrand hinaus. Nach der Pandemieerfahrung fällt es jedoch schwer zu glauben, dass breite Teile der Gesellschaft auf das komplexe demokratische Aushandeln vorbereitet sind.
Notes
- 1.
Siehe auch Grömling 2020.
Literatur
Azevedo, J. P./Hasan, A./Goldemberg, D./Geven, K./Iqbal, S.A. (2021): Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes: A Set of Global Estimates, The World Bank Research Observer, 36 (1), 1–40.
Bardt, H./Hüther, M. (2021): Aus dem Lockdown ins neue Normal, IW-Policy Paper, Nr. 4, Köln.
Bianchi, F./Bianchi, G./Song, D. (2020): The Long-Term Impact of the Covid-19 Unemployment shock on Life Expectancy and Mortality Rates, NBER Working Paper 28304.
Devlin, K./Connaughton, A. (2020): Most approve of national response to COVID-19 in 14 advanced economies. Pew Research Center. Global attitudes & trends. https://www.pewresearch.org/global/2020/08/27/most-approve-of-national-response-to-covid-19-in-14-advanced-economies/, zugegriffen am 30. Nov. 2020.
Devlin, K./Fagan, M./Connaughton, A. (2021): People in Advanced Economies Say Their Society Is More Divided Than Before Pandemic. Pew Research Center. Global attitudes & trends. https://www.pewresearch.org/global/2021/06/23/people-in-advanced-economies-say-their-society-is-more-divided-than-before-pandemic/, zugegriffen am 11. Okt. 2021.
Diermeier, M./Niehues, J. (2021): Demokratische Resilienz in Deutschland? Parlamentarische Verfahrensakzeptanz im Licht individueller Problemwahrnehmung, IW-Trends, 48 (3), S. 89–112.
Florack, M./Korte, K.-R./Schwanholz, J. (2021): Coronakratie, Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Greyling, T./Rossouw, S./Adhikari, T. (2020): A Tale of three countries: How did Covid-19 lockdown impact happiness, http://hdl.handle.net/10419/221748, zugegriffen am 08. Dez. 2021.
Grömling, M. (2020): COVID-19 and the Growth Potential, IW-Report, Nr. 53, Köln.
Grömling, M./Bardt, H./Demary, M./Hüther, M. (2021): Gespaltene Industriekonjunktur in Deutschland, IW-Report, Nr. 34, Köln.
Hüther, M./Diermeier, M./Goecke, H. (2021): Erschöpft durch die Pandemie. Was bleibt von der Globalisierung, Springer, Wiesbaden.
Hüther, M./Jung, M. (2021): Unzureichende Investitionsoffensive, Wirtschaftsdienst 101, 158–161. https://doi.org/10.1007/s10273-021-2866-9, zugegriffen am 28. Okt. 2021.
Joffe (2021): Covid-19: Rethinking the Lockdown Group-think, Frontiers in Public Health (9).
Merkel, W. (2021): Freiheit, Gleichheit, Zusammenhalt – oder: Gefährdet „Identitätspolitik“ die liberale Demokratie? Aus Politik und Zeitgeschichte, 71 (26-27), 4–11.
Mulligan, C. B. (2020): Deaths of despair and the incidence of excess mortality in 2020, NBER working paper, Cambridge.
Nachtwey, O./Schäfer, R./Frei, N. (2020): Politische Soziologie der Corona-Proteste. Grundauswertung. Universität Basel, Institut für Soziologie.
Obst, T./Schläger, D. (2021): Kosten-Nutzen Überlegungen zu Lockdowns – was übersehen wir? Kosten-Nutzen Überlegungen zu Lockdowns, IW-Kurzbericht, Nr. 33, Köln.
Peacock, A. T./Wiseman, J. (1961): The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton University Press.
Spreng, N. R./Dimas, E./Mwilambwe-Tshilobo, L./Dagher, A./Koellinger, P./Nave, G./Ong, A./Kernbach, J. M./Wiecki, T. V./Ge, T./Li, Y./Holmes, A./Yeo, B. T. T./Turner, G. R./Dunbar, R. I. M./Bzdok, D. (2020): The default network of the human brain is associated with perceived social isolation. Nat Commun 11, 6393.
Sumner, A./Hoy, C./Ortiz-Juarez, E. (2020): Estimates Of The Impact Of Covid-19 On Global Poverty, WIDER Working Paper 2020/43, UNU-WIDER, Helsinki.
Windsteiger, L./Ahlheim, M./Konrad, K. (2021): Curtailment of Civil Liberties and Subjective Life Satisfaction, Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2020-05.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Hüther, M. (2023). Volkswirtschaftliche Einordnung der Pandemieschäden. In: Arnold, R., Berg, M., Goecke, O., Heep-Altiner, M., Müller-Peters, H. (eds) Risiko im Wandel. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37071-8_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-37071-8_4
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-37070-1
Online ISBN: 978-3-658-37071-8
eBook Packages: Business and Economics (German Language)