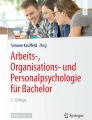Zusammenfassung
Qualifizierungsangebote für schulische Personalentwicklung als Führungsaufgabe werden auf der Grundlage der Beschreibung von Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleitern dargestellt. Die Passung von Aufgaben und Qualifizierung wird untersucht.
Die Befunde zeigen, dass deutliche Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich des Umfangs, des Verpflichtungsgrads und der inhaltlichen Schwerpunkte der Qualifizierungsangebote bestehen. Außerdem zeigt die Analyse, dass die Qualifizierungsangebote nicht alle personalentwicklungsbezogenen Aufgaben abdecken. Insbesondere hinsichtlich einer Qualifizierung für eine valide Unterrichtsbeurteilung und ein wirksames Unterrichtsfeedback bestehen deutliche Lücken.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern
- Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern
- Gestaltung der Schulleiterqualifizierung
- Inhalte der Schulleiterqualifizierung
9.1 Einleitung
Die Funktion und Rolle der Schulleiterin oder des Schulleiters ist in den letzten Jahren verstärkt in Forschungsinteresse der Erziehungs- und Bildungswissenschaften gerückt – nicht zuletzt durch vielfältige Bestrebungen, die Qualität im Schulsystem zu sichern und nachhaltig zu entwickeln (Wissinger 2000). Der Schulleiterin oder dem Schulleiter wird „eine besondere Rolle als Impulsgeber und Gestalter bei der Planung, Initiierung und Begleitung von schulischen Entwicklungsprozessen zugeschrieben“ (Berkemeyer et al. 2015 S. 7). Auch unter dem Einfluss der internationalen Leadership-Debatte seit den 2000er-Jahren wurden neue Führungsaufgaben und -anforderungen sowie veränderte institutionelle Rahmenbedingungen von Schulleiterinnen und Schulleitern differenziert erfasst und beschrieben. Dazu gehören erweiterte Aufgaben und erhöhte Anforderungen wie Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung – zusammengefasst als Schulentwicklung – sowie Personalführung, Kooperation, Organisation und Verwaltung (Meyer et al. 2019).
Durch stetig wachsende Herausforderungen (wie z. B. Lehrkräftemangel, Digitalisierung, Inklusion, Integration, Heterogenität) sowie veränderte Steuerungsprinzipien ergeben sich ein Veränderungsdruck und (neue) Entwicklungserfordernisse für die Schulen, was an die Vorstellung der Schule als lernende Organisation anschließt. Dies hat zum einen Auswirkungen auf das schulische Personal als auch auf das Führungshandeln von Schulleiterinnen und Schulleitern. Aus diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und damit einhergehenden bildungspolitischen Reformen wie der Einführung von Bildungsstandards oder Herausforderungen wie dem Umgang mit Heterogenität und Inklusion ergibt sich ein anhaltender Bedarf an einer Professionalisierung der Lehrkräfte (Berkemeyer et al. 2015 S. 7). Daraus wiederum resultieren auch veränderte Anforderungen an Schulleitungen und neue Führungsaufgaben. Die Personalentwicklung von Lehrkräften wird dabei als ein relevanter Verantwortungsbereich der Schulleitungen betrachtet.
Um diesen schulischen Herausforderungen und Entwicklungserfordernissen gerecht zu werden, ist eine kontinuierliche Qualifizierung und Professionalisierung schulischer Führungskräfte – im Sinne einer systematischen Personalentwicklung – erforderlich.
Zur Professionalisierung von schulischen Führungskräften sind mittlerweile zwar vermehrt empirische Arbeiten entstanden. Gleichwohl ist insbesondere der Bereich der Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern und weiteren schulischen Führungspersonen im nationalen Kontext bislang nicht hinreichend erforscht worden. So liegt bislang keine Zusammenschau von länderspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen in Form einer systematischen Synopse vor.
Diesem Desiderat widmet sich dieses Kapitel. Es wird zunächst auf den internationalen Forschungsstand verwiesen und der nationale Forschungsstand zur Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern skizziert (Abschn. 9.2), bevor die Ergebnisse einer Dokumentenanalyse einschlägiger rechtlicher Regelungen und konzeptueller Dokumente anhand folgender thematischer Gliederungspunkte präsentiert werden:
-
Aufgaben von Schulleitungen im Rahmen von Personalentwicklung zur Sicherung und Entwicklung von Unterrichtsqualität
-
Struktur und Organisation von Schulleitungsqualifizierungen
-
Themen und Inhalte in Schulleitungsqualifizierungen.
Ziel der Analyse ist es, Qualifizierungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter – vor allem hinsichtlich des Anforderungsbereichs Personalentwicklung – für die 16 Länder vergleichend zu erfassen und zu systematisieren. Dabei steht die Verpflichtung zu und die Anerkennung von Qualifizierungsangeboten und -maßnahmen für Schulleiterinnen und Schulleiter im Fokus der Analyse. Berücksichtigt werden ausschließlich Qualifizierungsangebote und -maßnahmen staatlicher Institutionen (wie Landesinstitute, (Kultus-)Ministerien oder Behörden, Akademien/Zentren für Führungskräfteentwicklung); ein breiterer Überblick über Qualifizierungsangebote und –maßnahmen externer, privater bzw. freier Anbieter kann im Rahmen dieser Synopse nicht geleistet werden. Neben konzeptionellen Dokumenten zur Ausgestaltung der Qualifizierungsangebote werden auch Schulgesetze und Dienstordnungen bezüglich Aufgabenbeschreibungen von Schulleiterinnen und Schulleitern betrachtet. Abschließend wird analysiert und diskutiert, ob und inwieweit die Ausgestaltung der Schulleitungsqualifizierungen in den einzelnen Bundesländern auf die gesetzlich definierten Schulleitungsaufgaben zugeschnitten ist.
9.2 Forschungsstand zur Schulleitungsqualifizierung
Ein Überblick zum internationalen Forschungsstand zum Thema Schulleitungsqualifizierung findet sich u. a. bei Huber (2007; 2015), zur spezifischen Situation in der Schweiz kann bei Anderegg und Breitschaft (2020), in Österreich bei Pham-Xuan und Ammann (2020) sowie zur Situation in den USA und in einigen europäischen Ländern (v. a. England) in vergleichender Weise bei Erckrath (2020) nachgelesen werden. Erckrath (2020) unterscheidet verschiedene Länder in Bezug auf den Zeitpunkt und die Verbindlichkeit der Schulleitungsqualifizierung. Zu den Ländern, in denen eine verpflichtende Qualifizierung vor der Übernahme der Schulleitungsposition besteht, zählen zum Beispiel die USA mit dem Modell der Lizensierung durch das Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) oder England mit der National Professional Qualification for Headship durch das National College for School Leadership (NCSL). In einigen deutschsprachigen Ländern (in einigen deutschen Bundesländern, Schweizer Kantonen, Österreich) und Hongkong ist die Qualifizierung für Schulleiterinnen und Schulleiter nach der Amtsübernahme verpflichtend. Darüber hinaus gibt es auch einige Länder, in denen eine vorbereitende Qualifizierung fakultativ ist, wie in manchen deutschen Bundesländern, Schweizer Kantonen, Australien, Neuseeland, den Niederlanden, Schweden oder Dänemark (Erckrath 2020, S. 102 f.). Darüber hinaus bestehen in Österreich und der Schweiz „nicht nur einheitliche Vorgaben, sondern auch klare Strukturen für die Fortbildung“ von Schulleiterinnen und Schulleitern […] wohingegen „die Fortbildungslandschaft in der Bundesrepublik Deutschland eher einem Flickenteppich [gleicht]“ (Klein, E. D. & Tulowitzki, P. 2020 S. 265). Die Autoren konstatieren in diesem Zusammenhang, dass es im Bereich der Schulleitungsqualifizierung bzw. -fortbildung ein „schwer durchschaubares Dickicht an Fortbildungsangeboten gibt, die kaum miteinander verbunden und deren Wirkungen bislang kaum empirisch überprüft sind“ (ebd., S. 271).
Unter den neueren deutschsprachigen Studien sind auch erste Untersuchungen zur Schulleitungsqualifizierung mit Systematisierungscharakter zu verzeichnen. Dazu zählt zum einen die Übersicht von der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT – Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2008), die auf Basis von Interviews mit den verantwortlichen Expertinnen und Experten in den Landesministerien sowie in Landes- bzw. Bildungsinstituten eine Bestandsaufnahme von Aufgaben, Kompetenzprofilen und Qualifizierungen von Schulleiterinnen und Schulleitern in den Bundesländern vornimmt. Eine weitere Übersichtsarbeit liefern Tulowitzki et al. (2019), die die Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern in Deutschland unter Rückgriff auf juristische sowie konzeptionelle Dokumente untersuchen. Diese Untersuchung, die sich auf die Aspekte verpflichtende Angebote, Dauer der verpflichtenden Fortbildungen sowie die Kategorisierung der Fortbildungsinhalte stützt, gibt einen Überblick über die Qualifizierungssituation von Schulleiterinnen und Schulleitern in Deutschland und bietet einen Anknüpfungspunkt für das hier bearbeitete Vorhaben.
Das Thema Qualifizierung ist eng mit der Professionalisierung von Schulleiterinnen und Schulleitern verknüpft und rückte seit Anfang der 2000er-Jahre stärker in die bildungspolitische Diskussion (z. B. Bonsen 2010; Huber 2007; Rosenbusch und Warwas 2007). Die Herausbildung und Anerkennung der Schulleiterin oder des Schulleiters als eigenständiger Beruf begann erst in den 1990er-Jahren mit der Beschreibung des Berufsbildes Schulleiterin oder Schulleiter durch die Arbeitsgemeinschaft der Schulleiterverbände Deutschlands (ASD). Das gab den Anstoß für weitreichende Diskussionen zum konkreten Führungshandeln und zu Qualifizierungswegen, um die erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten für dieses Führungshandeln zu erwerben (Rosenbusch und Warwas 2007). Diese Entwicklungen zogen einen Professionalisierungsschub nach sich und gingen einher mit der Etablierung einer Vorgesetztenfunktion der Schulleiter/innen, die spezifische Verantwortungsbereiche umfasst, in Abgrenzung zu der alten Rolle einer der Lehrkraft mit zusätzlichen Aufgaben (Harazd et al. 2008). Entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen sollten daher darauf abzielen, die Handlungskompetenz in diesen Verantwortungsbereichen zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln (Huber 2007 S. 96 f.). So konstatierte Huber einen Wandel der Schulleitungsqualifizierung in Deutschland hin zu einer zunehmenden Professionalisierung, die sich in einem Zuwachs an Orientierungs- und Qualifizierungsangeboten vor der Amtsübernahme niederschlägt. Hierbei zeigt sich eine „Art Paradigmenwandel in der Sichtweise von schulischer Führungskräfteentwicklung, insbesondere von Schulleitung und Schulleitungsqualifizierung, im Sinne der Anerkennung ihrer zentralen Rolle. Diesem Umdenken liegt die Auffassung von Schulleitung als ‚neuem bzw. eigenständigem Beruf‘ zugrunde, der einen Perspektivenwechsel in vielfacher Hinsicht voraussetzt und der erweiterte Kompetenzen erfordert“ (Huber 2007, S. 103).
In Deutschland ist die Berufsqualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern nicht einheitlich, wie bspw. durch eine verbindliche Ausbildung, geregelt (Rosenbusch 2005; Rosenbusch und Warwas 2007), sondern unterliegt den unterschiedlichen Länderregelungen. Dazu heißt es in der aktuellen Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen, dass „die Länder (…) Maßnahmen zur Qualifizierung und Unterstützung des Führungskräftenachwuchses und der Führungskräfte, insbesondere im Bereich von Schulleitung und Schulaufsicht [ergreifen]“ (KMK 2020 S. 24 – Art. 34 Abs. 3). Bislang fehlen für die Professionalisierung von Schulleiterinnen und Schulleitern allerdings Standards, wie sie bspw. im KMK-Rahmenpapier für die Lehrkräftebildung formuliert wurden (KMK 2004).
Die uneinheitliche Regelung der Schulleitungsqualifizierung spiegelt sich in heterogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie unterschiedlichen dafür zuständigen Institutionen in den Bundesländern wider. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es in Deutschland aufgrund der föderalen Struktur keine „zentrale Institution“ (Huber 2007 S. 151) für die Schulleitungsqualifizierung. Hierzulande sind für die Schulleitungsqualifizierung i. d. R. die landeseigenen Fortbildungsinstitute zuständig (Rosenbusch und Warwas 2007; Huber 2007).
9.3 Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern im Rahmen von Personalentwicklung zur Sicherung und Entwicklung von Unterrichtsqualität
Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland sind zunächst einmal vollständig ausgebildete Lehrkräfte, die darüber hinaus eine (eher schmale) zusätzliche Ausbildung erhalten haben. Sie wurden lange Zeit als Lehrkräfte mit besonderen (administrativen) Aufgaben betrachtet (z. B. Harazd et al. 2008) und erst seit den 1980er-Jahren hat sich diese Sicht auf Schulleiterinnen und Schulleiter hierzulande verändert (Tulowitzki et al. 2019).
Sie wird allerdings dem (anspruchsvollen) Amt und der Praxis der Schulleiterin oder des Schulleiters nicht mehr gerecht (Tulowitzki und Kruse 2020). Die neuen Führungsaufgaben und die wachsenden Anforderungen an diese Funktion wurden im Zuge der – insbesondere internationalen – Leadership-Debatte differenzierter beschrieben und erfasst. Personalentwicklung stellt eine dieser neuen Führungsaufgaben für Schulleiterinnen und Schulleiter dar, deren Potenzial dabei nicht nur in der Schul- und Unterrichtsentwicklung gesehen wird, sondern der auch „im Systemzusammenhang [ein] Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Bildungswesens“ (Schratz 2015 S. 90) zugeschrieben wird.
Vor dem Hintergrund der nationalen und internationalen Diskussion über die Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern wird in diesem Kapitel zunächst dargestellt, wie Aufgaben der Personalentwicklung und der Sicherung und (Weiter-)Entwicklung der Unterrichtsqualität für Schulleiterinnen und Schulleiter in den Schulgesetzen sowie Dienstordnungen der Länder definiert werden. Im zweiten Schritt wird geprüft, inwieweit die Themen und Inhalte in Schulleitungsqualifizierungen in den einzelnen Bundesländern diesen gesetzlichen Aufgabenbeschreibungen von Schulleitungen entsprechen. Dazu werden die Modulbeschreibungen, Themen und Inhalte in den Qualifizierungsangeboten und -maßnahmen für Schulleiterinnen und Schulleiter berücksichtigt.
9.4 Methodisches Vorgehen und verwendete Dokumente
Für die Auswertung der Schulleitungsaufgaben wurden die Schulgesetze der Länder und – soweit vorhanden – die Dienstordnungen berücksichtigt. Was die Aufgabenbereiche Fortbildung, dienstliche Beurteilung, Beratung und Unterrichtsbesuche betrifft, wurde auf die Analysen in den entsprechenden Kapiteln in diesem Band zurückgegriffen, die neben den Schulgesetzen und Dienstordnungen auch weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften berücksichtigt haben. (Für den Bereich dienstliche Beurteilung s. Kap. 6, für Beratung und Unterrichtsbesuche Kap. 7 sowie für Fortbildung s. Kap. 8).
Für die Analyse der Schulleitungsaufgaben wurde ein Kategoriensystem induktiv entwickelt, das Hauptkategorien (Kategorien erster Ordnung) mit den dazugehörigen Subkategorien (Kategorien zweiter Ordnung) enthält. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Aufgaben im Rahmen der Personalentwicklung zur Sicherung und (Weiter-)Entwicklung der Unterrichtsqualität. In der vergleichenden Analyse werden die Unterschiede in Umfang, Tiefe und Verbindlichkeitsgrad der beschriebenen Aufgaben herausgearbeitet. Darüber hinaus wird auch analysiert, wie detailliert und spezifisch die jeweiligen Aufgaben formuliert werden.
In Abb. 9.1 Aufgaben der Schulleitungen in den Schulgesetzen und Dienstordnungen sind die Ergebnisse der ländervergleichenden Analysen bezogen auf diese Haupt- und Subkategorien dargestellt:
Unter den Begriff Personalentwicklung lassen sich Aufgaben subsumieren, die sich auf die professionelle Weiterentwicklung der Lehrkräfte beziehen. Dazu gehören z. B. die Identifikation von Fortbildungsbedarfen und die Überprüfung der Fortbildungsteilnahme (ausführlich in Kap. 8), aber auch Personalentwicklungsinstrumente, wie Mitarbeitergespräche (ausführlich in Kap. 7) oder dienstliche BeurteilungenFootnote 1 (ausführlich in Kap. 6). Zur (Weiter-)Entwicklung der Unterrichtsqualität zählen neben planerischen Aufgaben wie Unterrichtseinsatzplanung insbesondere die Überprüfung der Unterrichtsqualität bzw. Durchführung von Unterrichtsbesuchen.
9.5 Ergebnisse der Dokumentenanalyse: Beschreibung der Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern in Dienstordnungen und Schulgesetzen
Im Allgemeinen zeigt sich hinsichtlich der Aufgabenbereiche Personalführung, Personalentwicklung und Personalmanagement in den Schulgesetzen sowie Dienstordnungen der Länder ein heterogenes Bild. In der Mehrheit der Fälle werden diese Bereiche direkt angesprochen.
Das Spektrum erstreckt sich hierbei von einer (allgemeinen) Erwähnung, dass die Förderung der Personalentwicklung zu den Schulleitungsaufgaben zählt (bis hin zu spezifischen Formulierungen, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter für das Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept für die Lehrkräfte verantwortlich ist oder dazu verpflichtet ist, die Personalentwicklung an der Schule zu fördern.
Im Hinblick auf die konkreten Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter im Rahmen der Personalentwicklung lassen sich die Ergebnisse folgendermaßen zusammenfassen: Schulleiterinnen und Schulleitern werden am häufigsten die Aufgaben Überprüfung der Unterrichtsqualität, Unterrichtsbesuche, Beratung/Unterstützung von Lehrkräften, Förderung/Sicherstellung der Fortbildung zugeschrieben. Hier besteht eine vergleichsweise große Übereinstimmung zwischen den Ländern. Im Hinblick auf andere Schulleitungsaufgaben zeigen sich dagegen deutliche Unterschiede. Außerdem fällt auf, dass es eine große Spannbreite hinsichtlich Umfang und Dichte der Ausführungen zu den Aufgaben im Rahmen der Personalentwicklung sowie der Sicherung und (Weiter-)Entwicklung der Unterrichtsqualität gibt.
Im Folgenden werden die Aufgaben, die in Abb. 9.1 im Überblick dargestellt sind, genauer erläutert.
9.5.1 Unterrichtseinsatzplanung
Unter die Kategorie Unterrichtseinsatzplanung werden Aufgaben subsumiert, die sich auf die Unterrichtsversorgung, die Erteilung des Unterrichts sowie das Planen des Unterrichtseinsatzes beziehen.
In zehn Ländern wird die Unterrichtseinsatzplanung als Schulleitungsaufgabe erwähnt. Dabei wird in der Mehrheit der Länder formuliert, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter über den „Unterrichtseinsatz“ entscheidet (BrandenburgFootnote 2, BerlinFootnote 3) oder eigenständig die „Unterrichtsverteilung“ vornimmt oder plant (BayernFootnote 4, HessenFootnote 5, Nordrhein-WestfalenFootnote 6, Rheinland-PfalzFootnote 7, SaarlandFootnote 8, SachsenFootnote 9). In Niedersachsen wird nicht der Unterrichtseinsatz, sondern der „Personaleinsatz“Footnote 10 benannt. In den Ländern Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig–Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen findet Unterrichtseinsatzplanung als Aufgabe von Schulleiterinnen und Schulleitern keine Erwähnung.
9.5.2 Überprüfung der Unterrichtsqualität
Zur Überprüfung von Unterrichtsqualität finden sich in allen Ländern bis auf Niedersachsen und Saarland entsprechende Regelungen in den Schulgesetzen bzw. Dienstordnungen. Dabei lässt sich eine deutliche Varianz in den Formulierungen und Vorgaben zur Überprüfung der Unterrichtsqualität feststellen. In einigen Bundesländern wird allgemein beschrieben, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter die Verantwortung für die Qualitätssicherung und -entwicklung des Unterrichts und der Schule tragen (Bremen, Hessen, Sachsen). Auf einer niedrigschwelligen Ebene bedeutet Überprüfung der Unterrichtsqualität, dass sich die Schulleiterinnen und Schulleiter über die Unterrichtsarbeit und das Unterrichtsgeschehen informieren sollen. In Nordrhein-Westfalen wird diesbezüglich in der Dienstordnung detailliert beschrieben, auf welche Weise sich der Schulleiter oder die Schulleiterin informieren sollte – nämlich „durch Einsicht in die Unterlagen der Klassen und Kurse einschließlich der Arbeiten zur Leistungsfeststellung […]“Footnote 11. Daran schließt inhaltlich auch der Ausschnitt aus der rheinland-pfälzischen Dienstordnung an, in dem es heißt, dass „die Schulleiterin oder der Schulleiter […] sich durch geeignete Maßnahmen (z. B. Unterrichtsbesuche, Einsicht in Klassen- und Kursarbeiten) über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule [informiert] und die Lehrkraft anhand der gewonnenen Erkenntnisse [berät]“Footnote 12. Auch hier werden dezidiert Maßnahmen und Verfahren zur Überprüfung der Unterrichtsqualität durch Schulleiterinnen und Schulleiter vorgegeben. In Bremen besteht darüber hinaus eine Spezifikation hinsichtlich der zu überprüfenden Qualität der Unterrichts- und Erziehungsarbeit; d. h. hier wird definiert, dass sich Schulleiterinnen und Schulleiter sowohl über die methodische als auch fachliche Qualität der Unterrichts- und Erziehungsarbeit informieren sollen.Footnote 13 In besonderer Weise hebt sich die entsprechende Stelle in der Dienstordnung in Schleswig-Holstein ab, da hier ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Überprüfung oder Einsichtnahme (z. B. in die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler) nicht der Kontrolle, sondern der kollegialen Mitarbeit bzw. Kooperation dienen soll und dadurch zu Besprechungen in der Lehrerkonferenz oder in Fachkonferenzen führen kann.Footnote 14
9.5.3 Unterrichtsbesuche
An die Kategorie Überprüfung Unterrichtsqualität schließt inhaltlich die Kategorie Unterrichtsbesuche an (s. Kap. 7, wo Regelungen zu Verpflichtungsgrad, Ausgestaltung und ggf. Eingriff in den Unterricht ausführlich dargestellt werden).
In allen Ländern werden Unterrichtsbesuche als Aufgabe der Schulleiterinnen und Schulleiter betrachtet. Die meisten Regelungen beschreiben eine Verpflichtung zur Durchführung von Unterrichtsbesuchen. In Baden-Württemberg werden Schulleiterinnen und Schulleiter ermächtigt, aber nicht ausdrücklich verpflichtet, Unterrichtsbesuche durchzuführen.
In der Dienstordnung aus Nordrhein-Westfalen heißt es, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter „durch Unterrichtsbesuche [die Unterrichtsqualität überprüft], um im Anschluss deren Ergebnis mit den betroffenen Lehrkräften zu besprechen“Footnote 15. In den Ländern Bayern und Hessen werden darüber hinaus konkretere Vorgaben zu den Unterrichtsbesuchen formuliert. In Bayern wird etwa beschrieben, wie Unterrichtsbesuche genau ablaufen sollen und – wenn auch vage – welche Kriterien für die Beobachtung relevant sind – nämlich „achtet [die Schulleiterin oder der Schulleiter] unter anderem darauf, dass die Anforderungen in den einzelnen Fächern das rechte Maß einhalten. Die Beobachtungen werden mit der Lehrkraft besprochen“Footnote 16. In Thüringen können sich Schulleiterinnen und Schulleiter neben den Unterrichtsbesuchen auch schriftliche Ausarbeitungen und Aufzeichnungen zur Beurteilung der Unterrichtsqualität vorlegen lassen. In Hessen sollen Unterrichtsbesuche ggf. mit weiteren geeigneten Evaluationsverfahren verbunden werden.Footnote 17 Des Weiteren können Differenzen hinsichtlich des Verpflichtungsgrades festgestellt werden: In einigen Ländern wird nicht nur beschrieben, dass Schulleiterinnen und Schulleiter die Möglichkeit haben, Unterrichtsbesuche durchzuführen bzw. durchführen sollen, sondern, dass sie diese fördern (Rheinland-Pfalz) oder dafür Sorge tragen (Hessen). Im baden-württembergischen Schulgesetz heißt es dagegen, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter „[…] ermächtigt [sind], Unterrichtsbesuche vorzunehmen und dienstliche Beurteilungen über die Lehrer der Schule für die Schulaufsichtsbehörde abzugeben“Footnote 18. Im Unterschied dazu wurde im sächsischen Schulgesetz die Ermächtigung durch die Verpflichtung ergänzt: Sächsische Schulleiterinnen und Schulleiter sind zu Unterrichtsbesuchen „ermächtigt und verpflichtet“Footnote 19. Dies entspricht der Regelung in Sachsen-Anhalt: Auch hier sind die Schulleiterinnen und Schulleiter zu Unterrichtsbesuchen „verpflichtet und berechtigt“.Footnote 20 Zu Unterrichtsbesuchen sind Schulleiterinnen und Schulleiter auch in Schleswig–Holstein „verpflichtet“Footnote 21, genauso wie in Hessen, wo sie „insbesondere verpflichtet [sind], […] 3. sich über das Unterrichtsgeschehen, insbesondere durch Unterrichtsbesuche, zu informieren, die Lehrerinnen und Lehrer zu beraten und, sofern erforderlich, auf einen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften entsprechenden Unterricht hinzuwirken“Footnote 22 und wo sie darüber hinaus „den Unterricht der Lehrkräfte jederzeit besuchen [können]“Footnote 23.
9.5.4 Beratungen oder Unterstützungen von Lehrkräften
Die Kategorie Beratung/Unterstützung von Lehrkräften beschreibt, ob und in welcher Form festgelegt ist, wie die Schulleiterinnen und Schulleiter ihre Lehrkräfte unterstützen sowie in Hinblick auf ihre Unterrichtsarbeit beraten sollen und ob sie dazu verpflichtet sind.
Bis auf Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen sind Beratungen und/oder Unterstützungen von Lehrkräften in allen Ländern verbindlich geregelt. In den meisten Fällen (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) wird allgemein formuliert, dass es zu den Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern gehört, die Lehrkräfte zu beraten. Beispielsweise heißt es in Bayern dazu, dass Schulleiterinnen und Schulleiter ihre Beobachtungen in den Unterrichtsbesuchen mit der Lehrkraft besprechen sollenFootnote 24 und die (erweiterte) Schulleitung Unterrichtsbesuche und deren beratende Nachbesprechung, die hier zu den unterstützenden Personalführungsinstrumenten subsumiert werden, durchführen soll.Footnote 25 In besonderer Weise ist das in der Dienstordnung in Rheinland-Pfalz geregelt. Hier sind konkrete Vorstellungen zur Qualitätsentwicklung erkennbar. Dazu werden verschiedene Aufgaben miteinander verbunden bzw. aufeinander bezogen. Die Beratung der Lehrkräfte findet dabei auf Grundlage von Informationen aus Unterrichtsbesuchen oder Klassen- und Kursarbeiten statt: „Im Rahmen der Qualitätsentwicklung fördert die Schulleiterin oder der Schulleiter eine Hospitations- und Feedback-Kultur, informiert sich durch geeignete Maßnahmen (z. B. Unterrichtsbesuche, Einsicht in Klassen- und Kursarbeiten) über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule und berät die Lehrkraft anhand der gewonnenen Erkenntnisse“Footnote 26. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird spezifiziert, dass die Beratungen in Bezug auf Fragen „der Unterrichts- und Erziehungsarbeit“Footnote 27 oder „der schulischen Bildung und Erziehung“Footnote 28 stattfinden sollen. In Schleswig-Holstein sollen die Schulleiterinnen und Schulleiter „die pädagogische Beratung der jüngeren Lehrer [übernehmen oder veranlassen]“Footnote 29. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass in Hessen Schulleiterinnen und Schulleitern die Aufgabe zukommt, auch die kollegiale Beratung zu unterstützen: „[…] Außerhalb von Unterrichtsbesuchen nach den Sätzen 1 bis 7 können auch Besuche von anderen Lehrkräften auf der Grundlage schulinterner Konzepte zur Förderung der kollegialen Beratung stattfinden […]“Footnote 30.
Die Unterstützung der Lehrkräfte als Aufgabe von Schulleiterinnen und Schulleitern ist in Brandenburg und Hessen definiert. Im Schulgesetz von BrandenburgFootnote 31 wird dies sehr allgemein benannt. In Hessen wird zum einen in der Lehrerdienstordnung Unterstützung als Aufgabe im Zusammenhang der Fort- und WeiterbildungFootnote 32 und zum anderen im Schulgesetz im Zusammenhang von PersonalentwicklungFootnote 33 ausdrücklich erwähnt.
9.5.5 Aufgaben bezogen auf die Fortbildung der Lehrkräfte
Die fortbildungsbezogenen Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter werden ausführlich in Kap. 8 in diesem Band dargestellt. In allen Ländern finden sich fortbildungsbezogene Aufgaben, die jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet sind, bezogen auf die Anzahl und den Grad der Verantwortung. Typische Aufgaben sind:
-
Hinwirken auf bzw. Förderung
-
Verantwortung für die Fortbildung
-
Sicherstellung der Fortbildung
-
Controlling
-
Vereinbarungen zu Fortbildungsmaßnahmen
-
Fortbildungsplanung der Schule.
9.5.6 Förderung der Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren
In die Kategorie Förderung der Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren werden die verbindlichen Regelungen, die die Förderung der beruflichen Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren an der Schule durch die Schulleiterinnen und Schulleiter betreffen, kodiert.
Als Schulleitungsaufgabe wird die Förderung der Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren in lediglich sechs Ländern in den Schulgesetzen oder Dienstordnungen erwähnt. In Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig–Holstein wird darauf allgemein verwiesen, während in Rheinland-Pfalz und Thüringen beschrieben wird, auf welche Weise Schulleiterinnen und Schulleiter die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren fördern sollen. Dazu gehört neben der Förderung der Lehrkräfteausbildung im Rahmen von Praktika auch die Förderung der Zusammenarbeit der Ausbildungsschule mit dem zuständigen staatlichen Studienseminar für Lehrkräfteausbildung.
9.5.7 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen
Die Kategorie Förderung Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen beinhaltet Fundstellen dazu, ob und auf welche Weise die Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen durch die Förderung und Unterstützung der Schulleiterinnen und Schulleiter verpflichtend festgelegt ist.
Die Dokumentenanalyse zeigt, dass in der knappen Mehrzahl der Länder (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen) dazu eine Passage in den Schulgesetzen oder Dienstordnungen zu finden ist. In den meisten Fällen wird lediglich erwähnt, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter für die Zusammenarbeit der Lehrkräfte Sorge tragen oder diese fördern. In BremenFootnote 34, HessenFootnote 35 und Mecklenburg-VorpommernFootnote 36wird spezifiziert, dass es dabei um die fachbezogene und fachübergreifende Zusammenarbeit der Lehrkräfte handelt. Des Weiteren wird der Rahmen der Zusammenarbeit in der Dienstvereinbarung von Bremen (Bremen) benannt, hier ist seitens der Schulleiterinnen und Schulleiter „für eine enge Kooperation auch im Rahmen festgelegter Kooperationszeiten zu sorgen“ […]Footnote 37. In Nordrhein-Westfalen werden in der Dienstordnung als Rahmen für die Förderung der Zusammenarbeit die Konferenzen gerade im Hinblick auf pädagogische und fachliche Fragen benannt.Footnote 38
9.5.8 Personalentwicklung
In einigen Gesetzen oder Dienstordnungen taucht der Begriff Personalentwicklung explizit auf (Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig–Holstein, Thüringen). In Hessen wird den Schulleiterinnen und Schulleitern außerdem die Aufgabe der Identifizierung und Förderung von Nachwuchs zugeschrieben, in Rheinland-Pfalz außerdem die Aufgabe des Personalmanagements und in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die Aufgabe der Personalführung.
Die Befugnisse der Schulleiterinnen und Schulleiter im Zusammenhang mit Personalentscheidungen werden ausführlich in Kap. 5 dargestellt. Das betrifft die Mitwirkungsrechte und Befugnisse der Schulleiterinnen und Schulleiter bei schulscharfen Stellenausschreibungen und Einstellungen, die Besetzung von Funktionsstellen und die Optionen bei der Eigenbewirtschaftung von Mitteln.
9.5.9 Stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter und ihre Aufgaben
Zu den Aufgaben der stellvertretenden Schulleiterinnen und Schulleiter lassen sich in den Schulgesetzen Passagen in zwölf Bundesländern finden (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig–Holstein, Thüringen), doch sind auch in den beiden Ländern Niedersachen und Sachsen-Anhalt stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter vorgesehen. Dabei wird in der deutlichen Mehrheit nicht spezifisch beschrieben, welche Aufgaben genau stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter zugewiesen bekommen (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig–Holstein, Thüringen). In Thüringen wird zudem eingegrenzt, welche Bereiche und Pflichten der stellvertretenden Schulleiterin oder dem stellvertretenden Schulleiter nicht übertragen werden können: „Der Vertreter übernimmt verantwortlich in Absprache mit dem Schulleiter einzelne Verwaltungsbereiche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Aufgaben, die durch die Schulordnung ausdrücklich dem Schulleiter übertragen sind, können nicht dem ständigen Vertreter als eigener Verwaltungsbereich übertragen werden“Footnote 39. Ausnahmen in diesem Zusammenhang stellen Hamburg und Nordrhein-Westfalen dar: In HamburgFootnote 40 werden die Erstbeurteilung (ausführlich in Kap. 6 zur dienstlichen Beurteilung) und in Nordrhein-Westfalen Planung und Koordinierung der Klassenbildung, Aufstellung der Stunden-, Raum- und Aufsichtspläne, Regelung des Vertretungsunterrichts, Verwaltung des Schülerdatenbestandes, die Schulstatistik, sowie Planung und Bewirtschaftung der HaushaltsmittelFootnote 41 als Aufgaben, die an stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter übertragen werden, spezifiziert. In der Dienstordnung aus Bremen wird darauf hingewiesen, dass diese Funktionsübertragung „verbunden mit einer konkreten Aufgabenbeschreibung nach Möglichkeit in Form einer schriftlichen Vereinbarung mit der betreffenden Lehrkraft, gegebenenfalls im Rahmen der von der Anstellungsbehörde vorgegebenen Aufgaben [erfolgt]“.Footnote 42 Zudem ist in Bayern der Umfang der Vertretungsaufgaben angesprochen, jedoch allgemein gehalten: „Bei Abwesenheit der Schulleiterin oder des Schulleiters von der Schule werden die Aufgaben und Befugnisse der Leitung der Schule von der mit der ständigen Vertretung betrauten Lehrkraft im erforderlichen Umfang wahrgenommen“Footnote 43. „Der ständigen Vertreterin oder dem ständigen Vertreter und etwaigen weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertretern werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bestimmte Aufgaben in angemessenem Umfang zur Erledigung übertragen“Footnote 44. Des Weiteren wird in einigen Bundesländern (Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) darauf hingewiesen, dass stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter ihre übertragenen Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich wahrnehmen.
9.6 Struktur und Organisation von Schulleitungsqualifizierungen
9.6.1 Methodisches Vorgehen und verwendete Dokumente
Vor dem Hintergrund der im vorausgehenden Teilkapitel beschriebenen Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern, die in den Schulgesetzen und Dienstordnungen identifiziert wurden, werden im Folgenden die Qualifizierungsangebote und -maßnahmen der einzelnen Länder dargestellt. Dazu wurden die Qualifizierungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter für die 16 Länder vergleichend erfasst und systematisiert. Ausgewertet wurden konzeptionelle Dokumente (s. Anhang: Verzeichnis der Quellen für die Schulleitungsqualifizierung) zur Regelung der Qualifizierungswege und der Ausgestaltung der Qualifizierungsangebote anhand eines sowohl induktiv als auch deduktiv abgeleiteten Kategoriensystems. Das Kategoriensystem orientiert sich an den Merkmalen und Aspekten, die die konzeptionellen Dokumente zur Schulleitungsqualifizierung strukturieren und beinhaltet die Kategorien Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt, Phasen der Schulleitungsqualifizierung, Verpflichtungsgrad, Dauer und Umfang der Schulleitungsqualifizierungen, Formate der Schulleitungsqualifizierungen sowie zu erbringende Prüfungen und Leistungen im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen.
9.6.2 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt
Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt fallen je nach Qualifizierungsphase und Bundesland unterschiedlich aus.
In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen bestehen keine explizit formulierten Voraussetzungen für die Teilnahme an Schulleitungsqualifizierungen. In einigen Bundesländern sind keine Voraussetzungen für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt auf den Seiten der für die Schulleitungsqualifizierung zuständigen Landesinstitute formuliert (Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen). In Rheinland-Pfalz werden Vorbereitungsseminare für Lehrkräfte, die ein Amt als Schulleiterin oder Schulleiter anstreben, angeboten. Das Angebot ist für die Lehrkräfte nicht verpflichtend, sondern freiwillig. In Schleswig-Holstein können alle Lehrkräfte an der Qualifizierung vor Amtsübernahme teilnehmen. In Thüringen können sich die Lehrkräfte für die Orientierungsphase über das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) anmelden. Das Orientierungsangebot ist freiwillig. Bei der vorbereitenden Qualifizierung ist es ähnlich. Die Interessenten melden sich über das Thüringer Schulportal für die vorbereitende Qualifizierung (Phase 2), die freiwillig ist, an. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist jedoch nach der verbindlichen Anmeldung Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss.
In Baden-Württemberg gibt es lediglich die Vorgabe, dass Einführungsseminare, die insgesamt drei Wochen andauern und über einen Zeitraum von 2 Jahren belegt werden sollen, Pflicht für neu ernannte Schulleitungen sind. Darüber hinaus werden keine weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und für die Übertragung des Schulleitungsamts benannt.
In Bremen gibt es u. a. das verbindliche Qualifizierungsprogramm ProfiS (Professionell leiten in der Schule), das sich an alle neu eingestellten Schulleiterinnen und Schulleiter aller Schularten richtet. Hierfür werden sie von der jeweiligen Schulaufsicht schriftlich eingeladen. Für die inhaltliche Ausgestaltung (in Kooperation mit externen Dozenteninnen und Dozenten) und Leitung des Programms sind die Experteninnen des LIS in Kooperation zuständig. Ähnlich wie in Bremen existiert auch in Niedersachsen das spezifische Angebot Führungskräftenachwuchsförderung (FüNF), das vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) entwickelt worden ist. Es umfasst drei Module und verfolgt das Ziel, an einem Schulleitungsamt interessierte Lehrkräfte bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, Informationen zu Schulleitungsaufgaben zur Verfügung zu stellen und auf die Übernahme eines Schulleitungsamts professionell vorzubereiten. Ergänzend zu diesen Programmen zur schulischen Führungskräftequalifizierung wurde in Bremen das Projekt „Führungskräftenachwuchs von Lehrenden mit eigener oder familiärer Migrationsbiografie“ im Jahr 2020 gestartet. Daran können angehende schulische Führungskräfte teilnehmen, die über eine eigene oder familiäre Migrationsbiografie verfügen. Aufgrund dieser Adressatengruppe ist dieses Programm im Rahmen von Führungskräfte- und Schulleitungsqualifizierungen deutschlandweit einzigartig.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen bestimmte Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und die Übertragung des Schulleitungsamts erfüllt sein. Dazu zählen die vorherige Teilnahme an den vom Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V) angebotenen Veranstaltungen der Phasen 1 und 2 der Führungskräftequalifizierung. Grundsätzlich können sich Lehrkräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung und für einzelne Schularten ausgewiesenen Lehrbefähigungen bewerben.
In Hamburg sollen durch bestimmte Qualifizierungsbausteine Kompetenzen erworben werden, die für Leitungsfunktionen an der Schule notwendig sind. Für die Teilnahme daran wird erste Erfahrung mit Leitungsaufgaben an der Schule (z. B. die Übernahme einer Projektleitung, einer Fachleitung etc.) vorausgesetzt (vgl. Homepage des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg).
9.6.2.1 Teilnahmebescheinigungen, Zertifikate und Portfolios als spezifische Nachweise
Bei den Voraussetzungen für die Teilnahme an Schulleitungsqualifizierungen oder für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt handelt es sich i. d. R. um verschiedene Formen von Nachweisen (z. B. Portfolio) über besuchte und erfolgreich abgeschlossene einzelne (Fortbildungs-)Veranstaltungen, Seminarreihen oder Module oder auch bestimmte Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Zu den spezifischen Nachweisen als Voraussetzung für die Teilnahme an Schulleitungsqualifizierungen zählen vor allem Teilnahmebescheinigungen (Berlin, Brandenburg) oder Portfolios (Bayern, Hamburg, Saarland, Sachsen). In Bayern müssen seit dem Schuljahr 2009/10 Bewerbungen auf eine Funktionsstelle als Schulleiterin oder Schulleiter ein Portfolio enthalten mit einer Nachweisliste über die besuchten 10 Tage an führungsrelevanten Fortbildungen (erste Phase, d. h. Vorqualifikationsphase, Modul A). In Bayern ist der Abschluss der ersten Phase, d. h. der Vorqualifikationsphase (Modul A) Voraussetzung für die anschließende zweite Phase der Schulleitungsqualifizierung, d. h. der Ausbildungsphase (Modul B) und dem Amt der Schulleiterin oder des Schulleiters. In Sachsen soll das Portfolio den Entwicklungsprozess ebenfalls dokumentieren, die Qualifizierungsplanung unterstützen und auch die Basis für eine Entscheidungsfindung bei der Personalauswahl sein. In Hamburg wird sogar ein dezidiertes Portfoliogespräch geführt, bei dem das Referat Personalentwicklung mit der neuen Führungskraft auf Basis ihres Fortbildungsportfolios einen individuellen Ausbildungsplan für die Schulleitungsqualifizierung erstellt, der von der Schulaufsicht geprüft und genehmigt wird.
Auch im Saarland wird für die Qualifizierung vor dem Amt neben der Vorbereitungsphase Q1 und dem Fortbildungsportfolio eine Basisveranstaltung vorausgesetzt. Das Fortbildungsportfolio gilt als Grundlagennachweis für die Bereiche Kommunikation, Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung. Die Basisveranstaltung findet als Tagesveranstaltung (Einzelveranstaltung) zur Orientierung und Qualifizierung von Schulleitungen statt und zählt gleichzeitig als Basis-Modul für die Reihe Qualifizierung vor dem Amt.
In Berlin und Brandenburg muss das Basismodul erfolgreich durchlaufen werden, um an weiterführenden zielgruppenspezifischen Qualifizierungsreihen teilnehmen und mit einem Zertifikat abschließen zu können. Das Basismodul umfasst sechs Fortbildungsveranstaltungen mit jeweils 10 Fortbildungsstunden à 45 min, die sich über ca. 5–6 Monate erstrecken. Die Teilnehmenden erhalten am Ende eine Teilnahmebescheinigung als Grundlage für die Fortführung des Kurses in einem gewählten Spezialisierungsmodul.
9.6.2.2 Eignungsfeststellungsverfahren als besondere Voraussetzung für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt
Eine Besonderheit stellen Nordrhein-Westfalen und Hessen dar, da beide Bundesländer verpflichtende Eignungsfeststellungsverfahren als Teil des Bewerbungsverfahrens für das Schulleitungsamt einsetzen. Auf diese Weise sollen Kompetenzen von Schulleiterinnen und Schulleitern überprüft und bewertet werden.
Voraussetzung zur Zulassung für das Eignungsfeststellungsverfahren in Nordrhein-Westfalen ist die Schulleitungsqualifizierung oder die ununterbrochene Wahrnehmung der Funktion einer Schulleiterin oder eines Schulleiters (z. B. als Beauftragung oder Abwesenheitsvertretung) für mindestens sechs Monate oder die Übertragung eines Amtes gemäß § 35 Laufbahnverordnung auf Dauer. Außerdem befähigt ein gleichwertiger Weiterbildungskurs bei einer kirchlichen oder anderen Einrichtung (im Umfang von mindestens 104 h) oder ein auf Führung und Management ausgerichtetes Zusatzstudium mit mindestens zwei Semestern an einer Hochschule. Der Weiterbildungskurs muss vom Ministerium für Schule und Bildung anerkannt werden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung wiederum ist die Befähigung für ein Lehramt allgemein und die Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Ernennung als Schulleitung. Es werden dabei vorrangig Schulleitungsmitglieder oder Lehrkräfte, die bereits Leitungsaufgaben wahrnehmen, zugelassen (vgl. Broschüre „Schulleitungsqualifizierung in Nordrhein-Westfalen“ vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2012).
Im Rahmen der staatlichen Qualifikationserweiterung „Schulleitungsqualifizierung (SLQ)“ werden künftige Schulleiterinnen und Schulleiter vorbereitet, bei der Kenntnisse vermittelt, praxisorientierte Erfahrungen ermöglicht und Kompetenzen (weiter-)entwickelt werden. Auf diese Weise sollen grundlegende führungsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen und damit professionelles Führungshandeln kontinuierlich (weiter-)ausgebaut werden. Die SLQ berechtigt zur Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren.
Hier besteht zudem ein Gesamtkonzept zur Leitungsqualifizierung. Neben der Qualifikationserweiterung „Schulleitungsqualifizierung (SLQ)“ gibt es eine Leitungsqualifizierung mit spezifischen Fortbildungsangeboten für (Nachwuchs-)Führungskräfte und an Leitungsaufgaben und -funktionen interessierten Lehrkräften. Darüber hinaus umfasst das Gesamtkonzept Orientierungsseminare, Angebote für Schulleiterinnen und Schulleiter neu im Amt, Angebote mit speziellen Themen für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Schulleitungsbegleitung bzw. Schulleitungscoaching. Mit diesem Gesamtkonzept zur Leitungsqualifizierung ist eine systematische Führungskräfteentwicklung und -unterstützung beabsichtigt.
Das seit 2009 eingeführte Eignungsfeststellungsverfahren entspricht einem zweitägigen Assessment-Center-Verfahren, bei dem Eignung in Form von Leitungskompetenzen für das Schulleitungsamt festgestellt werden. Dabei werden die vier Kompetenzen Rollenklarheit, Innovation, Management und Kommunikation in arbeitsrelevanten Simulationen getestet. Diese Kompetenzen werden kriteriengeleitet und von speziell für das Assessment-Center-Verfahren geschulten Beobachterinnen und Beobachtern, die aus verschiedenen schulfachlichen Bereichen stammen, überprüft.
In Hessen werden für die Teilnahme an der Qualifizierung vor dem Amt eine Vorbereitungsphase und ein Eignungsfeststellungsverfahren vorausgesetzt. Um sich auf die Stelle einer Schulleiterin oder eines Schulleiters bewerben zu können, ist die Anmeldung zum Eignungsfeststellungsverfahren notwendig.
Die Qualifizierung für Schulleiterinnen und Schulleiter (QSH) zielt darauf ab, angehende Schulleiterinnen und Schulleiter auf ihre Tätigkeiten gezielt, umfassend und fundiert vorzubereiten und ihre Eignung für das Schulleitungsamt im Rahmen eines Eignungsfeststellungsverfahrens zu überprüfen. Die Qualifizierung vor Amtsübernahme setzt sich aus einer verbindlichen und kompetenzbezogenen Vorbereitungsphase, bestehend aus einem Reflexionstag und einer Qualifizierungsphase, sowie einem (abgekoppelten) Eignungsfeststellungsverfahren, zusammen. Dieses Verfahren ist im Schuljahr 2016/2017 (Pilotphase) eingeführt worden. Nach einer mehrjährigen Übergangsphase sollen die Qualifizierung und das Eignungsfeststellungsverfahren ab dem Schuljahr 2021/22 verbindlich werden. Dann soll die Eignungsfeststellung Voraussetzung sein, um sich auf das Schulleitungsamt bewerben zu können. Die Qualifizierungsphase ist berufsbegleitend und dauert ungefähr ein Jahr.
In der Qualifizierungsphase werden verschiedene Module angeboten und das Fallszenario „Die ersten 100 Tage an einer Schule“ bearbeitet. Das Eignungsfeststellungsverfahren wird anhand eines dreitägigen Assessment-Center-Verfahrens umgesetzt, das aus fünf Übungen besteht: Biografisches Interview, Gruppengespräch, Kurzreferat/Präsentation, professionelles Selbstmanagement, Konflikt-/Beratungsgespräch. Für die Bewertung der Übungen werden geschulte Beobachterinnen und Beobachter eingesetzt. Das Ergebnis im Eignungsfeststellungsverfahren fließt in die dienstliche Beurteilung ein und kann bei Nichtbestehen im Folgejahr wiederholt werden. Zusätzlich soll die Schulleitungsqualifizierung zu einer fortwährenden und systematischen Weiterqualifizierung von Schulleitungen nach Amtsübernahme durch den Ausbau und die Vertiefung erworbener Kenntnisse und Kompetenzen beitragen. Die Phase der Amtsübernahme gliedert sich in zwei Begleitphasen: Die erste Begleitphase erstreckt sich bis fünf Jahre nach der Ernennung und die zweite Begleitphase ab fünf Jahre nach der Ernennung.
9.6.2.3 Regelung zur Anerkennung von Qualifizierungsveranstaltungen externer Anbieter
In einigen Ländern bestehen explizite Regelungen für die Anrechnung von Qualifizierungsveranstaltungen externer Anbieter. Im Rahmen des Moduls C können beispielsweise in Bayern Seminare und Module nicht nur bei der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP), sondern auch bei anerkannten externen Anbietern, wie z. B. beim Bildungspakt Bayern oder den Universitäten, absolviert werden. In Schleswig–Holstein zählt dazu der Master-Weiterbildungsstudiengang „Schulmanagement und Qualitätsentwicklung“ an der Universität Kiel, der vollständig zur Schulleitungsvorbereitung anerkannt wird, wenn die Veranstaltungen „Schulrecht für die pädagogische Praxis“ und „Rechtliche Grundlagen für schulische Führungskräfte“ besucht werden. Auch können beide absolvierten Module als Praktikum anerkannt werden. In Nordrhein-Westfalen können angehende Schulleiterinnen und Schulleiter Veranstaltungen an der Deutschen Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) der TU Dortmund besuchen, die auf die Förderung und Qualifizierung von Führungskräften spezialisiert sind. Diese Veranstaltungen werden gemäß der Schulleitungsqualifizierung (SLQ) vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB NRW) anerkannt. Nach Abschluss von 13 Seminaren aus vier Themengebieten, analog zur Schulleitungsqualifizierung in Nordrhein-Westfalen (SLQ NRW), ist die Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren möglich (gemäß BASS 21–01 Nr. 30).
9.6.3 Phasen der Schulleitungsqualifizierung und Verpflichtungsgrad
Für die Schulleitungs- bzw. Führungskräftequalifizierung sind in Deutschland unterschiedliche Institutionen zuständig; dabei liegt die Verantwortlichkeit hauptsächlich bei den Landesinstituten oder in einigen Bundesländern auf ministerialer bzw. behördlicher Ebene. Die Schulleitungsqualifizierung ist in Deutschland in der Regel in drei Phasen unterteilt, lediglich in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen ist sie in vier Phasen gegliedert. Der Verpflichtungsgrad variiert hinsichtlich der verschiedenen Phasen der Schulleitungsqualifizierung in den einzelnen Bundesländern.
Für die Schulleitungs- bzw. Führungskräftequalifizierung sind in Deutschland in der Regel die Landesinstitute zuständig, wie das
-
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM)
-
Landesinstitut für Schule Bremen (LIS)
-
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Li) in Hamburg
-
Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V)
-
Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
-
Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS)
-
Landesinstitut für Pädagogik und Medien Saarland (LPM)
-
Landesamt für Schule und Bildung Sachsen (LaSuB)
-
Sächsisches Bildungsinstitut
-
Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)
-
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
-
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM).
Ergänzend dazu informieren bestimmte Bildungsportale bzw. -server der Länder über die Schulleitungs- bzw. Führungskräftequalifizierung in den jeweiligen Landesinstituten oder verweisen auf diese, wie z. B.:
-
Bildungsserver Mecklenburg-Vorpommern
-
Bildungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen
-
Lehrerbildung Sachsen
-
Bildungsserver Sachsen-Anhalt
-
Thüringer Schulportal.
Darüber hinaus liegt die Verantwortlichkeit für die Schulleitungs- bzw. Führungskräftequalifizierung in einigen Bundesländern auch auf ministerialer bzw. behördlicher Ebene, wie
-
im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
-
im Hessischen Kultusministerium
-
in der Landesschulbehörde Niedersachsen
-
im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen
-
im Landesschulamt Sachsen-Anhalt
-
im Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
oder bei den Führungsakademien und Zentren für Führungskräfteentwicklung, wie
-
dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), Baden-Württemberg
-
der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP), Dillingen/Bayern
-
der Hessischen Lehrkräfteakademie
-
dem Landeszentrum für Schulleitungsqualifizierung Nordrhein-Westfalen
-
dem Zentrum für Schulleitung und Personalführung (ZfS), Reinland-Pfalz.
9.6.3.1 Erste Phase der Schulleitungsqualifizierung: Vor dem Amt
Die erste Phase der Schulleitungsqualifizierung bezieht sich auf die Qualifizierung vor dem Amt und adressiert Lehrkräfte, die ein Schulleitungsamt anstreben. Die zweite Phase bezieht sich auf die Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern, die neu im Amt sind. Die dritte Phase der Schulleitungsqualifizierung beinhaltet (berufsbegleitende) Qualifizierungen für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter.
In Bayern werden diese Phasen der schulischen Führungskräftequalifizierung, für die die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) zuständig ist, anhand von Modulen bezeichnet: Die erste Phase wird hier Vorqualifikationsphase (Modul A) genannt, bei der die Unterstützung und Stärkung der Lehrkräfte bzw. der angehenden Führungskräfte bei der Übernahme von Führungsverantwortung in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen im Fokus stehen. Dabei geht es vor allem um Orientierung, Einschätzung der persönlichen Eignung sowie die (Weiter-)Entwicklung persönlicher (Führungs-)Kompetenzen. Diese Phase stellt die Voraussetzung für das Amt der Schulleiterin oder des Schulleiters dar. Die anschließende zweite Phase der Schulleitungsqualifizierung entspricht der Ausbildungsphase (Modul B) und ist an die neu ernannte Schulleiterin oder den neu ernannten Schulleiter adressiert. Die dritte berufsbegleitende Phase richtet sich an Schulleiterinnen und Schulleiter in den ersten Berufsjahren und ihren Bedürfnissen in diesem Amt und wird als Begleitung (Modul C) bezeichnet. Alle drei Module sind Teil eines Ausbildungscurriculums und müssen besucht und in einem vorgegebenen Zeitraum begonnen bzw. abgeschlossen werden – so muss Modul B spätestens im Jahr nach der Funktionsübertragung begonnen und Modul C in den fünf Jahren nach der Funktionsübertragung besucht werden.
Auf Grundlage der hauptsächlich konzeptionellen Dokumente, die die Regelungen von Schulleitungsqualifizierungen beschreiben, werden im Ländervergleich einige Unterschiede deutlich (s. Abb. 9.2 Phasen der Schulleitungsqualifizierung).
In allen Bundesländern bis auf Baden-Württemberg ist eine erste Qualifizierungsphase vor dem Amt als Schulleiterin oder Schulleiter vorgesehen, in der entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Qualifizierungsangeboten für angehende Schulleiterinnen und Schulleiter ist in Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen verpflichtend und in den restlichen Bundesländern optional.
Für die Konzeption und Umsetzung der Schulleitungsqualifizierung ist für Berlin und Brandenburg das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) gleichermaßen zuständig. Jedoch gibt es hier den Unterschied, dass die Phase vor dem Amt (bestehend aus dem Basismodul und Spezialisierungsmodul Schulleitung) nur in Berlin verpflichtend (s. entsprechende Verwaltungsvorschrift aus 2013) und in Brandenburg bislang optional ist. Laut der Auskunft des LISUMS ist aber geplant, dass ab März 2022 die Verwaltungsvorschrift in Brandenburg angepasst wird und die Phase vor dem Amt für angehende Schulleiterinnen und Schulleiter auch hier verpflichtend werden. Auch in Hessen gibt es bezüglich der Phase vor dem Amt strukturelle Veränderungen. Hier wurde die Qualifizierung der Schulleiterinnen und Schulleiter (IQSH) neugestaltet. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde bereits eine erste Pilotierung durchgeführt und prozessbegleitend evaluiert. Nach einer mehrjährigen Übergangsphase sollen die Qualifizierung und das Eignungsfeststellungsverfahren in Hessen verbindlich werden. Die Qualifizierung endet mit der Eignungsfeststellung und wird ab Schuljahr 2021/22 eine verbindliche Voraussetzung für die Bewerbung als Schulleiter oder Schulleiterin sein. Hessen stellt neben Nordrhein-Westfalen eine Besonderheit dar, da in beiden Bundesländern die Qualifizierung vor dem Amt mit einem Eignungsfeststellungsverfahren für das Schulleitungsamt verpflichtend ist. Auch kann die Vorqualifikationsphase (Modul A) in Bayern als verpflichtend eingestuft werden, da dieses Modul vor der Funktionsübertragung absolviert und auf dieser Grundlage ein Portfolio erstellt werden muss. Das Portfolio zum Modul A wird bei der Bewerbung auf das Schulleitungsamt eingefordert und beim Auswahlverfahren berücksichtigt. In Mecklenburg-Vorpommern werden in dieser ersten Phase der Schulleitungsqualifizierung Orientierungsseminare für Lehrkräfte vom Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V) angeboten, die sich für eine Leitungsfunktion interessieren.
In Hamburg werden Seminare durchgeführt, in denen durch bestimmte Qualifizierungsbausteine Kompetenzen erworben werden sollen, die für Funktionen an der Schule notwendig sind. Adressiert werden primär Lehrkräfte, die über Potenzial über die Lehrertätigkeit hinaus verfügen und an Schulen Zusatzaufgaben übernehmen (sollen). Die Qualifizierungsbausteine sollen die Lehrkräfte dabei unterstützen, die für diese Zusatzaufgaben notwendigen Kompetenzen systematisch weiterzuentwickeln. Die Seminare (10 Zeitstunden) finden in der Regel freitags, samstags oder in den Ferien statt, um Lehrkräften die Teilnahme unabhängig von schulischen Verpflichtungen zu ermöglichen. Die Themenangebote werden halbjährlich weiterentwickelt. Im Rahmen eines Klärungsseminars (16 Zeitstunden) sollen die Teilnehmenden eine Orientierung darüber erhalten, welche weiteren Qualifizierungsbausteine für sie von Interesse sein könnten.
9.6.3.2 Zweite Phase der Schulleitungsqualifizierung: neu im Amt
Im Hinblick auf die Schulleiterinnen und Schulleiter, die neu im Amt sind, zeigen sich im Ländervergleich ebenfalls Unterschiede: In allen Ländern gibt es Qualifizierungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter, die neu im Amt sind. In neun Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) sind diese Qualifizierungsangebote darüber hinaus verpflichtend.
9.6.3.3 Dritte Phase der Schulleitungsqualifizierung: berufserfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter
Die dritte Phase der Schulleitungsqualifizierung, die berufserfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter adressiert, existiert in allen Bundesländern. Die Qualifizierungsangebote sind dabei sehr vielfältig und unterscheiden sich im Hinblick auf Vorgaben und Ausgestaltung (s. Abschnitt 9.6.4.3). In Bayern und Thüringen ist diese dritte Phase der Schulleitungsqualifizierung verpflichtend, in allen anderen Bundesländern ist sie optional.
9.6.3.4 Schulleitungsqualifizierung mit vier Phasen
Die Führungskräfte- bzw. Schulleitungsqualifizierungen in Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen können als besonders ausdifferenziert und strukturiert aufgefasst werden, da sie in vier Phasen unterteilt sind.
In Mecklenburg-Vorpommern ist für die einzelnen Qualifizierungsphasen im Vorfeld genauso wie mit Beginn der Übernahme einer Schulleitungsfunktion das Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V) zuständig. Im Rahmen der Führungskräfte- bzw. Schulleitungsqualifizierung sollen die angehenden schulischen Führungskräfte nicht nur ihr Leitungshandeln professionalisieren und ihre Kompetenzen in den Dimensionen Führung, Management, Steuerung, Moderation und Beratung (weiter) ausbauen, sondern auch lernen, betriebswirtschaftlich zu denken und zu handeln.
Phase 1 stellt eine Orientierungsqualifizierung dar, bestehend aus einem Orientierungsseminar für Lehrkräfte, die eine Leitungsfunktion anstreben. Phase 2 entspricht der Qualifizierung vor dem Amt und dient der vorbereitenden Qualifizierung von Lehrkräften, die für die Übernahme einer Leitungsstelle in der Schule vorgesehen sind. Nach erfolgter Bestellung werden Schulleiterinnen und Schulleiter und stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter kontinuierlich durch das IQ M-V weiter qualifiziert und im Arbeitsalltag als Schulleiterinnen und Schulleiter beraten: Phase 3 stellt die funktionseinführende Qualifizierung (neu im Amt) für stellverstretende Schulleiterinnen und Schulleiter, die bis zu drei Jahren in der Funktion arbeiten, dar. Phase 4 betrifft die berufsbegleitende Qualifizierung für erfahrene stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter.
In Saarland ist die Qualifizierung schulischer Führungskräfte in vier Phasen gegliedert. Sie beginnt mit der allgemeinen Vorbereitungsphase „QI“, die ein Fortbildungsportfolio enthält und sich dadurch von den Phasen der Schulleitungsqualifizierung in den anderen Bundesländern, bis auf die Vorqualifikationsphase in Bayern, abhebt. Das Fortbildungsportfolio stellt einen Nachweis über erworbene Grundlagen aus den Themenbereichen Kommunikation sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung dar. Die Vorbereitungsphase QI beinhaltet außerdem die Basisveranstaltung „Schulleitung“, die als Einzelveranstaltung zur Orientierung besucht wird und gleichzeitig Basis-Modul für die Reihe „Vor-dem-Amt-Qualifizierung“ ist. An diese Phase schließt das spezifische Qualifizierungsangebot „QII“ an, das Lehrkräfte adressiert, die eine Führungsposition in der Schule übernehmen und sich dafür qualifizieren wollen sowie bereits über Vorerfahrungen durch die abgeschlossene QI-Phase (Basisveranstaltung und Portfolio) verfügen. Die angebotenen Veranstaltungen in acht Modulen knüpfen an das Basismodul an. Die „QIII“-Reihe richtet sich an neu ernannte Schulleiterinnen und Schulleitern und die vierte Säule „QIV“ ermöglicht eine professionelle Berufsbegleitung von erfahrenen Schulleiterinnen und Schulleiter durch verschiedene Angebote, wie z. B. Tagesveranstaltungen zu aktuellen Themen wie den jährlichen Schulleitungskongress, Einladungen zu Netzwerktreffen für Funktionsträger und Funktionsträgerinnen sowie die Veranstaltungsreihe „Werkstatt Schule leiten“ an (s. Homepage des Landesinstituts für Pädagogik und Medien Saarland).
Genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern und Saarland ist die Führungskräfte- bzw. Schulleitungsqualifizierung in Sachsen in vier Phasen strukturiert. In Sachsen ist das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) für die Qualifizierung schulischer Führungskräfte, wie (stellvertretende) Schulleiterinnen und Schulleiter, Schulreferentinnen und Schulreferenten, Fachleiterinnen und Fachleiter, Oberstufenberaterinnen und Oberstufenberater und an Führungsaufgaben interessierten Lehrkräfte, zuständig. Als zusätzliche Begleitung werden für schulische Führungskräfte differenzierte Angebote zu Coaching und Gruppensupervisionen angeboten. Während die Phase 3 (Amtseinführung) verpflichtend für neu bestellte Schulleiterinnen und Schulleiter ist, ist die Teilnahme an den Angeboten der Phasen 1 (Orientierung) und 2 (Amtsvorbereitung) freiwillig; sie wird aber vom Landesamt für Schule und Bildung als vorteilhaft im Bewerbungsverfahren eingeschätzt.
Die Phase 1 ist die Orientierungsphase, die sich an Lehrkräfte mit Interesse an schulischen Führungsaufgaben, richtet. Hier sollen Lehrkräfte durch theoretische und praktische Einblicke die Anforderungen an schulische Führungskräfte kennenlernen und durch Reflexion ihrer eigenen Kompetenzen den individuellen Lernbedarf bestimmen. Phase 2 dient der Amtsvorbereitung, in dem den künftigen schulischen Führungskräften im Rahmen von acht Modulen theoretische und wissenschaftlich fundierte Basiskenntnisse zu zentralen Arbeits- und Aufgabenfeldern von Schulleiterinnen und Schulleiter vermittelt werden. Damit sollen sie gezielt für das Schulleitungsamt und für die Bewältigung neuer Aufgaben geschult werden. In der Phase 3 (Amtseinführung) steht die vertiefende Unterstützung und Begleitung der schulischen Führungskräfte im Hinblick auf alle relevanten Arbeitsfelder und -aufgaben im Mittelpunkt. Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Führungsrolle und die Bearbeitung theoretischer, wissenschaftlich fundierter Themen sollen individuelle Führungskonzeptionen entwickelt werden. Die Module dieser Phase werden differenziert nach den unterschiedlichen schulischen Funktionsstellen angeboten. Phase 4 ist als Amtsbegleitung konzipiert und bietet umfassende angebots- und nachfrageorientierte Fortbildung, Veranstaltungen der Sommer- und Herbstakademien sowie Symposien für erfahrene schulische Führungskräfte zu den Tätigkeitsfeldern von Schulleiterinnen und Schulleitern, die auf kontinuierliche Weiterentwicklung und Vertiefung professioneller Kenntnisse und Kompetenzen zum schulischen Führungshandeln zielen.
9.6.4 Dauer und Umfang der Schulleitungsqualifizierungen
Die Angebote zur Schulleitungsqualifizierung variieren nach Umfang und Verpflichtungsgrad deutlich. Die Angaben zur Dauer und zum Umfang der Maßnahmen der Schulleitungsqualifizierungen wurden differenziert nach den Phasen erfasst (s. Abb. 9.3 Dauer und Umfang der Schulleitungsqualifizierungen). Um die zeitlichen Angaben vergleichen zu können, wurden diese umgerechnet in Zeitstunden und Fortbildungstage. Für einen Fortbildungstag wurden sechs Zeitstunden veranschlagt, mit Ausnahme von Bayern, wo ein Fortbildungstag 5 h entspricht (10 Tage = 50 h).
9.6.4.1 Dauer der Qualifizierung vor dem Amt
Für die Phase vor dem Amt als Schulleiterinnen und Schulleiter variieren die Qualifizierungsangebote zwischen 12 h (2 Tage) in Rheinland-Pfalz und Sachsen und 144 h (24 Tage) in Thüringen. Auch in Saarland (140 h) und Schleswig-Holstein (136 h) beträgt die Dauer der Qualifizierungsangebote für die Phase vor dem Amt ungefähr 140 h. In den fünf Ländern, in denen diese Phase der Schulleitungsqualifizierung verpflichtend ist (Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen) beträgt die Dauer für die Qualifizierungsangebote von 50 h in Bayern bis 120 h in Berlin.
In Mecklenburg-Vorpommern sind für die Phase vor dem Amt 84 h (14 Tage) vorgesehen, die sich aus der Phase 1 mit einem Orientierungsseminar mit 4 Tagen und der Phase 2, bestehend aus einer vorbereitenden Qualifizierung mit 10 Tagen, zusammensetzt. Auch in Sachsen-Anhalt finden Orientierungs- sowie Qualifizierungsangebote im Rahmen der amtsvorbereitenden Führungskräftequalifizierung (FKQ) statt, die sich über einen Zeitraum von ca. drei Jahren erstreckt. Die Maßnahme umfasst eine Eröffnungsveranstaltung und insgesamt 12 Module zu sechs Themenbereichen, die in der Regel als Tagesveranstaltungen angeboten werden und 72 h entsprechen. Für das Orientierungsseminar in Rheinland-Pfalz sind 12 h (2 Tage) vorgesehen. In Bremen wird ebenfalls ein Orientierungskurs – zu den Handlungsfeldern schulischer Führungskräfte – angeboten. Dieser besteht aus einer Veranstaltungsreihe, die aus 6 Modulen innerhalb eines Schuljahres mit insgesamt 38 h und einer eintägigen Hospitation bei einer Schulleitung besteht. Das entspricht insgesamt 44 h (7,5 Tage). Auf der Homepage des Landesinstituts für Schule wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Kurs nicht um eine Vorab-Qualifizierungsmaßnahme handelt. Vielmehr geht es darum, dass angehende Schulleiterinnen und Schulleiter sich mit typischen Themen und Aufgaben beschäftigen, die für die Leitungspraxis wesentlich sind. Nach der vorliegenden Unterscheidung der Qualifizierungsphasen kann dieser Kurs dennoch als ein Angebot im Rahmen der Phase vor dem Amt eingeschätzt und somit dieser Phase zugeordnet werden.
In Hessen und Nordrhein-Westfalen dauern die Qualifizierungsmaßnahmen von Schulleiterinnen und Schulleitern in der Phase vor dem Amt mit 102 bzw. 104 h ungefähr gleich lang. Während die 104 Fortbildungsstunden in Nordrhein-Westfalen in der Regel an 13 Fortbildungstagen durchgeführt werden, werden in Hessen dafür 17,5 Tage geplant. Hier besteht diese Qualifizierungsphase aus drei Teilen: Einem Reflexionstag, bei dem die angehenden Schulleiterinnen und Schulleiter die Möglichkeit zum Abgleich von Selbstbild und Fremdbild sowie zu einem Feedback-Gespräch erhalten. Des Weiteren beinhaltet diese Qualifizierung fünf Module, die über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten verteilt sind, ein Projekt in der Schule sowie ein Kamingespräch. Für den Abschluss der Module werden insgesamt 13 Tage (seitens der verantwortlichen Institution für Schulleitungsqualifizierung) veranschlagt; zu dem Projekt in der Schule sowie zu dem Kamingespräch bestehen keine zeitlichen Angaben. Außerdem wird in Hessen ein Assessment Center bzw. fünf Übungen im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens an 3 Tagen durchgeführt.
9.6.4.2 Dauer der Qualifizierung neu im Amt
Die Dauer für die Veranstaltungen im Rahmen der Phase neu im Amt beträgt zwischen 18 h (3 Tage) in Sachsen-Anhalt und bis zu maximal 198 h (33 Tage) in Hamburg. In Hinblick auf die neun Länder, in denen diese Qualifizierungsphase verpflichtend ist, wozu Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig–Holstein und Thüringen zählen, betragen die Dauer und der Umfang der Angebote zwischen 30 h (5 Tage) in Schleswig–Holstein und bis zu maximal 198 h (33 Tage) in Hamburg.
Der Umfang der Schulleitungsqualifizierung in der Phase neu im Amt variiert beträchtlich. In den Ländern beträgt der Umfang weniger als 15 Tage: Berlin/Brandenburg (10 Tage), Rheinland-PfalzFootnote 45 (5,5–12 Tage), Saarland (11,5 Tage), Nordrhein-Westfalen (13,5 Tage). Die Qualifizierungsmaßnahmen in Berlin und Brandenburg setzen sich dabei aus verschiedenen Elementen zusammen: 48 h Qualifizierung (vier Veranstaltungen mit 12 h á 45 min), vier Stunden kollegiale Fallberatung und acht Stunden Gruppen-Mentoring. Neben Schleswig–Holstein beträgt auch in Sachsen-Anhalt die Dauer für diese Phase unter 10 Tagen. Hier wird angegeben, dass in Sachsen-Anhalt eine jährlich stattfindende Dreitagesveranstaltung als Sommerakademie zu Beginn der Sommerferien für Schulleitungen, die neu im Amt sind, durchgeführt wird. Mindesten 15 Tage umfasst die Schulleiterqualifizierung in den Ländern: Baden-Württemberg (15 Tage), Bayern (14 Tage), Mecklenburg-Vorpommern (ca. 18 Tage), Sachsen (19 Tage), Niedersachsen (26 Tage), und Thüringen (25 Tage in einem Zeitraum von drei Jahren) sowie Hamburg (maximal 33 Tage).
Die Qualifizierungsangebote erstrecken sich auf unterschiedliche Zeiträume. Die Einführungsfortbildung für neu bestellte Schulleiterinnen und Schulleiter umfasst bspw. in Baden-Württemberg insgesamt 3 Wochen, die innerhalb von 2 Jahren belegt werden sollen. Die amtseinführende, verpflichtende Qualifizierung dauert in Sachsen zweieinhalb Jahre und beinhaltet 19 Präsenztage sowie bis zu fünf Tagen Hospitation, die dem Wahlbereich zuzuordnen sind. Am längsten dauern die Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Phase neu im Amt in Hamburg. Hier ist ein Zeitraum festgelegt, der 11 zwei- bis dreitägige Module innerhalb von 3 Jahren umfasst und damit zwischen 22 Tagen und 33 Tagen dauern kann.
In Bezug auf Hessen wird auf der Homepage des hessischen Kultusministeriums auf die einführende Qualifizierung nach der erstmaligen Übernahme einer Stelle als Schulleiter oder Schulleiterin verwiesen, die Schulleiterinnen und Schulleiter insbesondere dabei unterstützen soll, ihre neue Führungsrolle wahrzunehmen und im Zusammenhang mit Wirksamkeitsfaktoren zu reflektieren. Dazu gibt es jedoch keine Angabe zur Dauer oder dem Umfang der Qualifizierung.
9.6.4.3 Dauer der Qualifizierung für berufserfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter
Die Veranstaltungen im Rahmen der Phase Qualifizierung für berufserfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter dauern zwischen 5 Tagen in Mecklenburg-Vorpommern und 27 Tagen in Berlin/Brandenburg, wobei die meisten Qualifizierungsangebote ungefähr 10 Tage dauern. Das ist in Bayern (8,5 Tage), Nordrhein-Westfalen (10 Tage), Saarland (10 Tage) und Thüringen (12 Tage innerhalb von zwei Jahren) der Fall. Diese Qualifizierungsphase ist dabei lediglich in Bayern und Thüringen verbindlich.
In Bremen sind 18 Tage für diese Qualifizierungsphase vorgesehen, die neun je zweitägige Seminare beinhalten. Mit 160 h (27 Tage), die acht Veranstaltungen mit jeweils 20 Fortbildungsstunden à 45 min umfassen, ist die Dauer für die berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahmen von erfahrenen Schulleiterinnen und Schulleitern in Berlin und Brandenburg am längsten.
Für Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig–Holstein liegen keine konkreten Angaben zur Dauer für diese Qualifizierungsphase vor: Für Baden-Württemberg wird dazu nur angegeben, dass für Schulleiterinnen und Schulleiter berufsbegleitend und bedarfsorientiert Fortbildungsangebote in einem modularen Aufbau zur Wahl gestellt werden. Für Rheinland-Pfalz gibt es lediglich die Information, dass für Schulleiterinnen und Schulleiter eine berufsbegleitende Fortbildung zu verschiedenen Themen vorhanden ist. In Hamburg werden für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter Seminare, Tagungen und Coachings angeboten. Zu Dauer und Umfang dieser Angebote gibt es keine konkreten Angaben. Dasselbe gilt für Sachsen, wo für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter im Rahmen der Amtsbegleitung angebots- und nachfrageorientierte Fortbildungen sowie Symposien angeboten werden. In Bezug auf Sachsen-Anhalt liegt die Information vor, dass seit dem 1. April 2016 das Landesschulamt die Zuständigkeit und die Verantwortung für die amtsbegleitende Qualifizierung und Personalentwicklung übernommen hat und Schulleiterinnen und Schulleiter in diesem Rahmen zwischen der Führungsakademie, dem ESF- Projekt: „DigiLern – Steuerung von Prozessen digital vernetzten Lernens – Programm zur Fortbildung und Qualifizierung von Mitgliedern der Schulleitungen in Sachsen-Anhalt“, dem Entwicklungsprojekt „LiGa – Lernen im Ganztag“ oder individuellen/bedarfsorientierten Angeboten wählen können. Hierzu bestehen keine konkreten Angaben, welche Dauer oder Umfang für diese amtsbegleitende Qualifizierung vorgesehen ist. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) verweist in Bezug auf die Qualifizierungsphase für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter darauf, dass während der ersten beiden Jahre der Schulleitungstätigkeit für Schulleiterinnen und Schulleiter eine besondere Begleitung stattfindet – ohne nähere Angaben zur Dauer oder Umfang. In Hessen gibt es die Information auf der Internetseite des hessischen Kultusministeriums, dass auch für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter (künftig) ein Qualifizierungsangebot geplant ist, welches Schulleiterinnen und Schulleiter dabei unterstützen soll, ihre Führungskompetenzen und ihre Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln. In Niedersachsen werden als Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der berufsbegleitenden Qualifizierung im Anschluss an die verpflichtende Erstqualifikation für schulische Führungskräfte Vertiefungsthemen, bildungspolitische Themen und aktuelle Themen für schulische Führungskräfte angeboten. Diese Fortbildung umfasst drei Module, deren Umfang nicht spezifiziert ist.
9.6.5 Formate der Schulleitungsqualifizierungen
In den unterschiedlichen Qualifizierungsmaßnahmen für Schulleiterinnen und Schulleiter werden verschiedene Formate angeboten und es werden oftmals auch verschiedene Formate miteinander kombiniert.
Die Formate der Schulleitungsqualifizierungen variieren zwischen den Bundesländern (s. Abb. 9.4 Formate der Schulleitungsqualifizierungen). Die Bandbreite erstreckt sich dabei von klassischen Formaten wie Präsenz in der Gruppe (z. B. Seminare, Lerngruppe, Kolloquium), prozessbegleitenden oder schulinternen Einheiten bis zu Online-Veranstaltungen. Daneben gibt es Formate, die sich auf den spezifischen Bereich (Eigen-)Reflexion oder Feedback und Methoden wie Selbsteinschätzungen, Videoaufnahmen, Reflexions- bzw. Selbstlernphasen oder Shadowing und Hospitationen beinhalten. Einen weiteren Bereich stellen hier coachende bzw. beratende Formate wie Coaching, Supervision, Mediation, (Fall-)Beratung oder Mentoring dar.
In sieben Bundesländern werden mehrere (zwei bis drei) Formate sowie in drei Bundesländern (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig–Holstein) vier unterschiedliche Formate in den Schulleitungsqualifizierungen eingesetzt. Davon weichen lediglich Berlin und Brandenburg ab, in denen bis auf Online- und Feedbackmethoden alle Formate vorkommen und miteinander kombiniert werden, sowie Nordrhein-Westfalen. Hier werden in der Schulleitungsqualifizierung ebenfalls alle Formate – bis auf Online und Shadowing/Hospitation – verwendet.
Generell zeigt sich im Ländervergleich, dass in den meisten Ländern im Rahmen von Schulleitungsqualifizierungen klassische Formate – v. a. Präsenzveranstaltungen, z. T. auch in Form prozessbegleitender Angebote – sowie Reflexions- bzw. Selbstlernphasen sowie coachende und beratende Formate wie Coaching/Supervision dominieren.
9.6.5.1 Klassische Formate
Im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen werden Präsenzveranstaltungen in der Gruppe in sieben Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt) angeboten. In Berlin und Brandenburg bspw. beinhalten die Präsenzveranstaltungen – im Rahmen der Qualifizierungsreihe für Lehrkräfte, die ein Schulleitungsamt anstreben – neben drei Praxisseminaren auch Teamlerngruppen für die Unterstützung erforderlicher Kompetenzen sowie vier eineinhalbtägige Veranstaltungen in einer festen Gruppe, die durch eine externe Trainerin oder einen externen Trainer begleitet werden. Diese Reihe schließt mit einem Kolloquium zur Präsentation des individuellen Führungskonzepts und der Erstellung eines Leistungsnachweises ab. Neben regulären Präsenzveranstaltungen in der Gruppe gibt es in Sachsen-Anhalt noch die Besonderheit, dass mehrtägige Präsenzveranstaltungen in Form von Führungskräfte- oder Sommerakademien durchgeführt werden. In Nordrhein-Westfalen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schulleitungsqualifizierung durch die Kombination verschiedener Methoden (Fallstudien, gezieltes Handlungstraining, verschiedene Reflexionsformen, Lernen in der Gruppe) in Präsenz Prozesswissen erwerben und Handlungsstrategien erlernen.
9.6.5.2 Reflexions- bzw. Selbstlernphasen
Einen wichtigen Anteil in den Schulleitungsqualifizierungen machen Reflexions- bzw. Selbstlernphasen aus, die in knapp der Hälfte der Länder in den Qualifizierungsmaßnahmen integriert sind. Dazu zählen die Länder Berlin, Brandenburg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen. Besondere Beispiele sind Berlin und Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen, in denen umfassende Reflexions- bzw. Selbstlernphasen im Rahmen der Schulleitungsqualifizierung vorgesehen sind. Dabei werden in Berlin und Brandenburg im Rahmen der Qualifizierungsreihe für Lehrkräfte, die ein Schulleitungsamt anstreben, zum einen zwischen den einzelnen Fortbildungsangeboten Selbstreflexions- und Transferaufgaben gestellt, die zu Beginn jeder Veranstaltung aufgegriffen werden. Des Weiteren sind zwei Grundlagenseminare vorgesehen, in denen handlungsorientiert und durch Selbstreflexion Sach- und Sozialkompetenzen herausgebildet werden sollen. In Nordrhein-Westfalen ermöglichen Orientierungsseminare den angehenden Schulleitungen Reflexionen über ihr Leitungshandeln und eine Selbstprüfung bzw. -einschätzung (z. B. durch simulierte Situationen des Schulalltags). Es werden zudem theoretische und praktische Aspekte des Leitungshandelns miteinander verzahnt und mit verschiedenen Methoden, wie Austausch, praktische Übungen und Reflexion kombiniert. In einigen Bundesländern, wie Bayern, Thüringen und Sachsen, wird im Rahmen der Schulleitungsqualifizierung ein Self-Assessment eingesetzt. In Sachsen wird es zur persönlichen Potenzialanalyse verwendet und dient als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Lehrkräfte, die sich für die Übernahme einer schulischen Führungsposition interessieren. In Bayern werden im Rahmen der Vorqualifikation (Modul A) Orientierungskurse mit Assessment-Übungen zur Potenzialanalyse (A 2) angeboten.
9.6.5.3 Coachende und beratende Formate
Coachende und beratende Formate wie Coaching/Supervision werden in den meisten Bundesländern im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen eingesetzt (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein). In allen diesen Bundesländern finden im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen die Formate Einzel- oder Gruppencoaching, jedoch Supervision nur in Berlin, Brandenburg sowie in Schleswig–Holstein als ein Angebot zur Reflexion, Anwendung. In Sachsen-Anhalt wird in Bezug auf dieses Format allgemein angegeben, dass Coaching-Veranstaltungen für schulische Führungskräfte angeboten werden.
Einzelcoachings für Schulleiterinnen und Schulleiter und Führungskräfte sind Bestandteil der Schulleitungsqualifizierungen in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen). In Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden nur Einzelcoachings angeboten. In Hamburg gibt es hierbei die Besonderheit, dass die Claussen-Simon-Stiftung Coachings für schulische Führungskräfte anbietet und ein Online-Portal aufgesetzt hat, welches das Auffinden von geeigneten Coaches, das Matchen von Schulleitung und Coach und die Terminfindung erheblich erleichtern soll. Im Anschluss daran müssen sie einen Antrag auf Genehmigung des Coachings beim Referat Personalentwicklung stellen.
Darüber hinaus werden auch verschiedene Formen des Gruppencoachings in 10 Bundesländern eingesetzt (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Schleswig-Holstein). In Berlin und Brandenburg zielen die in der Schulleitungsqualifizierung eingesetzten Coachings (in Einzel- oder Gruppenform) und Supervision darauf ab, den Schulleiterinnen und Schulleitern zu ermöglichen, ihre persönlichen Dispositionen, im Abgleich mit den geforderten Kompetenzen für erfolgreiches Führungshandeln, zu reflektieren. In Mecklenburg-Vorpommern können die Teilnehmenden nach Abschluss des Kurses bis zu drei Sitzungen als Einzel- oder Gruppencoaching in Anspruch nehmen. Das Coaching verläuft berufsbegleitend über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr. In Bremen gibt es dabei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: Neben Einzel- und Teamcoaching gibt es auch ein spezielles Klärungscoaching oder Bewerbungscoaching sowie ein dafür speziell eingerichtetes 100-Tage-Telefon. In Schleswig-Holstein werden Coachings – ähnlich wie in Hessen – als ein Unterstützungsangebot aufgefasst und in Form von Dreieckscoachings oder Mediation umgesetzt. Auch in Saarland werden Teamcoachings eingesetzt, um Ziele oder Rollen etc. zu klären und eine zielorientierte Teamentwicklung sowie eine positive Kommunikation zu fördern. Das Landesinstitut für Pädagogik und Medien vermittelt auf Anfrage eine/n Coach und beteiligt sich an der Finanzierung.
9.6.5.4 (Fall-)Beratung, Mentoring und Shadowing/Hospitation
In mehreren Ländern (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig–Holstein und Thüringen) werden verschiedene Formen der (Fall-)Beratung und des Mentorings in den Schulleitungsqualifizierungen eingesetzt. Generell finden sich dazu wenig detaillierte Informationen. In Berlin und Brandenburg werden unterschiedliche beratende Formate wie Gruppen-Mentoring (durch Schulleitungen), kollegiale Fallberatung (in Lerngruppen) bzw. Intervision in den Schulleitungsqualifizierungen miteinander kombiniert. Auch in Hamburg werden kollegiale Fallberatungen und Mentoringprogramme angeboten, die speziell weiblichen Führungsnachwuchs adressieren. In den nordrhein-westfälischen Qualifizierungsmaßnahmen liegt der Schwerpunkt auf dem Einsatz von Fallberatungen – in Form von Fallberatungssitzungen, der Bearbeitung von Fallstudien, der Simulation von Konfliktfällen oder Rollenspielen. In Schleswig-Holstein wird die Fallberatung in Form einer Einzelberatung durchgeführt, die dem Training und der Vertiefung spezifischer Einzelthemen dienen. In Thüringen soll die gegenseitige Beratung in Kleingruppen den Lernerfolg im Rahmen ihrer Qualifizierungsmaßnahmen sichern.
In sechs Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Thüringen) wird zudem Shadowing bzw. Hospitation als Format in den Schulleitungsqualifizierungen verwendet. Dabei unterscheiden sich das Shadowing bzw. die Hospitation in den einzelnen Bundesländern bezüglich der Dauer und Umsetzung. Während bspw. in Berlin und Brandenburg im Rahmen der Schulleitungsqualifizierung ein dreitägiges Shadowing stattfindet, werden in Bremen eine eintägige Hospitation und in Thüringen zwei Hospitationen bei Schulleiterinnen und Schulleitern einschließlich Gesprächen in jeweils unterschiedlichen Führungsfeldern, die auch in Kleingruppen möglich sind, durchgeführt.
9.6.5.5 Ausnahmen: Onlineformate und Feedbackmethoden
Onlineformate oder internetbasierte Selbstlernprogramme (Web Based Training) im Rahmen der Schulleitungsqualifizierung stellen bislang eine Ausnahme dar und werden lediglich in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen – wo eine Online-Lernplattform (zu Dateiaustausch, Kommunikation und Kooperation der Teilnehmenden) besteht – und in Sachsen-Anhalt eingesetzt.
In Nordrhein-Westfalen sind als einzigem Bundesland darüber hinaus auch Feedbackmethoden Bestandteil der Schulleitungsqualifizierung, die mit anderen Formaten und Methoden kombiniert werden. Dazu zählen die Verwendung von Videoaufnahmen, von Frage- bzw. Selbsteinschätzungsbögen, von systematischen Beobachtungsbögen mit dem Ziel, die eigenen sowie die rollenbezogenen Führungskompetenzen realistisch einzuschätzen. Das Fortbildungskonzept sieht eine sequenzielle Folge der Fortbildungstage mit einer feststehenden Gruppe und einer definierten Leitung bzw. Begleitung vor. In Sachsen-Anhalt werden zwei Angebote im Rahmen der Qualifizierung für berufserfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter, die sich auf digitales Lernen (Projekt DigiLern) und auf die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht (Digitale Denkfabrik) beziehen, teilweise in digitaler Form angeboten.
9.6.5.6 Zu erbringende Prüfungen und Leistungen im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen
Informationen zu Prüfungen und Leistungen, die am Ende der durchlaufenen Schulleitungsqualifizierung abgelegt werden müssen, existieren nicht für die Bundesländer Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen. Diese Prüfungen und Leistungen variieren nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern können auch je nach Qualifizierungsphase unterschiedlich ausfallen.
In Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt es Eignungsfeststellungsverfahren im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen. In allen anderen Ländern erhalten die Schulleiterinnen und Schulleiter am Ende der Qualifizierungsmaßnahmen eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat. In Hessen und Nordrhein-Westfalen existieren als Schulleitungsqualifizierung vor dem Amt Eignungsfeststellungsverfahren (Assessment Center) zur Feststellung der Eignung für das Schulleitungsamt. Bei diesem Verfahren werden bestimmte (Basis-)Kompetenzen in einigen Übungen durch ausgebildete Beobachterinnen und Beobachter überprüft. In Hessen zählen dazu u. a. Belastbarkeit, emotionale Kompetenz, vernetztes Denken, Innovationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Rollenklarheit und pädagogische Kompetenz, die in fünf Übungen von dafür speziell ausgebildeten Beobachterinnen und Beobachtern auf der Basis kompetenzbezogener Kriterien bewertet werden. Die Beobachterinnen und Beobachter sind Schulleiterinnen und Schulleiter, Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamte oder Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. In allen Übungen werden mindestens zwei der genannten Kompetenzen beobachtet, wobei jede Leitungskompetenz im Vier-Augen-Prinzip bewertet wird. Die Einzelbewertungen fließen am Ende in ein Gesamtergebnis ein. In Bezug auf die Veranstaltungen der SLQ sind keine Prüfungen oder Tests geplant, da davon ausgegangen wird, dass die Teilnehmenden, die sich auf die Übernahme einer Leitungstätigkeit vorbereiten wollen, selbstverantwortlich lernen.
In der deutlichen Mehrheit der Bundesländer (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen) werden spezifische Prüfungsanforderungen bzw. Leistungserwartungen formuliert, die von den Teilnehmenden bewältigt werden müssen, um bestimmte Qualifizierungsreihen und -phasen erfolgreich abzuschließen. Dies wird in diesen Bundesländern unterschiedlich strukturiert oder streng vorgegeben. Als Leistungsdokumentation zählen neben der Teilnahme an Veranstaltungen und dem Abschluss bestimmter Module auch Präsentationen oder verschiedene Dokumentationsvorgaben wie Portfolios, Interviews etc. In Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz gibt es besonders detaillierte Vorgaben für die Prüfungen und Leistungen im Rahmen der verschiedenen Qualifizierungsphasen. In den Ländern Berlin und Brandenburg, wo für die Schulleitungsqualifizierungen gleichermaßen das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) zuständig ist, kann man nach dem Beenden des Basismoduls eine Teilnahmebescheinigung sowie nach der zielgruppenspezifischen Qualifizierungsreihe ein Zertifikat erlangen. In Rheinland-Pfalz erhält man als Teilnehmerin oder Teilnehmer ein Zertifikat, wenn man zum einen an den drei Modulen Grundlagen professioneller Kommunikation in typischen Führungssituationen, wirksam als Führungskraft in der Schule, das die Themen Rollengestaltung, Mitarbeiterführung, Prozesssteuerung, Möglichkeiten und Grenzen sowie Unterrichtsentwicklung komplett teilgenommen hat, und zum anderen auch an einer Hospitation bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter einer anderen Schule (dokumentiert durch eine Hospitationsbestätigung) teilgenommen hat. Im Rahmen der Qualifizierung neu im Amt gibt es unterschiedliche Vorgaben für die Ausstellung von Zertifikaten, die sich für die Sekundar- und Primarstufe unterscheiden. Dieses wird nur bei einer mindestens 90 %-igen Anwesenheit ausgestellt. Die Berechnungsgrundlage bilden hier die Pflichtmodule und kollegiale Arbeitsgruppen. Die teilnehmenden Schulleiterinnen und Schulleiter erhalten einzelne Teilnahmebescheinigungen und abschließend ein Zertifikat.
In Sachsen-Anhalt ist die Voraussetzung, ein Zertifikat im Rahmen der Schulleitungsqualifizierung vor dem Amt zu erlangen, dass die Teilnehmenden wenigstens sieben Module absolviert und ein individuelles Projekt durchgeführt, dokumentiert sowie präsentiert haben. Mit einer Projektpräsentation im Kolloquium schließt man auch in Thüringen die Qualifizierung vor dem Amt mit einem Zertifikat ab. Dies setzt darüber hinaus die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Veranstaltungen der Präsenzphasen und die Bearbeitung der Studien und Transferaufgaben voraus. In Mecklenburg-Vorpommern kann man sich ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme an den beiden ersten Qualifizierungsmaßnahmen ausstellen lassen. Im Rahmen der Qualifizierung vor dem Amt muss man dafür sechs Pflichtmodule absolvieren. Zudem erhalten Teilnehmende bei unvollständigem Besuch der Qualifizierungsmodule nach jedem Modul eine Teilnahmebescheinigung. Um die Qualifizierung neu im Amt abzuschließen, müssen die Schulleiterinnen und Schulleiter insgesamt an mindestens 12 Modulen (10 Pflichtmodulen und 2 Wahlpflichtmodulen) beim Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen haben.
In den Bundesländern Bayern, Bremen sowie Sachsen-Anhalt sind neben der Teilnahme an Veranstaltungen und dem Abschluss von Modulen auch die Dokumentation verschiedener Leistungen Voraussetzung für ein Zertifikat der absolvierten Schulleitungsqualifizierungen. Beispielsweise ist in Bayern seit dem Schuljahr 2009/10 geregelt, dass bei der Bewerbung auf eine Funktionsstelle als Schulleiterin oder Schulleiter ein Portfolio eingereicht werden muss, das gleichzeitig als Voraussetzung für die Bewerbung für das Modul B (Qualifizierung neu im Amt) dient. Beim Portfolio handelt es sich genau genommen um eine Nachweisliste in Form von Teilnahmebescheinigungen bzw. Zertifikaten über die besuchten 10 Tage an führungsrelevanten Fortbildungen im Modul A. Das Modul A entspricht der Qualifizierung vor dem Amt. Grundsätzlich soll das Portfolio von den Bewerberinnen und Bewerbern selbst erstellt und geführt werden. Die Veranstaltungen im Rahmen des Moduls B werden nur von der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) angeboten, wohingegen die Veranstaltungen im Rahmen des Moduls A zusätzlich auch von externen Anbietern angeboten werden. In Bremen gibt es im Rahmen der berufsbegleitenden Qualifizierung für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter die Vorgabe, dass für die Ausstellung eines Zertifikats eine regelmäßige aktive Teilnahme an mindestens 75 % des Programms gegeben sein sowie die Dokumentation von mindestens acht Intervisionssitzungen erbracht sein müssen.
9.7 Themen und Inhalte in Schulleitungsqualifizierungen
Im Folgenden werden die Themen und Inhalte analysiert, die in den Schulleitungsqualifizierungen behandelt werden. Es soll auch überprüft werden, ob die Themen und Inhalte der Schulleitungsqualifizierungen den oben beschriebenen Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern im Rahmen der Personalentwicklung zur Sicherung und (Weiter-)Entwicklung der Unterrichtsqualität entsprechen.
9.7.1 Methodisches Vorgehen und verwendete Dokumente
Im folgenden Teilkapitel werden die konzeptionellen Dokumente der 16 Länder zur Schulleitungsqualifizierung sowie die Internetseiten der dafür zuständigen Landesinstitute herangezogen, um die Themen und Inhalte in den Schulleitungsqualifizierungen zu erfassen. Die hier erwähnten Themen und Inhalte werden inhaltsanalytisch ausgewertet, indem sie verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. Sie werden dabei anhand der einzelnen Qualifizierungsphasen differenziert. Für die Analyse der Themen und Inhalte in den angebotenen Schulleitungsqualifizierungen wurde ein Kategoriensystem sowohl deduktiv – in Orientierung an Brauckmann (2014) als auch induktiv entwickelt. Dieses beinhaltet als Kategorien und Subkategorien relevante Aufgaben- und Inhaltsbereiche, welche in der Abb. 9.5 Themen und Inhalte in Schulleitungsqualifizierungen dargestellt sind.
9.7.2 Ergebnisse der Dokumentenanalyse: Beschreibung der Themen und Inhalte in Schulleitungsqualifizierungen
Die Analyse zu den Themen und Inhalten in Schulleitungsqualifizierungen zeigt, dass die Themenbereiche Unterrichtsentwicklung/Lehren und Lernen sowie Führung/Kommunikation allgemein in allen Bundesländern behandelt werden. Der Bereich Qualitätsentwicklung und -sicherung allgemein wird in den Schulleitungsqualifizierungen in allen Ländern bis auf Sachsen, Schulrecht in allen Ländern bis auf Baden-Württemberg und Personalentwicklung/-management in allen Ländern bis auf Hessen thematisiert. Im Hinblick auf die anderen Themenbereiche fällt dies deutlich heterogener aus und wird im Folgenden näher beschrieben.
Im Rahmen bestimmter Qualifizierungsangebote werden verschiedene Themenbereiche zusammen angeboten. Beispielsweise werden in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der staatlichen Qualifikationserweiterung „Schulleitungsqualifizierung (SLQ)“ künftige Schulleiterinnen und Schulleiter auf das Schulleitungsamt und dabei vor allem auf die Tätigkeitsbereiche Kommunikation und Kooperation, Personalmanagement, Qualitätsmanagement sowie Recht und Verwaltung vorbereitet. In diesen Bereichen werden Kenntnisse vermittelt, praxisorientierte Erfahrungen ermöglicht und Kompetenzen (weiter-)entwickelt. Auf diese Weise sollen grundlegende führungsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen und damit professionelles Führungshandeln kontinuierlich (weiter-)ausgebaut werden. Die SLQ berechtigt zur Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren. In den Qualifizierungsmaßnahmen in Hessen werden mehrere Module zu verschiedenen Themenbereichen, wie Kommunikation und Leitung, unterrichtswirksame bzw. -bezogene Führung, Schulbudget, Qualität und Veränderungsprozesse, angeboten.
9.7.3 Verwaltung, Organisation, Schulbudget/Finanzen und Schulrecht
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertungen bezüglich der Kategorien Verwaltung, Organisation, Schulbudget/Finanzen und Schulrecht dargestellt. Die Kategorie Verwaltung und Organisation beinhaltet allgemeine Informationen in Schulleitungsqualifizierungen zu dem verwaltungsbezogenen und organisatorischen (Aufgaben-)Bereich von Schulleiterinnen und Schulleitern. Die Kategorie Finanzen und Budget umfasst Themen zur Verwaltung und zum Management von Finanzen und Budget an Schulen. Die Kategorie Schulrecht bezieht sich auf rechtliche Grundlagen in Bereich Schule.
Die Themenbereiche Verwaltung und Organisation werden in den Schulleitungsqualifizierungen in den meisten Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen) behandelt. Dabei sind diese Themen in Bayern, Hamburg und Thüringen Bestandteil einer verpflichtenden Phase: In Bayern ist das in allen drei Phasen (A, B, C), wohingegen in Hamburg und Thüringen dies in der Phase B, d. h. in der Qualifikationsphase „neu im Amt“ der Fall. In Hamburg werden Verwaltung und Organisation im Rahmen des Pflichtmoduls Schulmanagement in der Phase Qualifikation neu im Amt thematisiert. In Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Saarland wird auf die Themenbereiche Verwaltung und Organisation im Rahmen der nicht verpflichtenden Phasen A (Qualifikation vor dem Amt) und C (berufsbegleitende Qualifikation) eingegangen: In Berlin, Brandenburg (in beiden in Modul 3) und in Saarland (in Modul 2) im Rahmen der Phase A sowie in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz im Rahmen der Phase C (berufsbegleitende Qualifikation für erfahrende Schulleiterinnen und Schulleiter). In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen (in Modul 3), Nordrhein-Westfalen (in Modul 1) sowie in Sachsen-Anhalt (im Rahmen des EFS-Projekts) werden diese Themen ebenfalls behandelt; allerdings liegen dazu keine genauen Informationen vor, ob dies im Rahmen verpflichtender Module oder Maßnahmen stattfindet.
Die Themenbereiche Schulbudget und Finanzen werden in den Schulleitungsqualifizierungen in der Hälfte der Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen) behandelt. Diese kommen in Hessen und Thüringen im Rahmen verpflichtender Phasen, d. h. in der Phase A (Qualifikation vor dem Amt) und Modul 3 in Hessen und in Phase B (Qualifikation neu im Amt) in Thüringen vor. In Berlin, Brandenburg und Hamburg sind die Themenbereiche Schulbudget und Finanzen Bestandteil nicht verpflichtender Qualifikationsphasen für Schulleitungen: Phase A (Qualifikation vor dem Amt) und Modul 3 und Phase B (Qualifikation neu im Amt) und Modul 5 in Berlin und Brandenburg sowie in Hamburg in der Phase B (Qualifikation neu im Amt). Für die Länder Niedersachsen (Modul 3), Nordrhein-Westfalen (Modul 4) und Rheinland-Pfalz (Modul B) existieren lediglich Angaben dazu, dass diese Themenbereiche in bestimmten Modulen vorkommen, aber nicht, ob die Module auch verpflichtend sind.
Im Hinblick auf das Thema Schulrecht zeigt sich ein homogenes Bild. Bis auf Baden-Württemberg wird dieses Thema in allen Ländern im Rahmen der Schulleitungsqualifizierung berücksichtigt – und in einigen Ländern sogar in zwei oder allen drei Qualifizierungsphasen. Dazu zählen Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Mecklenburg-Vorpommern wird Schulrecht sowohl in der nicht verpflichtenden Phase A (Qualifikation vor dem Amt, Pflichtmodul) und Phase C (berufsbegleitende Qualifikation, WBT), in Rheinland-Pfalz sowie in Sachsen und Schleswig-Holstein jeweils in den Phasen A und B (Qualifikation vor dem und neu im Amt) behandelt. In Thüringen ist das Thema Schulrecht sogar Bestandteil in allen drei Qualifizierungsphasen, jedoch dabei nur in Phase B und C verpflichtend. Im Rahmen verpflichtender Qualifizierungsphasen erfolgt dies in Hamburg (Pflichtmodul Schulmanagement), Hessen (Phase A, Qualifikation vor dem Amt, Modul 4) und Niedersachsen (Phase B, Qualifikation neu im Amt, Modul Recht), Rheinland-Pfalz (Phase B, Qualifikation neu im Amt, Modul 2 und Wahlpflicht) und Sachsen (Phase B, Qualifikation neu im Amt). Schulrecht ist darüber hinaus in Bayern (Phase B), Berlin (Phase B, Modul 5), Brandenburg (Phase B, Modul 5), Bremen (Phase A), Mecklenburg-Vorpommern (Phase A, Pflichtmodul), Nordrhein-Westfalen (Phase A, Modul 4), Rheinland-Pfalz (Phase C), Saarland (Phase A, Modul 2), Sachsen (Phase A), Schleswig-Holstein (Phase A) sowie Thüringen (Phase A) ebenfalls Thema in Qualifizierungsmaßnahmen von Schulleitungen, die nicht verpflichtend sind. In Sachsen-Anhalt sind Inhalte zum Schulrecht in den Schulleitungsqualifizierungen auch Bestandteil, jedoch ohne genauere Informationen zu der Phase.
9.7.4 Kommunikation und Führung
Unter die Kategorie Kommunikation und Führung werden Stellen aus den konzeptionellen Dokumenten subsumiert, die sich nicht nur auf die Themen Kommunikation und Führung allgemein, sondern auch auf die spezifischen Themen Führungsrolle, Feedback, Teamentwicklung, Werte und Haltung von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Unterrichtsbezogene Schulleitung beziehen. Darüber hinaus differenziert diese Kategorie Kooperationen – zum einen nach innen (z. B. Konferenzgestaltung), und zum anderen nach außen (z. B. schulexterne Kooperationen).
Der Bereich Führung und Kommunikation ist als Baustein in den Schulleitungsqualifizierungen in allen Ländern integriert und wird in differenzierter Weise durch verschiedene (Sub-)Themen im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen behandelt. Inhalte, die sich auf die Führung von Schulleiterinnen und Schulleitern beziehen, können in den Schulleitungsqualifizierungen in fast allen Bundesländern festgestellt werden. Werte und Haltung werden dem Bereich Führung zugeordnet und finden sich in fünf Bundesländern (Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen) in den Schulleitungsqualifizierungen: Davon in Bremen (Modul 3 und 4) und Thüringen im Rahmen der verpflichtenden Phase B, Qualifikation neu im Amt, und in Saarland ebenfalls in der Phase B (Modul 3), die jedoch hier nicht verpflichtend ist. In ebenfalls fast allen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) wird das Thema Teamentwicklung in den Qualifizierungsmaßnahmen behandelt. Feedback ist Bestandteil der Schulleitungsqualifizierungen in etwas mehr als der Hälfte der Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen). Das Thema Unterrichtsbezogene Führung wird in den Qualifizierungsmaßnahmen in Bremen, Hessen und Sachsen-Anhalt behandelt. Darüber hinaus werden im Großteil der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig–Holstein, Sachsen-Anhalt) in den Schulleitungsqualifizierungen Inhalte zu schulinternen (z. B. auf die Konferenzgestaltung) und -externen Kooperationen integriert.
Die Themen Führung und Kommunikation im Allgemeinen sind in fast der Hälfte der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen) Bestandteil einer verpflichtenden Qualifizierungsphase, überwiegend in der Phase B, also der Qualifikation neu im Amt (Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen). In Bayern und Hessen sind allgemeine Inhalte zur Führung und Kommunikation in den anderen beiden Qualifikationsphasen integriert: in Bayern sowie in Hessen (vor allem im Modul 1 und 2) in der Phase A, der Qualifikation vor dem Amt; außerdem in Phase C, der berufsbegleitenden Qualifikation, in Bayern. In Nordrhein- Westfalen erfolgt dies im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens (EFV).
In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen und Thüringen sind die allgemeinen Inhalte zur Führung und Kommunikation ebenfalls Bestandteil der Schulleitungsqualifizierungen, allerdings in einer nicht verpflichtenden Phase. In Berlin und Brandenburg betrifft das die Phase B, Qualifikation neu im Amt, und dabei das Modul 4 und in den anderen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (Pflichtmodul), Niedersachsen (Modul 1 und 2), Saarland (Modul 1), Sachsen und in Thüringen die Phase A, Qualifikation vor dem Amt. Auch in Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig–Holstein werden allgemeine Inhalte zur Führung und Kommunikation in den Schulleitungsqualifizierungen behandelt; jedoch sind dazu keine genauen Angaben vorhanden, ob dies im Rahmen verpflichtender Module oder Maßnahmen der Fall ist. Aus Sachsen-Anhalt liegt lediglich die Information vor, dass die Themen Führung und Kommunikation in allgemeiner Weise in dem digitalen Denkfabrik-Projekt integriert sind.
Das Thema Führungsrolle von Schulleiterinnen und Schulleitern ist in fünf Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen) in den Qualifizierungsmaßnahmen verpflichtend und erfolgt dabei in Baden-Württemberg, Hamburg und Thüringen im Rahmen der Phase B, Qualifikation neu im Amt, in Bayern in allen drei Qualifikationsphasen und in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens (EFV).
In Berlin und Brandenburg (Modul 4) sowie Saarland (Modul 1 und 2) ist das Thema in der Qualifizierungsphase A, neu im Amt, vorhanden, aber nicht verpflichtend. In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt hingegen ist es ebenfalls vorhanden; aber hierzu liegen keine näheren Informationen zur Verpflichtung vor. In Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein hingegen kommt dieses Thema in den Schulleitungsqualifizierungen nicht vor.
Darüber hinaus wird in Nordrhein-Westfalen (Modul 2) sowie Rheinland-Pfalz das Thema Werte und Haltungen in den Qualifikationsphasen aufgenommen; jedoch ist unklar, ob diese hier verpflichtend sind oder nicht.
Feedback ist inhaltlicher Bestandteil der Schulleitungsqualifizierungen in etwas mehr als der Hälfte der Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen) – davon in Schleswig–Holstein (in Phase B, Qualifikation neu im Amt) und Thüringen (in Phase B, Qualifikation neu im Amt, sowie in Phase C, berufsbergleitende Qualifikation für erfahrende Schulleitungen) in verpflichtenden Phasen. Des Weiteren ist in Schleswig-Holstein Feedback auch Thema in der nicht verpflichtenden Phase A (Qualifikation vor dem Amt) – genauso wie in Hamburg im Rahmen der Phase B, Qualifikation neu im Amt, sowie in Berlin und Brandenburg. In Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird dieses Thema auch behandelt, wobei unklar ist, in welcher Phase.
Das Thema Teamentwicklung kommt in den Schulleitungsqualifizierungen in fast allen Bundesländern vor – bis auf Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt: In fünf Bundesländern (Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein) in der verpflichtenden Phase B, Qualifikation neu im Amt, und in neun Bundesländern (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen) in Qualifikationsphasen, die nicht verpflichtend sind. In Berlin und Brandenburg (Modul 3) und Mecklenburg-Vorpommern (Pflichtmodul) ist das in der Phase B, Qualifikation neu im Amt; in Bremen, Nordrhein-Westfalen (Modul 3) und Schleswig-Holstein in der Phase A, Qualifikation vor dem Amt, und in Bayern und Thüringen in Phase C, berufsbergleitende Qualifikation für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter, der Fall.
Darüber hinaus wird das Thema unterrichtsbezogene Führung in den Qualifizierungsmaßnahmen in drei Bundesländern (Bremen, Hessen und Sachsen-Anhalt) integriert. Hier werden z. B. Inhalte zu neuen Aspekten der Mitarbeiterführung, zu aktuellen Ansätzen der Unterrichtsentwicklung und vor allem zur Rolle der Schulleitung in der Unterrichtsentwicklung vermittelt (und hier z. T. auch als [unterrichts-]wirksame Schulleitung bezeichnet). In Bremen findet es in einer nicht verpflichtenden Phase statt (Modul 1 und 2), wohingegen zu Hessen (Modul 2) und Sachsen-Anhalt keine näheren Informationen dazu bestehen, in welcher Phase es stattfindet.
Im Großteil der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt) werden in den Schulleitungsqualifizierungen Inhalte zu schulinternen und -externen Kooperationen behandelt. Davon werden in knapp der Hälfte der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) schulinterne und -externe Kooperationen in Qualifizierungsphasen, die nicht verpflichtend sind, thematisiert, wie z. B. in Hessen, in Rheinland-Pfalz (Wahlpflicht) und Saarland (Modul 3) in Phase B, Qualifikation neu im Amt; in Baden-Württemberg (Modul 4) und Rheinland-Pfalz in der Phase C, berufsbergleitende Qualifikation für erfahrende Schulleiterinnen und Schulleiter sowie in Bremen und Nordrhein-Westfalen (Modul 1) in der Phase A, Qualifikation vor dem Amt. In Hamburg und Thüringen (Phase B und C) passiert das im Rahmen verpflichtender Phasen. In Sachsen und Schleswig-Holstein ist es auch zwar vorhanden, jedoch ohne genauere Informationen zu den Qualifizierungsphasen.
9.7.5 Qualitätssicherung und -entwicklung
Mit der Kategorie Qualitätssicherung und -entwicklung werden Hinweise zu den im Rahmen von Schulleitungsqualifizierungen angebotenen Themen(-bereichen) Unterrichtsentwicklung bzw. Lehren und Lernen, Evaluation und die Perspektive auf Schule als Organisation erfasst.
Das Thema Qualitätssicherung und -entwicklung kommt im Allgemeinen in allen Ländern – bis auf das Saarland – in den Schulleitungsqualifizierungen vor. In der Hälfte der Länder (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen) findet das in den verpflichtenden Phasen statt: In Baden-Württemberg (Modul 1), Bremen (Modul 6 und 8), Niedersachsen (Modul 2), Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen in der Phase B, Qualifikation neu im Amt. In Bayern ist das in allen drei Phasen und in Hessen im Modul 5 in der Phase A, Qualifikation vor dem Amt, der Fall. Zu Hamburg (in der Phase B), Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gibt es keine spezifischen Informationen, ob dies im Rahmen einer verpflichtenden Phase stattfindet.
Die Themen Unterrichtsentwicklung bzw. Lehren und Lernen werden in allen Bundesländern in den Schulleitungsqualifizierungen thematisiert; in der einen Hälfte der Bundesländer (Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) in einer verpflichtenden Qualifikationsphase, die vorwiegend in der Phase B, Qualifikation neu im Amt, stattfindet. Davon weichen lediglich Hessen (Phase A, Modul 2) und Thüringen (Phase B und C) ab. In der anderen Hälfte der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen) findet das Thema in einer nicht verpflichtenden Qualifikationsphase statt, d. h. in Phase A, Qualifikation vor dem Amt, in Mecklenburg-Vorpommern (u. a. inklusive Unterrichtsentwicklung), Nordrhein-Westfalen (Modul 3), Saarland (Modul 1; zusätzlich in Phase B, Modul 3), Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen; oder in der Phase C, berufsbergleitende Qualifikation für erfahrende Schulleiterinnen und Schulleiter, in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen (Modul 2) und Rheinland-Pfalz. In Berlin und Brandenburg ist Unterrichtsentwicklung bzw. Lehren und Lernen Thema in allen Phasen der Schulleitungsqualifizierungen (Phase A, Modul 5; Phase B, Modul 2; Phase C). In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen werden Inhalte zu Unterrichtsentwicklung bzw. Lehren und Lernen in sowohl verpflichtenden als auch nicht verpflichtenden Phasen der Schulleitungsqualifizierungen behandelt. In Sachsen-Anhalt ist das Thema auch in den Schulleitungsqualifizierungen – ohne genauere Informationen zu der Phase – vorhanden.
Das Thema Evaluation wurde in neun Bundesländern in die Schulleitungsqualifizierungen integriert. Davon lediglich in Baden-Württemberg und in Thüringen in der verpflichtenden Phase B, Qualifikation neu im Amt. In Bayern (Phase C), Berlin (Phase A, Modul 4), Brandenburg (Phase A, Modul 4), und Mecklenburg-Vorpommern (Phase B, Pflichtmodul) ist das Thema Evaluation Teil einer nicht verpflichtenden Phase. Bezüglich Hessen, Reinland-Pfalz (Modul 1) und Sachsen-Anhalt bestehen lediglich Informationen, dass Inhalte zur Evaluation in den Schulleitungsqualifizierungen behandelt werden.
Inhalte zur Schule als Organisation werden im Bereich Qualitätssicherung/-entwicklung in den Schulleitungsqualifizierungen in vier Bundesländern behandelt: In Niedersachsen (Modul 4) und Thüringen in der verpflichtenden Phase B, Qualifikation neu im Amt; in Sachsen und Sachsen-Anhalt, im Rahmen des digitalen Denkfabrik-Projekts, ist die Phase nicht spezifiziert.
9.7.6 Personalentwicklung
Die Kategorie Personalentwicklung setzt sich zusammen aus den Bereichen Personalentwicklung und -management, Unterrichtsbeurteilung und -beobachtung sowie den Instrumenten der Personalentwicklung wie Zielvereinbarung, dienstliche Beurteilung und Mitarbeitergespräch.
Im Hinblick auf das Thema Personalentwicklung/-management zeigt sich, dass es in allen Ländern – bis auf Hessen und Mecklenburg-Vorpommern – in den Schulleitungsqualifizierungen vorhanden ist und in etwas weniger als der Hälfte der Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz) im Rahmen einer verpflichtenden Phase. Dies findet in den meisten Bundesländern in der Phase B, der Qualifikation neu im Amt, statt: Baden-Württemberg (Modul 1), Bremen (Modul 5), Hamburg, Niedersachsen (Modul 3), Rheinland-Pfalz (Modul 4 und Wahlpflicht für Phase B) – bis auf Bayern, wo Inhalte zu Personalentwicklung/-management im Rahmen von Phase A, Qualifikation vor dem Amt, und C, berufsbergleitende Qualifikation für erfahrende Schulleiterinnen und Schulleiter, integriert werden. In den restlichen Bundesländern, d. h. Berlin und Brandenburg (Phase A, Modul 1; Phase B, Modul 3; Phase C), Nordrhein-Westfalen (Phase A, Modul 2), Rheinland-Pfalz (Phase C), Saarland (Phase B, Modul 3), Sachsen (Phase A), Schleswig-Holstein (Phase A und B) und Thüringen (Phase A sowie Phase B und C) wird Personalentwicklung/-management in den Phasen behandelt, die im Rahmen von Schulleitungsqualifizierungen verpflichtend sind. Sachsen-Anhalt weicht dahin gehend ab, da unklar ist, ob dies in einer verpflichtenden Phase geschieht.
Unterrichtsbeurteilung und -beobachtung als Bestandteil von schulischer Personalentwicklung wird in der Hälfte der Bundesländer in den Qualifizierungsphasen behandelt (Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen). Dieser Inhalt ist in den meisten Bundesländern nicht verpflichtend, wie in Bayern, Berlin (Phase A, Modul 5), Brandenburg (Phase A, Modul 5), Hamburg und z. T. in Schleswig–Holstein (Phase A). Lediglich in Schleswig-Holstein in der Phase B sowie Thüringen im Rahmen der Phase C ist dieser Inhalt verpflichtend. Für Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz existieren keine Informationen zur Verpflichtung.
Zentrale Instrumente der Personalentwicklung, wie Zielvereinbarungen, dienstliche Beurteilungen und Mitarbeitergespräche, werden ebenfalls in den verschiedenen Phasen der Schulleitungsqualifizierungen in unterschiedlichem Ausmaß thematisiert.
Während Zielvereinbarungen lediglich in Bayern und Thüringen – in den verpflichtenden Phasen B und C – im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen vorkommen, ist dies im Hinblick auf Mitarbeitergespräche in der Mehrheit der Bundesländer der Fall (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen) und lässt sich folgendermaßen differenzieren: in Thüringen im Rahmen der verpflichtenden Phase C, in Berlin, Brandenburg, Hamburg (Phase 3), Mecklenburg-Vorpommern (Phase B, Pflichtmodul) und Saarland (Phase B, Modul 3) im Rahmen einer nicht verpflichtenden Phase sowie in Niedersachsen (Modul1), Nordrhein-Westfalen (Modul 2) und Rheinland-Pfalz ohne nähere Angaben zur Phase.
Inhalte, die sich auf die dienstliche Beurteilung beziehen, lassen sich in sechs Bundesländern in den Maßnahmen der Schulleitungsqualifizierungen finden. In Thüringen sind sie im Rahmen der verpflichtenden Phase C integriert, darüber hinaus sind sie auch in Bayern, Berlin und Brandenburg vorhanden, jedoch nicht verpflichtend. Für Niedersachsen (Modul 3) und Rheinland-Pfalz bestehen keine Informationen zur Verpflichtung.
9.8 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der vorliegenden umfassenden Analyse wurden die Regelung und Ausgestaltung der Qualifizierungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter – mit Schwerpunkt auf dem Anforderungsbereich Personalführung, Personalentwicklung und Personalmanagement – für die 16 Länder vergleichend erfasst und systematisiert. Da die Verpflichtung und Anerkennung der Qualifizierungsangebote und -maßnahmen für Schulleitungen im Fokus der Analyse standen, wurden dafür ausschließlich solche von staatlichen Institutionen (wie Landesinstitute, (Kultus-)Ministerien oder Behörden, Akademien/Zentren für Führungskräfteentwicklung) berücksichtigt und weitere Qualifizierungsangebote und -maßnahmen von externen, privaten bzw. freien Anbietern vernachlässigt.
Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse zeigen eine uneinheitliche Regelung und Ausgestaltung der Führungskräfte- und Schulleitungsqualifizierung in Deutschland auf, die sich in sehr unterschiedlich ausgeprägten Qualifizierungsmaßnahmen und -wegen mit differenten Vorgaben, Voraussetzungen sowie Modalitäten in den einzelnen Bundesländern äußern. Hierbei stechen vor allem folgende Punkte heraus:
-
Art, Umfang und Detailtiefe der Informationen zur Schulleitungsqualifizierung weichen in den Bundesländern stark voneinander ab. Das Spektrum ist groß: Während in einigen Bundesländern Informationen zur Führungskräfte- und Schulleitungsqualifizierung sehr differenziert in Form von Broschüren, Handbüchern oder Qualifizierungskonzepten (z. B. in Nordrhein-Westfalen) zur Verfügung gestellt werden, ist der Zugang dazu in anderen Ländern durch geschützte Portale auf der Homepage des Landesinstituts oder durch zum Teil fehlende (nähere) Informationen deutlich erschwert.
-
Angaben zur Verpflichtung von Maßnahmen und Angeboten sind in den Dokumenten und auf den Homepages der Landesinstitute und -akademien in einigen Bundesländern schwierig zu ermitteln (z. B. der Unterschied von Berlin und Brandenburg, obwohl das LISUM für die Schulleitungsqualifizierung in beiden Ländern zuständig ist, ist in Brandenburg die vorbereitende Qualifizierung allerdings nicht verpflichtend). Die Angaben sind nicht immer eindeutig formuliert und ermöglichen einen gewissen Interpretationsspielraum (in einigen Bundesländern werden die Qualifizierungsangebote als notwendig, empfehlenswert, als ein „Muss“ etc. beschrieben). Oftmals bleibt undurchsichtig, welche Module oder Angebote in den einzelnen Qualifizierungsphasen dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich zuzuordnen sind und wie sie zueinanderstehen. Auch Informationen zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt sowie zu den Prüfungen und Leistungen sind nicht immer eindeutig formuliert und teilweise schwierig zu erfassen. Auch die Recherche der zuständigen Institutionen für die Führungskräfte- und Schulleitungsqualifizierung stellte sich in einigen Fällen als herausfordernd heraus, da z. B. mehrere Institutionen für die gesamte Qualifizierung oder einzelne Phasen verantwortlich sein können (wie in Sachsen-Anhalt).
-
Die Ausgestaltung der Führungskräfte- und Schulleitungsqualifizierung wird durch unterschiedliche Vorgaben und Regelungen der zuständigen Institutionen mehr oder weniger strukturiert (z. B. modularer Aufbau, Integration von spezifischen Programmen, Eignungsfeststellungsverfahren oder Studiengängen). Zwar ist in den meisten Bundesländern dieselbe Grobstruktur mit den drei Phasen – Qualifizierung vor dem Amt – Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern, die neu im Amt sind – (berufsbegleitende) Qualifizierungen für erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter – vorhanden. Aber davon weichen einige Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen ab, deren Schulleitungsqualifizierung in vier Phasen gegliedert ist, oder Nordrhein-Westfalen und Hessen, die hier zusätzlich ein Eignungsfeststellungsverfahren für Schulleiterinnen und Schulleiter integriert haben. Des Weiteren sind in den Bundesländern die Phasen in unterschiedlichem Grad aufeinander bezogen (z. B. werden in einigen Bundesländern in der Vorqualifikationsphase die Inhalte aus der Orientierungsphase vertieft oder die Neu-im-Amt-Phase baut inhaltlich auf die Vorqualifikationsphase auf). Auch werden die Phasen teilweise nicht einheitlich benannt – so werden sie in Bayern anhand von Modulen oder in anderen Bundesländern als Basismodule wie in Berlin und Brandenburg, Orientierungskurse/-phase (Sachsen) oder Klärungsseminare (Hamburg, Niedersachsen) bezeichnet.
-
Sehr heterogen stellen sich beim Vergleich der Schulleitungsqualifizierungen die Dauer und der Umfang der Qualifizierungsangebote dar. Im Hinblick auf die Qualifizierungsangebote reicht die Spannweite von mindestens 12 h (2 Tage) bis 198 h (33 Tage). Betrachtet man davon nur die verpflichtenden Phasen, variiert hier die Dauer der Qualifizierungsangebote für (zukünftige) Schulleiterinnen und Schulleiter zwischen 30 h (5 Tage) und 198 h (33 Tage). Bei der Analyse der einzelnen Phasen zeigt sich folgendes Bild: Die Qualifizierungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter variieren in der Phase vor dem Amt zwischen 12 h (2 Tage) und 144 h (24 Tage), für die Phase neu im Amt beträgt die Dauer zwischen 18 h (3 Tage) und bis zu maximal 198 h (33 Tage) und für die Angebote im Rahmen der Phase Qualifizierung für berufserfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter dauern zwischen 30 h (5 Tage) und 160 h (27 Tage).
-
Auch die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Schulleitungsqualifizierung und für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt, die Formate der Schulleitungsqualifizierungen sowie zu erbringenden Prüfungen und Leistungen im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen zeigen im Bundeslandvergleich deutliche Unterschiede. Hessen und Nordrhein-Westfalen können hier durch den Einsatz von verpflichtenden Eignungsfeststellungsverfahren als besondere Beispiele aufgefasst werden, die in beiden Bundesländern Voraussetzungen für die Bewerbung um ein Schulleitungsamt sind.
-
Nordrhein-Westfalen und Bayern können hier als Beispiele mit einer besonders systematischen, aufeinander abgestimmten Schulleitungsqualifizierung herausgegriffen werden. In Nordrhein-Westfalen wird das durch das Gesamtkonzept Leitungsqualifizierung und den Runderlass „Handlungsfelder und Schlüsselkompetenzen für das Leitungshandeln in eigenverantwortlichen Schulen in NRW“ von 2008 gewährleistet. Im Runderlass sind die Schlüsselkompetenzen Rollenklarheit, Kommunikation, Innovation und Management als Leitungskompetenzen für verschiedene leitungsrelevante Handlungsfelder festgelegt. Durch die angebotenen verschiedenen Qualifikationsmaßnahmen und -phasen sollen diese Schlüsselkompetenzen entwickelt und ausgebaut werden. In Bayern zeigt sich die Systematik der Schulleitungsqualifizierung vor allem durch ein Ausbildungscurriculum und eine systematisch aufeinander aufbauende, modulare Strukturierung der Schulleitungsqualifizierung. Das heißt, dass die Inhalte in der Schulleitungsqualifizierung in einem Ausbildungscurriculum festgelegt sind, das sich in die Module Vorqualifikation (A), Ausbildung (B) und Berufsbegleitung (C) unterteilen lässt.
-
Als sehr ausdifferenziert kann die Qualifizierung für schulische Führungspersonen bzw. an Führungsaufgaben interessierten Lehrkräfte in Bremen beurteilt werden, wo verschiedene Programme und Projekte (ORIENT, FüNF, FLeMi) entwickelt wurde. Dazu zählt u. a. das FLeMi-Projekt, das Führungskräftenachwuchs von Lehrenden mit eigener oder familiärer Migrationsbiografie anspricht und in der Form einzigartig ist.
-
Auch in Bezug auf die Formulierung der Schulleitungsaufgaben sind einige Unterschiede zwischen den Ländern zu verzeichnen. Grundsätzlich variieren die Aufgabenbeschreibungen, abgesehen in den Schulgesetzen und Dienstordnungen zwischen den Ländern. Es bestehen deutliche Unterschiede dahin gehend, wie detailliert und konkret bestimmte Aufgaben definiert werden, welche Begrifflichkeiten dabei verwendet werden sowie ob und welcher Bezug zwischen den Aufgabenbereichen hergestellt wird (z. B. Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung). Die Unterschiede werden dabei besonders hinsichtlich des Umfangs, der Tiefe und des Verbindlichkeitsgrads der beschriebenen Aufgaben deutlich.
Zudem lässt sich auf Basis der vorliegenden Analysen zusammenfassen, dass die rechtlichen Vorgaben zu den Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern im Rahmen der Personalentwicklung sowie der Sicherung und (Weiter-)Entwicklung der Unterrichtsqualität und die Themen und Inhalte der Schulleitungsqualifizierungen bislang nur bis zu einem gewissen Grad aufeinander zugeschnitten sind. Während im überwiegenden Teil der Länder die Überprüfung der Unterrichtsqualität und die Durchführung von Unterrichtsbesuchen als Aufgaben von Schulleiterinnen und Schulleitern definiert sind, werden Themen und Inhalte zur Unterrichtsbeurteilung/-beobachtung lediglich in der Hälfte der Bundesländer in den Schulleitungsqualifizierungen integriert, davon nur in zwei Bundesländern in verpflichtenden Qualifizierungsphasen. Der Bereich Personalentwicklung/-management wird im Allgemeinen zwar in fast allen Bundesländern im Rahmen der Schulleitungsqualifizierungen und dabei mehrheitlich in nicht verpflichtenden Qualifizierungsphasen thematisiert, in den Schulgesetzen und Dienstordnungen finden sich entsprechende Aufgabenbeschreibungen jedoch nur in vier Bundesländern. Was die dienstliche Beurteilung betrifft, wird diese, obwohl sie in allen Ländern eine zentrale Aufgabe der Schulleitungen ist, nur in einem Teil der Qualifizierungsangebote thematisiert. Zielvereinbarungen sind nur in zwei Ländern Thema in den Qualifizierungsmaßnahmen. Auch für Mitarbeitergespräche werden Schulleitungen nur in neun Ländern qualifiziert. Eine Diskrepanz zwischen Aufgaben und Qualifizierungsangeboten konnte auch für das Thema Beratung festgestellt werden, das in vielen Ländern als Aufgabe der Schulleiter/innen definiert wird. Als explizites Thema taucht das Führen eines Beratungsgesprächs in den Angeboten zur Qualifizierung nicht auf. Allerdings wird in neun Ländern das Feedback von Schulleiterinnen und Schulleitern an Lehrkräfte thematisiert.
Grundsätzlich ist bei der Analyse der Angebote aufgefallen, dass aktuelle Herausforderungen und Entwicklungserfordernissen wozu bspw. Inklusion und Digitalisierung zählen, bislang noch kaum Bestandteil der Qualifizierungsangebote für Schulleiterinnen und Schulleiter sind.
Change history
01 February 2023
Einige Korrekturen wurden im Zuge der Produktion des Buchs übersehen. Neben einigen kleineren Korrekturen wurde die Darstellung des Herausgebenden- und Autor*innenverzeichnisses vereinheitlicht und eine zentrale Widmung hinzugefügt.
Notes
- 1.
Im Rahmen dieser Analyse wird auf dienstliche Beurteilungen nicht näher eingegangen. Eine umfassende Analyse zu dienstlichen Beurteilungen von Lehrkräften in allen vorhandenen juristischen Dokumenten findet sich im Kap. 5 von Thiel et al. in diesem Band. Grundsätzlich müssen sie für alle Beamtinnen und Beamten und analog für die Angestellten im öffentlichen Dienst erstellt werden. Die Verfahren sind in den entsprechenden beamtenrechtlichen Regelungen auf Landesebene festgelegt. In acht Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhien-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen) werden dienstliche Beurteilungen auch in den Dienstordnungen und Schulgesetzen ausdrücklich genannt.
- 2.
§ 71 BbgSchulG.
- 3.
§ 69 Abs. 1 bln SchG.
- 4.
§ 27 Abs. 1 bay LDO.
- 5.
§ 17 Abs. 3 und 4 hess LDO.
- 6.
§ 20 Abs. 1 nrw ADO.
- 7.
Nr. 2.3.2 rp DO-Schulen.
- 8.
§ 3 Abs. 1 saarl ADOS.
- 9.
§ 42 Abs. 1 SächsSchulG.
- 10.
§ 43, Absatz 4 NSchG.
- 11.
§ 20, Absatz 2 nrw ADO.
- 12.
Absatz 2.1.5 rp DO-Schulen.
- 13.
§ 17 Abs. 2 brem LDO.
- 14.
§ 3, Absatz 5 sh Lehrerdienstordnung.
- 15.
§ 20, Absatz 2 nrw ADO.
- 16.
§ 27, Absatz 3 bay LDO.
- 17.
§ 18, Absatz 1 hess LDO.
- 18.
§ 41, Absatz 2 bw SchG.
- 19.
§ 42, Absatz 2 SächsSchulG.
- 20.
§ 26 Abs. 5 SchulG LSA.
- 21.
§ 33, Absatz 2 sh SchulG.
- 22.
§ 88, Absatz 2, Punkt 3 SchulG HE 2017.
- 23.
§ 88, Absatz 2, Punkt 4 SchulG HE 2017.
- 24.
§ 27, Absatz 3 bay LDO.
- 25.
§ 28, Absatz 4 a bay LDO.
- 26.
2.1.4 rp DO-Schulen.
- 27.
§ 19, Absatz 2 nrw ADO.
- 28.
§ 26, Absatz 2 rp SchulG.
- 29.
§ 3, Absatz 7 sh Lehrerdienstordnung.
- 30.
Vierter Teil, § 18, Absatz 1 hess LDO.
- 31.
§ 70, Absatz 1 BbgSchulG.
- 32.
Vierter Teil, § 17, Absatz 2 hess LDO.
- 33.
§ 88, Absatz 5 SchulG HE 2017.
- 34.
§ 17 Abs. 1 Nr. 3 brem LDO.
- 35.
§ 88, Absatz 5 SchulG HE 2017.
- 36.
§ 101 Abs. 4 mv SchulG M-V.
- 37.
§ 17 Abs. 1 Nr. 3 brem LDO.
- 38.
§ 20, Absatz 1 nrw ADO.
- 39.
§ 34, Absatz 3 th LDO.
- 40.
§ 89, Absatz 1 HmbSG.
- 41.
§ 30, Absatz 3 nrw ADO.
- 42.
§ 17 Abs. 1 Nr. 3 brem LDO.
- 43.
§ 25, Absatz 2, 1 bay LDO.
- 44.
§ 25, Absatz 1, 3 bay LDO.
- 45.
In Rheinland-Pfalz kann man als Schulleiterin oder Schulleiter für den Bereich Primarstufe zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Entweder man absolviert 5 Pflichtmodule, die sich aus 10 Tagen innerhalb eines Jahres und 4 Nachmittagen (entspricht zwei Tagen) zusammensetzen. Damit kommt man dann insgesamt auf 12 Tage. Die zweite Möglichkeit umfasst 3 Pflichtmodule mit 4,5 Tagen innerhalb eines Jahres und 2 Nachmittagen (entspricht einem Tag) und insgesamt 33 h ergeben. Diese zweite Möglichkeit gilt auch für Schulleiterinnen und Schulleiter für den Bereich Sekundarstufe, die neu im Amt sind.
Literatur
Anderegg, N. & Breitschaft, J. (2020). Aus- und Weiterbildung von Schulleitenden in der deutschsprachigen Schweiz. DDS – Die Deutsche Schule Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis., 112(3), 302–309.
Berkemeyer, J., Berkemeyer, N. & Meetz, F. (Hrsg.). (2015). Professionalisierung und Schulleitungshandeln. Wege und Strategien der Personalentwicklung an Schulen. Weinheim: Beltz Juventa. Verfügbar unter: http://content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941392
Bonsen, M. (2010). Schulleitungshandeln. In H. Altrichter & K. Maag Merki (Hrsg.), Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem (S. 277–295). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Brauckmann, S. (2014). Ergebnisbericht im Rahmen des BMBF-Forschungsschwerpunkts „Steuerung im Bildungssystem“ (SteBis) geförderten Forschungsprojekts „Schulleitungshandeln zwischen erweiterten Rechten und Pflichten (SHaRP). Berlin: DIPF.
Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT - Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.). (2008). Was Schulleiter als Führungskräfte brauchen. Eine Bestandsaufnahme von Aufgaben, Kompetenzprofilen und Qualifizierungen von Schulleitern in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Köln.
Erckrath, M. (2020). Auswahl und Qualifizierung zukünftiger Schulleitungen. Organisationstheoretische Analysen zur Implementierung eines Assessment-Centers (Research). Wiesbaden: Springer VS.
Harazd, B., Gieske, M. & Rolff, H.‑G. (2008). Herausforderungen an Schulleitung: Verteilung von Verantwortung und Aufgaben (Bd.15.). Weinheim und München: Juventa.
Huber, S. G. (2007). Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern – Internationale Trends, die Frage der Zuständigkeit und Anregungen für Deutschland. Grundwissen Schulleitung- Handbuch für das Schulmanagement. LinkLuchterhand, S. 144–151.
Huber, S. G. (2015). Führungskräfteentwicklung als systematischer und kontinuierlicher Prozess. Überblick über aktuelle Entwicklungen in den deutschsprachigen Ländern. In J. Berkemeyer, N. Berkemeyer & F. Meetz (Hrsg.), Professionalisierung und Schulleitungshandeln. Wege und Strategien der Personalentwicklung an Schulen (S. 96–112). Weinheim: Beltz Juventa.
Klein, E. D. & Tulowitzki, P. (2020). Die Fortbildung von Schulleiter*innen in Forschung und Praxis – Ein Systematisierungsversuch. Die Deutsche Schule, 112(3), 257–276.
KMK. (2004). Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss der KMK vom 16.12.2004.
KMK. (2020). Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2020.
Meyer, A., Richter, D., Marx, A. & Hartung-Beck, V. (2019). Welche Aufgaben haben Schulleitungen heute? Eine Analyse von Schulleitungsaufgaben im innerdeutschen Vergleich. Zeitschrift für Bildungsverwaltung, 35(2).
Pham-Xuan, R. & Ammann, M. (2020). Schulleitung in Österreich:. Zwischen Leadership und Schulmanagement. Die Deutsche Schule, 112(3), 296–301.
Rosenbusch, H. S. (2005). Organisationspädagogik der Schule. Grundlagen pädagogischen Führungshandelns (Wissen & Praxis Bildungsmanagement, Bd. 2). München: Luchterhand.
Rosenbusch, H. S. & Warwas, J. (2007). Schulleitung als Profession. Grundwissen Schulleitung. Handbuch für das Schulmanagement. Köln: LinkLuchterhand.
Schratz, M. (2015). Personalentwicklung braucht Leadership. In J. Berkemeyer, N. Berkemeyer & F. Meetz (Hrsg.), Professionalisierung und Schulleitungshandeln. Wege und Strategien der Personalentwicklung an Schulen (S. 70–94). Weinheim: Beltz Juventa.
Tulowitzki, P., Hinzen, I. & Roller, M. (2019). Die Qualifizierung von Schulleiter*innen in Deutschland – ein bundesweiter Überblick. DDS – Die Deutsche Schule, 111(2), 149–169.
Tulowitzki, P. & Kruse, C. (2020). Qualifikation für Schulleitung und besondere Aufgaben. In M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung (S. 360–368). Bad Heilbrunn: Klinkhardt/UTB.
Wissinger, J. (2000). Rolle und Aufgaben der Schulleitung bei der Qualitätssicherung und -entwicklung von Schulen. Zeitschrift für Pädagogik, 46(6), 851–865.
Verzeichnis der Rechtsquellen der Länder
Bw SchG. Schulgesetz für Baden-Württemberg vom 01.08.1983 i.d.F. vom 19.03.2020 (GBl. 1983, 397, K.u.U. 1983, 584, S. 53).
Bay LDO. Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bayern vom 05.07.2014 i.d.F. vom 12.2019 (KWMBl. S. 112; BayMBl. Nr. 331).
Bln SchG. Schulgesetz für das Land Berlin vom 26.01.2004 i.d.F. vom 11.06.2020 (GVBl. 2004, 26, S. 255).
BbgSchulG. Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg vom 02.08.2002 i.d.F. vom 18.12.2018 (GVBl. I Nr. 35, 78).
Brem LDO. Verordnung über die Aufgaben der Lehrkräfte und Lehrer in besonderer Funktion an öffentlichen Schulen vom 05.08.2005 i.d.F. vom 04.02.2015.
HmbSG. Hamburgisches Schulgesetz vom 16.04.1997 i.d.F. vom 31.08.2018 (HmbGVBl. 1997, S. 97, HmbGVBl. S. 280).
Hess LDO. Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 04.11.2011 i.d.F. vom 09.11.2016 (ABl. S. 870).
SchulG HE 2017. Hessisches Schulgesetz vom 01.08.2017 i.d.F. vom 28.06.2020 (GVBl. 2017, 150).
Mv SchulG M-V. Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern. vom 10.09.2010 i.d.F. vom 02.12.2019 (GVOBl. M-V S. 172).
NSchG. Niedersächsisches Schulgesetz vom 03.03.1998 i.d.F. vom 07.11.2019 (Nds. GVBl. S. 66).
Nrw ADO. Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen vom 18.06.2012 i.d.F. vom 30.11.2014 (ABl. NRW. S. 32, 384).
Rp DO-Schulen. Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (DO-Schulen) Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 22.06.2019 (GAmtsbl. 2019, S. 151).
Rp SchulG. Schulgesetz vom 30.03.2004 i.d.F. vom 19.12.2018.
Saarl ADOS. Allgemeine Dienstordnung für Schulleiter vom 16.02.1975.
SächsSchulG. Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in der Neufassung des Sächsischen Schulgesetzes vom 27.09.2018.
SchulG LSA. Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 09.08.2018 (GVBl. LSA 2018, 244, 245).
Sh Lehrerdienstordnung. Dienstordnung für Lehrer und Lehrerinnen an allen öffentlichen Schulen im Lande Schleswig-Holstein Erlass des Kultusministers vom 17.02.1950 i.d.F. vom 18.06.1998 (NBI. Schl.-H Schulw. S. 31; zuletzt geändert durch Erlass vom 18. Juni 1998 (NBI. MBWFK. Schl.-H. S. 234)).
Sh SchulG. Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz vom 24.01.2007 i.d.F. vom 01.07.2020 (GVOBl. 2007, 39, ber. S. 276).
Th LDO. Dienstordnung für Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogische Fachkräfte an den staatlichen Schulen in Thüringen vom 30.11.2011 (GABl. 1993, 235, GABl. 2001, 326).
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Anhang: Verwendete Quellen für die Auswertung der Angebote der Schulleitungsqualifizierung
Anhang: Verwendete Quellen für die Auswertung der Angebote der Schulleitungsqualifizierung
Land | Institution | Thema |
|---|---|---|
BW | Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) | Qualifikation Schulleitung Online verfügbar unter: https://lehrerfortbildung-bw.de/q_pf/qualifikation/schulleitung/ Zugriff am 13.02.2020 Einführungsseminare für neu ernannte Schulleiterinnen und Schulleiter Online verfügbar unter: https://lehrerfortbildung-bw.de/q_pf/aufgabenbereiche/schulleit/fb_einf/ueberblick.htm Zugriff am 24.04.2020 Berufsbegleitende Fortbildungen für Schulleiterinnen und Schulleiter Online verfügbar unter: https://lehrerfortbildung-bw.de/q_pf/aufgabenbereiche/schulleit/fb_bbegl/ Zugriff am 27.04.2020 |
BY | Akademie für Lehrer-fortbildung und Personal führung (ALP) Bayerisches Staats-ministerium für Unterricht und Kultus | Qualifizierungslehrgänge Schulleitung Online verfügbar unter: https://alp.dillingen.de/personalfuehrung/qualifizierungslehrgaenge/ Zugriff am 24.04.2020 Führungskräftequalifizierung – Module und Lehrgangsthemen Online verfügbar unter: https://alp.dillingen.de/fileadmin/user_upload/3_Personalfuehrung/Fuehrungskraeftequalifizierung_Module_Lehrgangsthemen.pdf Zugriff am 27.04.2020 Qualifikation von Führungskräften an der Schule – Bekanntmachung vom 19. Dezember 2006 Online verfügbar unter: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV154403 Zugriff am 09.01.2020 |
BE und BB | Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg | Konzept zur Qualifizierung von schulischen Führungskräften sowie für Lehrkräfte, die das Amt als Schulleiterin/Schulleiter anstreben Online verfügbar unter: Zugriff am 09.06.2020 Qualifizierungsreihe für Lehrkräfte, die ein Amt als Schulleiterin oder Schulleiter anstreben Online verfügbar unter: Zugriff am 26.08.2021 Qualifizierungsreihe für neu ernannte Schulleiterinnen und Schulleiter Online verfügbar unter: Zugriff am 26.08.2021 Qualifizierungsreihe für berufs-erfahrene Schulleiterinnen und Schulleiter Online verfügbar unter: Zugriff am 26.08.2021 |
HB | Landesinstitut für Schule Bremen (LIS) | Orientierung in den Handlungs-feldern schulischer Führungskräfte Online verfügbar unter: https://www.lis.bremen.de/fortbildung/fuehrungskraefte/orientierungskurs-8361 Zugriff am 10.02.2020 Projekt FüNF – Führungskräfte-nachwuchsförderung Online verfügbar unter: Zugriff am 10.02.2020 Programm ProfiS für neue Schulleitungspersonen Online verfügbar unter: Zugriff am 10.02.2020 |
HH | Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Li) | Führungsnachwuchskräfte Online verfügbar unter: https://li.hamburg.de/fuehrungkraefte-nachwuchs Zugriff am 10.02.2020 Ausbildung für schulisches Führungspersonal Online verfügbar unter: https://li.hamburg.de/fuehrungkraefte-ausbildung/ Zugriff am 10.02.2020 Begleitqualifizierung Führungskräfte Online verfügbar unter: https://li.hamburg.de/fuehrungkraefte-begleitqualifizierung/ Zugriff am 10.02.2020 |
HE | Hessisches Kultusministerium Hessische Lehrkräfteakademie | Qualifizierungsmodell für künftige Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen (QSH) Online verfügbar unter: Zugriff am 02.03.2020 Qualifizierung für Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen (QSH) - Präsentation zur Pressekonferenz am 19. Juni 2017 Online verfügbar unter: Zugriff am 02.03.2020 Qualifizierung für Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen (QSH) Online verfügbar unter: https://kultusministerium.hessen.de/Schuldienst/Qualifizierung-fuer-Schulleitungen Zugriff am 04.11.2021 Qualifizierung schulischer Führungskräfte Online verfügbar unter: https://lehrkraefteakademie.hessen.de/fortbildung/fuehrungskraefte-schulen Zugriff am 10.02.2020 |
MV | Institut für Qualitäts-entwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ M-V) | Führungskräfte-Qualifizierung Online verfügbar unter: https://www.bildung-mv.de/lehrer/fort-und-weiterbildung/fuehrungskraefte-qualifizierung/ Zugriff am 10.02.2020 Gesamtüberblick und Ausschreibung zur Qualifizierung von schulischen Führungskräften ab Schuljahr 2020/2021 keine Veröffentlichung; Dokument erhalten auf Anfrage am 10.06.2020 |
NI | Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsent-wicklung (NLQ) | FüNF – Führungskräftenachwuchs- förderung Online verfügbar unter: https://www.nibis.de/fuehrungsnachwuchsfoerderung-fuenf_13273 Zugriff am 10.02.2020 Qualifizierung für neu ernannte Schulleiterinnen und Schulleiter (QSL) Online verfügbar unter: https://www.nibis.de/qualifizierung-fuer-neu-ernannte-schulleiterinnen-und-schulleiter-qsl_13275 Zugriff am 25.04.2020 Berufsbegleitende Qualifizierung für schulische Führungskräfte Online verfügbar unter: https://www.nibis.de/qbf---fuehrungskraefte_13325 Zugriff am 05.05.2020 |
NW | Landeszentrum für Schulleitungsqualifizierung/Schulmanagement NRW Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) | Gesamtkonzept Leitungsqualifizierung – Rahmenkonzept (24.3.2011) Online verfügbar unter: https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/curriculum_lq_stand_maerz_2011.pdf Zugriff am 09.06.2020 Schulleitungsqualifizierung in Nordrhein-Westfalen Online verfügbar unter: https://www.qua-lis.nrw.de/cms/upload/PDF/Broschuere_SLQ.pdf Zugriff am 13.02.2020 Eignungsfeststellungsverfahren Online verfügbar unter: https://www.qua-lis.nrw.de/schulmanagement/eignungsfeststellungsverfahren/index.html Zugriff am 25.04.2020 Schulleitungsqualifizierung (SLQ) Online verfügbar unter: https://www.qua-lis.nrw.de/schulmanagement/schulleitungsqualifizierung/index.html Zugriff am 25.04.2020 |
RP | Zentrum für Schul-leitung und Personal-führung (ZfS) | Qualifizierung für Führungs-nachwuchs Online verfügbar unter: https://zfs.bildung-rp.de/angebotsspektrum/qualifizierung-fuer-fuehrungsnachwuchs-an-bbs.html Zugriff am 13.02.2020 Verpflichtende Fortbildung für neue Schulleiterinnen und Schulleiter Online verfügbar unter: Zugriff am 13.02.2020 Verpflichtende Fortbildung für neue Schulleiterinnen und Schulleiter – Primarstufe Online verfügbar unter: Zugriff am 11.05.2020 Verpflichtende Fortbildung für neue Schulleiterinnen und Schulleiter – Sekundarstufe Online verfügbar unter: Zugriff am 11.05.2020 |
SL | Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) | Schulleiterfortbildung und Qualifizierung schulischer Führungskräfte Online verfügbar unter: https://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=482# Zugriff am 25.04.2020 Konzept zur Qualifizierung schulischer Führungskräfte Online verfügbar unter: https://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=475 Zugriff am 27.04.2020 |
SN | Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) Sächsisches Bildungs-institut | Konzeption zur Qualifizierung schulischer Führungskräfte Online verfügbar unter: https://www.lehrerbildung.sachsen.de/download/download_sbi/KonzeptionQSF.pdf Zugriff am 05.06.2020 Qualifizierung schulischer Führungskräfte Online verfügbar unter: https://www.lehrerbildung.sachsen.de/download/download_sbi/DF-FB-Qualifizierung_final.pdf Zugriff am 12.03.2020 |
ST | Landesschulamt Sachsen-Anhalt Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) | Führungskräfteentwicklung Online verfügbar unter: https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/behoerde/fuehrungskraefteentwicklung/ Zugriff am 28.04.2020 Führungskräftequalifizierung zukünftiger schulischer Führungskräfte (FKQ) Online verfügbar unter: Zugriff am 19.11.2020 |
SH | Institut für Quali-tätsentwicklung an Schulen Schleswig–Holstein (IQSH) | Angebote für schulische Führungskräfte Online verfügbar unter: Zugriff am 28.04.2020 Training zur Vorbereitung auf Schulleitungsaufgaben (TVaS) Online verfügbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Fuehrungskraefte/tvas.html Zugriff am 27.04.2020 Führungskräftequalifizierung (Schule) Online verfügbar unter: Zugriff am 05.03.2020 |
TH | Thüringer Ministerium für Bildung, Wissen-schaft und Kultur Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) | Konzeption des für das Schul-wesen zuständigen Ministeriums zur Qualifizierung von pädagogischen Führungspersonen in Schulen Online verfügbar unter: Zugriff am 02.03.2020 Gesamtüberblick Schulleitungsqualifizierung Online verfügbar unter: https://www.schulportal-thueringen.de/fuehrungskraefte Zugriff am 05.05.2020 |
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Muslic, B., Lankes, EM., Schewe, C.M., Thiel, F. (2022). Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern für Aufgaben der Personalentwicklung. In: Thiel, F., Schewe, C.M., Muslic, B., Lankes, EM., Maritzen, N., Riecke-Baulecke, T. (eds) Personalentwicklung in Schulen als Führungsaufgabe. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36925-5_9
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36925-5_9
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-36924-8
Online ISBN: 978-3-658-36925-5
eBook Packages: Education and Social Work (German Language)