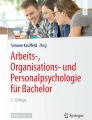Zusammenfassung
Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen und Anreize sind Instrumente einer individualisierten Personalentwicklung. Grundlage von Mitarbeitergesprächen sind häufig Unterrichtsbesuche der Schulleitung. Die entsprechenden rechtlichen Regelungen der deutschen Länder werden vergleichend dargestellt.
Mitarbeitergespräche zwischen Schulleiterinnen und Schulleitern sind prinzipiell in den meisten Ländern vorgesehen, allerdings nur in einem Teil der Länder verpflichtend. Zielvereinbarungen sind ebenfalls möglich, aber nur in wenigen Ländern verpflichtend vorgesehen. Leistungsanreize sind in Schulen derzeit nur in zwei Ländern eingeführt. Nicht-zweckbezogene Anrechnungsstunden, über die die Schulleiterin bzw. der Schulleiter entscheiden kann, sind in allen Ländern vorgesehen. Während Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen häufig verknüpft werden, ist die Gewährung von Leistungsprämien oder Anrechnungsstunden für schulbezogene Aufgaben nicht systematisch mit Zielvereinbarungen verbunden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
- Schulische Personalentwicklung
- Unterrichtsbesuche
- Unterrichtsbeobachtung
- Unterrichtsbeurteilung
- Mitarbeitergespräche
- Zielvereinbarungen
- Leistungsprämien
- Anrechnungsstunden
Personalentwicklung kann auf die Entwicklung der gesamten Organisation oder auf die Entwicklung individueller Kompetenzen ausgerichtet sein (Holling und Liepmann 2007). Während Maßnahmen der schulinternen Fortbildung auf das gesamte Kollegium zielen, sind Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen und Anreizsysteme die wichtigsten Instrumente einer individualisierten Personalentwicklung (Bach et al. 2020). Eine individualisierte Personalentwicklung wird auch als schulleitungsgesteuerte Personalentwicklung beschrieben (Thillmann et al. 2015). Sie berührt den Bereich der Personalführung (Tarkian 2020). Anders als bei der schulinternen Fortbildung, die das Kernstück einer systematischen schulbezogenen Personalentwicklung darstellt (vgl. Kap. 8 in diesem Band) und deren Planung häufig im Rahmen der Schulprogrammentwicklung in der Verantwortung einer Steuergruppe erfolgt, spielt die SchulleitungFootnote 1 bei der individualisierten Personalentwicklung in der Regel eine aktive Rolle als Vorgesetzte.
Mitarbeitergespräche zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten ermöglichen eine Abstimmung über die Aufgaben der Beschäftigten, über die zur Aufgabenbearbeitung notwendigen Ressourcen und Bedingungen sowie über die erbrachten Leistungen. Zunächst im betrieblichen Kontext implementiert, werden Mitarbeitergespräche bereits seit einiger Zeit auch im öffentlichen Dienst als „das wichtigste Instrument einer systematischen Personalentwicklung“ (Semmler und Wewer 2005 S. 290) bezeichnet. Mitarbeitergespräche sollen „Klarheit und Sicherheit hinsichtlich der zu bewältigenden Aufgaben schaffen, die Zufriedenheit erhöhen und die Motivation verbessern und damit letztlich zu besseren Arbeitsergebnissen beitragen“ (Semmler und Wewer 2005 S. 290). Im Rahmen der Reformbemühungen des öffentlichen Dienstes in den 1990er-Jahren wurden regelmäßige Mitarbeitergespräche als dialogisch angelegte, vertrauensvolle Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden flächendeckend eingeführt (König und Rehling 2006). Mitarbeitergespräche gelten als wichtiges Element einer ziel- und ergebnisbezogenen Führung. Der Thematisierung und Bewertung von Arbeitsergebnissen kommt deshalb eine zentrale Bedeutung zu.
Im besten Fall münden Mitarbeitergespräche in Zielvereinbarungen zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten. Die Definition von Zielen dient einerseits der Fokussierung eines Kompetenzentwicklungsbedarfs (z. B. Verabredung über die Teilnahme an einem Fortbildungsangebot). Anderseits stellen Ziele Maßstäbe für die Überprüfung einer Arbeitsleistung dar. Eine Voraussetzung für die leistungssteigernden Effekte von Zielvereinbarungen ist allerdings, dass Ziele spezifisch und herausfordernd formuliert werden (Locke und Latham 2002). Ziele sollten sich nicht auf Routineaufgaben, sondern auf „Schlüsselaufgaben, die das Arbeitsgebiet prägen, zeitaufwendig sowie besonders störungs- und fehleranfällig sind und eine hohe Verbindlichkeit aufweisen, oder Sonderaufgaben (Projekte)“ beziehen (Semmler und Wewer 2005 S. 294). Dabei können Leistungsziele, die sich auf die Effektivitäts-, Effizienz- und Qualitätsaspekte der Arbeitsergebnisse beziehen, Funktionsziele, die sich aus der Wahrnehmung bestimmter (zusätzlicher) Funktionen und Aufgaben ableiten, oder Verhaltensziele, wie bspw. Zuverlässigkeit oder Kooperationsverhalten, unterschieden werden (ebd.). Zielvereinbarungen umfassen in der Regel auch ein Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung.
Anreize können die Erreichung von Zielen unterstützen, wenn sie das Commitment und das Engagement erhöhen (Locke und Latham 1990). Eine Voraussetzung ist, dass es sich hinsichtlich Qualität und Quantität um echte Anreize handelt. Die Valenz eines Anreizes bemisst sich einerseits an individuellen Präferenzen (z. B. zeitliche Entlastung vs. finanzielle Zulagen) und andererseits am Umfang bzw. Ausmaß der Anreize.
Entsprechend der oben eingeführten Unterscheidung von Leistungs- und Funktionszielen können Zulagen sowohl für besondere Leistungen (gemessen an Ergebnissen) als auch für die Übernahme bestimmter Aufgaben oder Funktionen in Aussicht gestellt werden. In der ökonomischen Forschung wird zwischen payment on input und payment on output unterschieden (Lazear 2018 S. 197). „In the context of the teaching profession, payment on input means payment on the basis of skills and time worked, whereas payment on output usually refers to some metric of the performance of the students whom they teach“ (Lazear 2003 S. 182). Payment on output ist im Schulbereich vor allem in den angelsächsischen Ländern verbreitet. Häufig wird neben den Testergebnissen von Schülerinnen und Schülern auch die Unterrichtsbeurteilung durch Schulleitungen zur Beurteilung der Leistungen von Lehrkräften herangezogen (Jacob und Lefgren 2008). Im Unterschied zum angelsächsischen payment on output, hat sich im öffentlichen Dienst in Deutschland seit den 1980er-Jahren, nicht zuletzt aufgrund von Problemen der Messbarkeit des Outputs, ein Leistungsmanagementsystem etabliert, das auf der Beurteilung einer Leistung auf der Grundlage vorher vereinbarter Ziele oder einer konkreten Aufgabenbeschreibung beruht. Die rückblickende Bewertung der Leistung im Soll-Ist-Vergleich obliegt den Vorgesetzten (Vogel 2019).
Ein wichtiger nicht-monetärer Anreiz für Lehrkräfte besteht in der Arbeitszeitgestaltung. Während in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes eine Reduktion der Arbeitszeit auf einer bestimmten Stelle aufgrund der Übernahme einer anderen Aufgabe nur in wenigen Fällen erfolgt (z. B. bei der Übernahme der Funktion einer Personalvertretung), haben zeitliche Entlastungen von der operativen Kernaufgabe des Unterrichtens in Schulen eine wichtige Anreizfunktion für die Übernahme von Funktionen in der Schulentwicklung.
Im Folgenden werden zunächst die Regelungen der Länder zur Durchführung von Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen zwischen Schulleitung und Lehrkräften dargestellt (7.1). In einem zweiten Schritt werden die monetären (7.2) und zeitlichen Anreizsysteme (7.3) der Länder für Lehrkräfte vergleichend dargestellt.
7.1 Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen zwischen Lehrkräften und Schulleitungen
Im Zuge der Verwaltungsreformen der 1990er-Jahre wurde in vielen Ländern die Entwicklung und Einführung von Personalentwicklungskonzepten beschlossen, doch finden sich diese nicht in allen Ländern und auch nicht für alle Fachministerien.
Mitunter werden vorliegende Personalentwicklungskonzepte auch nicht auf den Schulbereich angewendet oder Teile der Regelungen finden für den Schulbereich ausdrücklich keine Anwendung. Nicht selten finden sich in konzeptionellen Dokumenten Hinweise auf Mitarbeitergespräche oder Vereinbarungen, doch fehlt eine entsprechende Regelung zu diesen Personalentwicklungsinstrumenten im Schulbereich.
Neben dem Begriff des Mitarbeitergesprächs ist im schulischen Kontext eine Reihe weiterer Bezeichnungen wie z. B. Entwicklungsgespräch, Bilanzgespräch, Orientierungsgespräch oder Jahresgespräch gebräuchlich. In Anlehnung an die betriebswirtschaftliche Literatur unterscheidet Meetz folgende Formen des Mitarbeitergesprächs: Fördergespräch, Beurteilungsgespräch, Konfliktgespräch, Zielvereinbarungsgespräch und Transfergespräch (Meetz 2007 S. 82). Anschließend an die Arbeiten von Buhren und Rolff (2009) wird das Mitarbeitergespräch in Schulen häufig als Entwicklungsgespräch definiert. Entwicklungsgespräche, für die ein jährlicher Turnus vorgeschlagen wird, sollten vorwiegend eine Beratungsfunktion erfüllen. „In Entwicklungsgesprächen können sowohl Konflikte, Laufbahnberatungen als auch Zielvereinbarungen besprochen werden. In der Praxis werden häufig verschiedene Gesprächsanlässe miteinander kombiniert“ (Winkler 2013 S. 28). Auf eine dialogische Gestaltung von Entwicklungsgesprächen wird in Schulen besonderer Wert gelegt.
Von Gewerkschaftsseite werden immer wieder Bedenken gegen die Einführung von Mitarbeitergesprächen in Schulen formuliert. So bezeichnet die nordrhein-westfälische Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)Footnote 2 das Mitarbeitergespräch als Personalführungsinstrument der Privatwirtschaft, das eingebunden sei „in ein hierarchisches System, in dem Ziele von oben vorgegeben werden, ohne dass Beschäftigte beeinflussen können, ob die nötigen Ressourcen zur Erreichung der Ziele zur Verfügung stehen.“ Das Mitarbeitergespräch diene „meist der Stärkung der Führungskraft und der Vereinzelung der Mitarbeiter*innen.“ Die Kritik der Gewerkschaften bezieht sich allerdings nicht nur auf die Übertragung eines als systemfremd beschriebenen Instruments aus dem betrieblichen Kontext in die Schule, sondern auch auf eine mangelnde Beteiligung der Personalvertretungen an der konkreten Ausgestaltung. Für die Einführung von Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen besteht ein Mitbestimmungsrecht der Personalvertretungen. Dieses Mitbestimmungsrecht bezieht sich „insbesondere auf solche Maßnahmen, die das Verhalten der Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit oder ihr allgemeines Verhalten in der Dienststelle betreffen“; mitbestimmungsfrei sind dagegen „Regelungen, bei denen die Diensterfüllung eindeutig im Vordergrund steht“ (VGH Baden-Württemberg PL 15 S. 2514/99). Mitarbeitergespräche als Führungs- und Steuerungsinstrument sind häufig nicht unmittelbar auf die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben bezogen, sondern zielen auf die Verbesserung von Zusammenarbeit und Kooperation. In Bremen beispielsweise wurde eine Dienstvereinbarung mit der Personalvertretung geschlossen, die die Grundlage für Gespräche zwischen der Schulleitung und den Lehrkräften bildet; in Nordrhein-Westfalen hingegen steht die notwendige Verfahrensbeteiligung laut der GEW NRW bislang aus. Der unterschiedlichen Beurteilung der Funktionen und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitergesprächen korrespondiert der Befund, dass diese als verpflichtendes Instrument der Personalentwicklung nicht in allen Ländern implementiert sind.
Zielvereinbarungen werden im öffentlichen Dienst auf unterschiedlichen Ebenen der Organisation als Steuerungsinstrument eingesetzt. Während übergeordnete, organisationsbezogene Ziele sich auf den Leistungsauftrag einer Verwaltung oder Einrichtung beziehen, haben Zielvereinbarungen im Rahmen der Personalentwicklung die Funktion, die Nutzung und Weiterentwicklung von Kompetenzen der Mitarbeiterinnen zu unterstützen (Tondorf et al. 2004 40 ff.). Sie sind deshalb ein wichtiges Mittel der Personalführung und Personalentwicklung. Zielvereinbarungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden erfolgen in der Regel im Rahmen von Mitarbeitergesprächen. Semmler und Wewer (2005) weisen darauf hin, dass die Verabredung konkreter Ziele keinen juristischen Tatbestand darstellt, sondern „gegenseitige Selbstbindungen“ zum Ausdruck bringt (S. 294). Immer wieder wird darauf verwiesen, dass es bei der Verabredung von Zielvereinbarungen um die „Kommunikation konkreter Erwartungen“ gegenüber den Beschäftigten geht. Zielvereinbarungen scheinen auch dazu beizutragen, dass Vorgesetzte sich stärker „ihrer Kernaufgabe Führung widmen“ (Vogel 2019 S. 416). Grundsätzlich ist an die Vereinbarung von operativen Zielen zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten die Anforderung zu stellen, dass sie im Einklang stehen mit übergeordneten organisationalen Zielen (Semmler und Wewer 2005 S. 294). Wenn Zielvereinbarungen mit konkreten Anreizen kombiniert werden, muss zwangsläufig eine Evaluation der Zielerreichung erfolgen. Aber auch für den Fall einer Nutzung von Zielvereinbarungen ohne Kopplung an Anreize ist eine Überprüfung der Zielerreichung, die im nächsten Mitarbeitergespräch thematisiert wird, eine Erfolgsbedingung.
Zielvereinbarungen an Schulen sollten die „beruflichen Entwicklungsabsichten“ von Lehrkräften thematisieren und möglichst konkrete Vorhaben beschreiben. Ziele sollten entsprechend des SMART-Prinzips (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert und nach einem festgelegten Zeitraum überprüft werden (Winkler 2013 S. 30). Dabei ist darauf zu achten, dass Ziele der Lehrkräfte nicht mit Tätigkeiten verwechselt und in Einklang mit den Zielen der Schule formuliert werden (ebd.). Zielvereinbarungen werden auch häufig eingesetzt, um verbindliche Absprachen zwischen Schulleitung und Lehrkräften zu Fortbildungen zu treffen. Interessen von Lehrkräften an der beruflichen Weiterentwicklung können dabei mit schulischen Aufgaben in Form einer Karriereplanung verknüpft werden. Außerdem kann die Schulleitung, die z. B. bei einem Unterrichtbesuch einen konkreten Fortbildungsbedarf festgestellt hat, eine Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsangeboten mit der Lehrkraft vereinbaren.
Aufgrund des hohen Zeitaufwands werden allerdings häufig Bedenken hinsichtlich der praktischen Durchführung von Zielvereinbarungsgesprächen formuliert. Auch hinsichtlich möglicher Effekte werden Zielvereinbarungen mit Lehrkräften oft prinzipiell kritisch betrachtet (Meetz 2007).
Der Abschluss individueller Zielvereinbarungen in Schulen erfordert entsprechende dienstrechtliche Befugnisse, die an die Schulleiterinnen und Schulleiter übertragen werden müssen, sofern diese bindenden Charakter haben sollen. Anders formuliert: Schulleiterinnen und Schulleiter sind als Vorgesetzte nur dann befugt, Mitarbeitergespräche durchzuführen und Zielvereinbarungen abzuschließen, wenn ihnen die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse zugewiesen worden sind. In einigen Ländern wurden dementsprechende Befugnisse übertragen.
Auf Ebene der Schulgesetze und der darauf basierenden Verwaltungsvorschriften finden sich Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen nicht in allen Ländern. Zwar sind nahezu alle Schulleiterinnen und Schulleiter im Rahmen ihrer Aufgaben als Vorgesetzte allgemein zur Unterstützung und Beratung der Lehrkräfte angehalten, doch bezieht sich dies auf die dienstlichen Pflichten im engeren Sinn und kann nicht mit der Führung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen gleichgesetzt werden.
Ein wichtiger Gegenstand von Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen sind Unterrichtsbesuche bzw. die Unterrichtskompetenzen der Lehrkräfte. Unterrichtsbesuche finden nicht nur im Rahmen der dienstlichen Beurteilungen statt, sie sind für die Schul- und Personalentwicklung im Allgemeinen unabdingbar. Die Einsichtnahme in die Unterrichts- und Erziehungsarbeit wird deshalb als Aufgabe der Schulleiterinnen und Schulleiter in den Schulgesetzen und Rechtsvorschriften regelmäßig benannt. Dabei handelt es sich teilweise um eine sogenannte „Ermächtigung“, die das Recht, Unterrichtsbesuche vorzunehmen, ausdrücklich formuliert; teilweise wird eine Verpflichtung zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Unterrichts ausgesprochen bis hin zur ausdrücklichen Verpflichtung, Unterrichtsbesuche vorzunehmen. Im Zuge der gestärkten schulischen Eigenverantwortung wurden den Schulleiterinnen und Schulleitern vermehrt die Verantwortung für die pädagogische Arbeit und auch entsprechende „Kontroll-, Beanstandungs- und Eingriffsbefugnisse im Bereich der Unterrichts- und Erziehungsarbeit“ (Große 2019 S. 107) übertragen (vgl. Kap. 4). Regelungen zu Eingriffen in die Unterrichtsarbeit werden aufgrund ihrer Relevanz für Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen ebenfalls kurz dargestellt. Dabei wurde ein eng gefasstes Verständnis zugrunde gelegt, das sich vorwiegend auf ausdrückliche Regelungen und Formulierungen bezieht.
Im Folgenden werden die Regelungen der Länder zu Mitarbeitergesprächen und, wo vorgesehen, ihre Verknüpfung mit Zielvereinbarungen dargestellt (s. Abb. 7.1 Regelungen zu Mitarbeitergesprächen und Vereinbarungen als Instrument einer individualisierten Personalentwicklung an Schulen). Außerdem werden die entsprechenden Regelungen zur Durchführung der Unterrichtsbesuche (vgl. Abb. 7.3 Regelungen zur Durchführung von Unterrichtsbesuchen) und Eingriffen in den Unterricht dargestellt (vgl. Abb. 7.4 Bedingungen für den Eingriff in den Unterricht).
Baden-Württemberg verankert Mitarbeitergespräche als Aufgabe der Schulleiterinnen und Schulleiter und als ein Recht der Lehrkräfte „auf Förderung im Rahmen einer schulbezogenen und schulübergreifenden Personalentwicklung. Dies schließt Beratung und gegebenenfalls eine Vereinbarung über die Teilnahme an personenbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen ein.“Footnote 3 Dieses Recht ist Bestandteil des in „regelmäßigen Abständen“ von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu führenden Beratungsgesprächs. Während der Abschluss von Zielvereinbarungen optional ist, sind inhaltlich vier Aspekte verbindlich zu thematisieren. Dies sind 1) die Qualität der unterrichtlichen, erzieherischen und außerunterrichtlichen Arbeit, 2) individuelle Fortbildungsplanung, 3) künftige berufliche Entwicklung und 4) Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit.Footnote 4 Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden in Baden-Württemberg ermächtigt, Unterrichtsbesuche vorzunehmen.Footnote 5 Bei den regelmäßig zu führenden Beratungsgesprächen und den alle fünf Jahre zu erstellenden dienstlichen Beurteilungen ist die Qualität des Unterrichts zu erörtern bzw. zu bewerten.Footnote 6 Dafür liegt ein standardisierter Beurteilungsbogen vor. Auch im Rahmen der verpflichtenden Selbstevaluation ist der Bereich Unterricht verpflichtend und kontinuierlich zu bearbeitenFootnote 7 und die Schulleiterinnen und Schulleiter sind verantwortlich für die Einhaltung der Bildungs- und LehrpläneFootnote 8, dennoch kann nicht von einer Verpflichtung zu regelmäßigen Unterrichtsbesuchen ausgegangen werden.
Bayern hat „das Mitarbeitergespräch als neues Instrument der Personalführung für alle staatlichen Behörden“ im Jahr 1998 verbindlich eingeführt und eine Regelung für die Durchführung an Schulen erlassen.Footnote 9 Das Mitarbeitergespräch ist somit fest verankert und zeitlich zwischen den regelmäßigen Beurteilungen im Turnus von vier Jahren platziert. Doch können Mitarbeitergespräche darüber hinaus auch auf „Verlangen der Schulleitung oder der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters“ stattfinden.Footnote 10 Das Mitarbeitergespräch soll den Dialog intensivieren und die Leistungssituation der Mitarbeitenden und das Führungsverhalten der Vorgesetzten in den Mittelpunkt stellen. „Über eine intensive Aussprache soll das Verhältnis der Gesprächspartner positiv gestaltet werden. Zugleich hilft das Mitarbeitergespräch den Vorgesetzten, die Probleme, Interessen und das Leistungsvermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kennen zu lernen und darauf zu reagieren. Ferner soll es ihnen eine Rückmeldung über die eigene Leistung als Führungskraft liefern.“Footnote 11 Geführt wird das Gespräch von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bzw. an Schulen mit erweiterter Schulleitung von den Schulleitungsmitgliedern. Es werden die vier Themen 1) Zusammenarbeit und Führung, 2) dienstliche Verwendung, 3) Arbeitsbedingungen und 4) berufliche Entwicklung nahegelegt, aber nicht bindend vorgegeben.Footnote 12 Das Gespräch „führt in der Regel zu einer gemeinsamen Vereinbarung über Ziele … die sich auf die Unterrichtsarbeit, auf unterrichtliche Vorhaben, schulbezogene Aktivitäten und auf die eigene berufliche Qualifikation beziehen“Footnote 13 (s. Infobox Das Mitarbeitergespräch in Bayern). Die wesentlichen Ergebnisse des Gesprächs sind zu dokumentieren und vertraulich zu behandeln.Footnote 14 In Verbindung mit der dienstlichen Beurteilung können ebenfalls Zielvereinbarungen geschlossen werden und es findet ein Beratungsgespräch sowie mehrere Unterrichtsbesuche statt.Footnote 15 Schulleiterinnen und Schulleiter haben dafür zu sorgen, dass der Unterricht ordnungsgemäß erteilt, die Arbeit der der einzelnen Lehrkräfte aufeinander abgestimmt und die Rechts- und Verwaltungsvorschriften beachtet werden.Footnote 16 Dazu gehört auch die Aufgabe, sich über das Unterrichtsgeschehen durch Unterrichtsbesuche zu informieren und die Lehrkräfte zu beraten. Die Beobachtungen der Unterrichtsbesuche müssen mit den Lehrkräften besprochen werden.Footnote 17
Infobox Das Mitarbeitergespräch in Bayern
Themen 1) Zusammenarbeit und Führung 2) dienstliche Verwendung 3) Arbeitsbedingungen 4) berufliche Entwicklung | Gegenstand von Zielvereinbarungen: • Unterrichtsarbeit • unterrichtliche Vorhaben • schulbezogene Aktivitäten • berufliche Qualifikation (z. B. Fortbildung) |
Berlin hat das „Thema Personalentwicklung erstmals im Jahre 1999 durch das Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) verbindlich geregelt“ und im Jahr 2011 landesweit einheitliche Rahmenbedingungen für die Personalentwicklung in der Berliner Verwaltung festgelegt (Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin 2011), die sich in der BildungslaufbahnverordnungFootnote 18 niederschlagen (s. Infobox Laufbahnverordnung Berlin). Mitarbeitergespräche sind als Jahresgespräche vorgesehen. In der Bildungslaufbahnverordnung ist die Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes verankert, in dem als verbindliche Inhalte auch Ausführungen über Jahresgespräche (Mitarbeitergespräche) enthalten sein sollen (s. Infobox Definition Jahresgespräch). Im Berliner Qualitätsrahmen werden regelmäßige Mitarbeitergespräche als Indikator für die Beurteilung des Qualitätsbereichs Personalmanagement benannt (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 2013, S. 30). Der Abschluss von Vereinbarungen scheint nicht vorgesehen zu sein, jedoch Interventionen bei mangelhafter Unterrichtsqualität.
Infobox Definition Jahresgespräch
Beispiel Berlin.
Das Jahresgespräch ist ein Unterstützungs- und Fördergespräch zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der direkten Führungskraft. Es ist von Vertrauen und Offenheit geprägt und unterliegt der Vertraulichkeit. Es ist wesentliches Element einer über das Tagesgeschäft hinausgehenden Kommunikation.
Das Jahresgespräch verbindet das Personalentwicklungsgespräch, das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch (MAVG) und das Qualifizierungsgespräch nach TV-L miteinander und ersetzt diese.
Abzugrenzen ist es von informellen sowie diversen anlassbezogenen Gesprächen, insbesondere Beurteilungsgespräche, Konfliktgespräche, Gespräche zum Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement sowie Feedbackgesprächen, die durch das Jahresgespräch nicht ersetzt werden können.
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat auf die Verbesserung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit hinzuwirken“ und sich dabei „über den ordnungsgemäßen Ablauf“ zu informieren. Ein Eingriff in den Unterricht ist sowohl bei Verstößen gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Weisungen der Schulbehörden, Beschlüsse schulischer Gremien als auch bei „Mängeln in der pädagogischen Arbeit“ vorgesehen.Footnote 19 Unterrichtsbesuche werden grundsätzlich als Aufgabe der Schulleiterinnen und Schulleiter benanntFootnote 20 und sind auch verbindlicher Bestandteil der regelmäßig zu erstellenden dienstlichen Beurteilung.
Infobox Laufbahnverordnung Berlin
§ 5 Personalentwicklung.
1 Als Grundlage für eine systematische Personalentwicklung, die sich als kontinuierlicher Prozess über das gesamte Berufsleben erstreckt, ist von der Dienstbehörde ein Personalentwicklungskonzept für die Beamtinnen und Beamten ihres Bereichs zu erstellen. 2 Ziel ist es, gesunde, lernbereite sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sowie eine hohe Führungskompetenz und Führungsverantwortung in den von der Dienststelle zu verantwortenden Personalentwicklungsprozessen zu erreichen. 3 Eine systematische Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen, die es ermöglichen, die Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit den Zielen der Beschäftigten und dem Bedarf der Dienstbehörde zu fördern. 4 Das Personalentwicklungskonzept nach Satz 1 enthält mindestens Ausführungen über.
-
1.
die dienstliche Fortbildung,
-
2.
die Führungskräfteentwicklung,
-
3.
Jahresgespräche,
-
4.
Verwendungen in unterschiedlichen Funktionen oder Aufgabengebieten, sowie.
-
5.
den Erwerb interkultureller Kompetenzen sowie der Kompetenzen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Mitarbeitergespräche werden in Brandenburg als Leistungs- und Entwicklungsgespräche bezeichnet, für die eine eigene Verordnung existiert (s. Infobox Leistungs- und Entwicklungsgespräche in Brandenburg). Diese Gespräche werden mit weitreichenden Funktionen verbunden. Die Durchführung der Gespräche kann von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter an Mitglieder der erweiterten Schulleitung übertragen werden. Als Ziele werden die Verbesserung der Kommunikation, die Feststellung und Erörterung des Leistungsniveaus und die Verabredung von Entwicklungsmöglichkeiten und -zielen benannt. Der Ablauf ist klar geregelt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt im Vorfeld fest, welche Punkte besprochen werden. Dafür liegt ein merkmalsbezogener Gesprächsbogen vor (s. Abb. 7.2 Formblatt für Leistungs- und Entwicklungsgespräche mit Lehrkräften), der sich auf das Leistungsniveau der Lehrkraft mit den vier Merkmalen Unterrichten, Erziehen, Beurteilen, Innovieren sowie auf die Beurteilung von Eignung und Befähigung mit 12 Befähigungskriterien bezieht und damit große Ähnlichkeiten zur Struktur dienstlicher Beurteilungen aufweist. Dieser Gesprächsbogen ist den Lehrkräften bei der Terminvereinbarung auszuhändigen und wird nach dem Gespräch vernichtet. Der Bereich Fortbildung und Professionalisierung hat in der Verordnung eine herausgehobene Stellung, denn „Maßnahmen zur Qualifizierung sind, soweit dies möglich ist, verbindlich festzulegen“. Dafür kommt neben den klassischen Formaten der externen und internen Fortbildungen auch „die Teilnahme am Unterricht anderer Kolleginnen oder Kollegen in Betracht“. Über das Gespräch, das im Turnus von zwei Jahren zu führen ist, wird ein Vermerk in der Personalakte angelegt, wo auch die getroffenen Zielvereinbarungen oder Festlegungen weiterer Maßnahmen festgehalten werden.Footnote 21
Infobox Leistungs- und Entwicklungsgespräche in Brandenburg
3 Zweck
-
1)
Leistungs- und Entwicklungsgespräche dienen neben der Verbesserung der Kommunikation der Feststellung und Erörterung des Leistungsniveaus sowie der Verabredung von Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungszielen der Lehrkräfte.
-
2)
Den Lehrkräften soll das Leistungs- und Entwicklungsgespräch dazu dienen, die eigenen Leistungen im Dialog zu reflektieren und Erwartungen gegenüber der Schulleitung zu formulieren und deren Arbeit kritisch zu reflektieren, damit weitere Verbesserungen für den Arbeitsprozess ermöglicht werden können.
-
3)
Leistungs- und Entwicklungsgespräche sind ein wesentliches Element der Qualitätsentwicklung, der Personalentwicklung und der Personalführung. Sie sollen die Motivation und die Leistungsbereitschaft fördern und zu einem verbesserten Arbeitsklima beitragen. Leistungs- und Entwicklungsgespräche sollen selbstverständlicher Bestandteil der Personalführung werden.
-
4)
In der Form eines vertrauensvollen Dialogs soll das Leistungsniveau betrachtet und über den Entwicklungsweg gemeinsam beraten werden. Leistungs- und Entwicklungsgespräche gelten nicht einseitig der Betrachtung der Arbeit der Lehrkräfte, sondern ebenso der Schulleitung und deren Aufgabenwahrnehmung. Ein offener Dialog vermeidet den Eindruck, einem formalisierten Beurteilungsverfahren ausgesetzt zu sein. Beide Seiten können sich als kritikfähig und kritikwürdig in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten und Erwartungen als aufgeschlossene Gesprächspartner begegnen. Leistungs- und Entwicklungsgespräche eröffnen die Chance, eingetretene Kommunikationsdefizite oder Kommunikationsbarrieren aufzuheben und die künftige Kommunikationsstruktur zu verbessern.
Als erste Aufgabe der Schulleitung wird in Brandenburg die Information über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule und die Unterstützung der Lehrkräfte und des Schulpersonals genannt. Dabei sind Unterrichtsbesuche und Beratung durch die Schulleitung verbindlich vorgesehen.Footnote 22 Die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie Eingriffe, die bei Verstößen gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Weisungen der Schulbehörden oder Beschlüsse schulischer Gremien oder bei mangelnder Qualität notwendig werden können, sind Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters.Footnote 23
In Bremen sind Gespräche zwischen Schulleiterinnen bzw. Schulleiter und Lehrkräften in regelmäßigen Abständen vorgesehen, aktuell im Turnus von drei Jahren.Footnote 24 Zur Ausgestaltung der Personalentwicklungsgespräche und Vereinbarungen wurde eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geschlossen, in welcher Ziele, Grundsätze, Rahmenbedingungen, Ablauf und Inhalte (s. Infobox Personalgespräche an Schulen in Bremen) sowie der Umgang mit Konflikten festgelegt sind. Die Gesprächsdurchführung kann auch auf andere Schulleitungsmitglieder übertragen werden, allerdings müssen die Gesprächsführenden im Vorfeld eine Schulung zu „Grundsätzen und Methoden von Personalentwicklungsgesprächen“ besuchen und sollen sich durch Fortbildung „für den professionellen Umgang mit dem Instrument des Personalentwicklungsgesprächs“ auf dem Laufenden halten.Footnote 25 Im Rahmen des Mitarbeitergesprächs soll über den Unterricht und die Arbeit der Lehrkräfte für die Schulentwicklung oder Schulorganisation gesprochen werden. Es sollen Ziele für die weitere Arbeit vereinbart und Termine für die Überprüfung der Umsetzung festgelegt werden.Footnote 26 Die Gesprächsinhalte dürfen ausdrücklich nicht für dienstliche Beurteilungen genutzt werden. Auch die getroffenen Vereinbarungen sind mit einem „Schutz“ versehen und dürfen nicht als Grundlage für leistungsbezogene Bezahlungen verwendet werden.Footnote 27 Es soll ein einvernehmliches Protokoll angefertigt und gegenseitig unterschrieben werden. Dieses Protokoll darf weder elektronisch gespeichert, noch zur Personalakte oder an Dritte weitergegeben werden, d. h., falls eine der Gesprächsparteien die Schule verlässt, wird das Protokoll der jeweiligen Lehrkraft ausgehändigt.
Infobox Personalgespräche an Schulen in Bremen
§ 1 Ziele des Personalentwicklungsgesprächs
Im Personalentwicklungsgespräch geht es um
-
einen gemeinsamen Rückblick auf die Zusammenarbeit und das bisher Erreichte
-
den Abbau von Unzufriedenheiten bzw. die Erhaltung oder Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit des pädagogischen Personals
-
die Verbesserung von Kommunikation und Kooperation zwischen Schulleitung und pädagogischem Personal
-
die Schaffung bzw. Stärkung einer auf Vertrauen basierenden Zusammenarbeit
-
die Klärung beruflicher Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und -erfordernisse des pädagogischen Personals
-
die Verbesserung der Abstimmung individueller Arbeitsgestaltung und schulischen Erfordernissen.
Auch Bremen verpflichtet die Schulleiterinnen und Schulleiter, „sich über den ordnungsgemäßen Ablauf und über die methodische und fachliche Qualität der Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu informieren und notfalls einzugreifen“Footnote 28. Ihnen wurde die Verantwortung für die „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des Unterrichts“Footnote 29 übertragen und sie sind verpflichtet, in den schulischen Gremien Beschlüsse für Unterrichts- und Erziehungsziele herbeizuführen, die sich an den „allgemeinen und fachbezogenen, an den Standards“ orientieren.Footnote 30 Gemäß der Lehrerdienstordnung sollen sie in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Lehrkräften über deren Unterricht führen und Ziele für die weitere Arbeit vereinbaren.Footnote 31 Eine Bewertung der Unterrichtsqualität findet im Rahmen der dienstlichen Beurteilung statt.
Hamburg hat Mitarbeitergespräche eingeführt und eine Handreichung für die Durchführung erstellt, die eine Themen-Checkliste und eine Vorlage für Vereinbarungen enthältFootnote 32. Es ist „mindestens einmal in dem vierjährigen Beurteilungszeitraum für die Regelbeurteilung ein leistungsbezogenes Personalgespräch“ vorgesehen, welches „spätestens ein Jahr vor der nächsten fälligen Regelbeurteilung“ zu führen ist. Dabei soll im Fall von Leistungsschwäche oder Leistungsabfall ausdrücklich darauf hingewiesen und „Anleitungen zur Förderung der Leistungen und Befähigungen gegeben werden“.Footnote 33 Das Gespräch fällt in die Zuständigkeit der Schulleiterin bzw. des Schulleiters. Auch in Hamburg sind die Schulleiterinnen und Schulleiter verpflichtet, „sich über den ordnungsgemäßen Ablauf der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit zu informieren und ihn, soweit erforderlich, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen“ sowie „die Lehrkräfte zu beraten und für ihre Zusammenarbeit zu sorgen“.Footnote 34 Sie tun dies „u. a. durch Unterrichtsbesuche, durch Einsicht in die schriftlichen Unterlagen der Klassen und die regelmäßige Durchsicht der Arbeitsberichte und Kurshefte“.Footnote 35 Im Rahmen der regelmäßigen dienstlichen Beurteilung finden ebenfalls Unterrichtsbesuche statt. Die Sicherstellung der „ordnungsgemäßen Erziehungs- und Unterrichtsarbeit“ kann auf vielfältige Weise geschehen und im extremen Fall einen Eingriff in den Unterricht erfordern.
In Hessen haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ein „Recht auf Führung von Jahresgesprächen nach Maßgabe des Erlasses Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung in der hessischen Landesverwaltung“;Footnote 36 Lehrkräfte sind allerdings seit Mitte 2018 von einer Verpflichtung ausgenommen,Footnote 37 die vorher bestanden hatte.Footnote 38 Der Abschluss von Zielvereinbarungen stellt eine Option dar. Die Verknüpfung der Jahresgespräche mit anderen Aspekten der Personalentwicklung findet sich dennoch weiterhin, so ist beispielsweise im Zusammenhang mit den Festlegungen zur Fortbildungsverpflichtung geregelt, dass die Auswertung des Qualifizierungsportfolios Bestandteil von Mitarbeitergesprächen ist.Footnote 39 Diese nunmehr freiwilligen Jahresgespräche können von allen Mitgliedern der Schulleitung geführt werden. Die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität liegt in Hessen bei der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter, was die Information über das Unterrichtsgeschehen, Beratung und ggf. das Hinwirken auf die Einhaltung der Rechts- und VerwaltungsvorschriftenFootnote 40 sowie die Sorge für die Durchführung von Unterrichtsbesuchen bei jeder Lehrkraft umfasst. Unterrichtsbesuche sollen rechtzeitig angekündigt und nachbesprochen werden. Sie können von allen Schulleitungsmitgliedern durchführt werden. Daneben sind auch Unterrichtsbesuche durch andere Lehrkräfte der Schule möglich, die auf Grundlage schulinterner Konzepte zur Förderung der kollegialen Beratung durchgeführt werden können. Eingriffe in die Unterrichts- und Erziehungsarbeit sind nur zulässig bei Verstößen gegen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, bei Verstößen gegen verbindliche pädagogische Grundsätze des Schulprogramms oder Konferenzbeschlüsse.Footnote 41
Mecklenburg-Vorpommern verankert „im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen das Recht auf Beratung als Grundlage einer gezielten Förderung von Qualifizierungsschwerpunkten“,Footnote 42 trifft jedoch darüber hinaus keine weiteren Festlegungen. Im Qualitätsrahmen werden regelmäßige Mitarbeitergespräche als Indikator des Leitungshandelns genannt. Im Vorfeld einer dienstlichen Beurteilung, die jedoch nur aus besonderem Anlass erstellt wird, ist ein Gespräch zu führen, bei dem der „Aufgabenbereich und das Leistungs- und Befähigungsbild“Footnote 43 thematisiert werden.Footnote 44 Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind verpflichtet, sich über das Unterrichtsgeschehen zu informierenFootnote 45 und ihnen obliegt die Beratung der Lehrkräfte, das Hinwirken auf die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften ebenso wie die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Unterrichts- und Erziehungsarbeit und deren Weiterentwicklung „in Zusammenarbeit mit den mit Leitungsaufgaben betrauten Lehrkräften“.Footnote 46 Da sie, „sofern erforderlich, auf einen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften entsprechenden Unterricht hinzuwirken“Footnote 47 haben, bedeutet das bei entsprechenden Verstößen notwendigerweise einen Eingriff in den Unterricht. Im Qualitätsrahmen werden regelmäßige Unterrichtsbesuche und Mitarbeitergespräche als Indikatoren guten Leitungshandelns benannt.
Niedersachsen legt im Schulgesetz fest: die Schulleiterin oder der Schulleiter „besucht und berät die an der Schule tätigen Lehrkräfte im Unterricht und trifft Maßnahmen der Personalwirtschaft einschließlich der Personalentwicklung“.Footnote 48 Zu diesen gehören gemäß der niedersächsischen Laufbahnverordnung „strukturierte Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen“.Footnote 49 Im Handlungsfeld „Schule leiten“ des Qualitätsrahmens sind sowohl Unterrichtsbesuche als auch Mitarbeitergespräche benannt. Jedoch ließ sich kein Hinweis auf eine verbindliche Einführung im Schulbereich finden, weshalb Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen als optional gewertet wurden. „Die Gesamtverantwortung für die Schule und deren Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“ liegt bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter, die auch für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu sorgen haben.Footnote 50
Gespräche zwischen der Schulleitung und den Lehrkräften sind in Nordrhein-Westfalen verbindlich nur im Rahmen der dienstlichen Beurteilung vorgesehen. Den Schulleitungen werden zwar im Erlass „Handlungsfelder und Schlüsselkompetenzen für das Leitungshandeln“ Personalführung und Personalentwicklung als Aufgaben übertragen und sie werden ausdrücklich zur Nutzung des Instrumentes Zielvereinbarung aufgefordert, dennoch sind die beiden Instrumente Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung bislang nicht verbindlich eingeführt.Footnote 51 Die Schulleiterinnen und Schulleiter sollen sich „über die Arbeit in der Schule durch Einsicht in die Unterlagen der Klassen und Kurse einschließlich der Arbeiten zur Leistungsfeststellung, aber auch durch Unterrichtsbesuche informieren und deren Ergebnis anschließend mit den Betroffenen erörtern“.Footnote 52 In die Unterrichtsarbeit darf nur „bei Verstößen gegen geltende Vorschriften, Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden oder Beschlüsse der Konferenzen oder wenn eine geordnete Unterrichts- und Erziehungsarbeit nicht gewährleistet ist“ eingegriffen werden.Footnote 53
Beratung ist im rheinland-pfälzischen Schulgesetz als Aufgabe der Schulleiterinnen und Schulleiter verankert und wird im Orientierungsrahmen Schulqualität unter Personalentwicklung weiter ausgeführt. Es existiert ein Rahmenkonzept Personalentwicklung in der Landesverwaltung, welches Mitarbeitergespräche vorsieht; jedoch konnte keine Vorgabe gefunden werden, die auf verbindliche Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen in Schulen schließen lässt. Dennoch sind die Schulleiterinnen und Schulleiter verpflichtet, die berufliche Entwicklung der an der Schule Tätigen zu fördern und sie zur Veränderung aufzufordern, wenn „das dienstliche Verhalten eines Beschäftigten zu beanstanden“ ist.Footnote 54 Zu den vorrangigen Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter gehört es, die notwendigen Bedingungen für die Erfüllung des Erziehungs- und Unterrichtsauftrags der Schule und die Einhaltung der Lehrpläne zu gewährleisten. Deshalb sollen sie sich auch durch Unterrichtsbesuche über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule informieren und die Lehrkräfte beraten. Die Unterrichtsbesuche sind i. d. R. zwei Tage im Voraus anzukündigen.Footnote 55 Die Unterrichtsbesuche können auch an die jeweilige Stellvertretung delegiert werden.Footnote 56
Für die Landesverwaltung des Saarlands wurde ein Personalmanagementkonzept entwickelt und eingeführt, das zwar in seiner Zielsetzung auch für den Bereich der Lehrkräfte gilt, doch sollen hierfür eigene Regelungen getroffen werden (Staatskanzlei des Saarlandes 2016 S. 12). Diese konnten jedoch nicht recherchiert werden. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen in den Schulen des Saarlandes bislang nicht eingeführt worden sind. Im Rahmen der dienstlichen BeurteilungFootnote 57 und im Anschluss an UnterrichtsbesucheFootnote 58 sind Gespräche vorgesehen. Interessant ist ein Passus aus der Dienstordnung, der verdeutlicht, dass den Schulleitung hier keine personalrechtlichen Befugnisse übertragen wurden: „Ist das dienstliche oder außerdienstliche Verhalten eines Lehrers zu beanstanden, so hat der Schulleiter den Lehrer zur Änderung seines Verhaltens aufzufordern. Falls keine Besserung eintritt oder falls es sich um schwere Pflichtverletzungen handelt, muss der Schulleiter der Schulaufsichtsbehörde Mitteilung machen. Er ist aber verpflichtet, dem betroffenen Lehrer vom Inhalt seiner Meldung Kenntnis zu geben.“Footnote 59 Im Rahmen der „Aufgabe, auf die Förderung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit“ hinzuwirken und sich darüber zu informieren, sind die Schulleiterinnen und Schulleiter zu Unterrichtsbesuchen verpflichtet.Footnote 60 Diese sind i. d. R. anzukündigen und danach mit den Lehrkräften zu erörtern. In den Unterricht soll nur dann eingegriffen werden, „wenn es zur rechtmäßigen, sachgerechten und geordneten Durchführung von Unterricht und Erziehung, insbesondere aus Gründen der Chancengleichheit und zum Ausgleich von Bewertungsunterschieden geboten ist.“Footnote 61
In Sachsen ist die Verantwortung der Schulleiterinnen und Schulleiter für die kontinuierliche Qualitätssicherung und -entwicklung sowie das Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept verankert.Footnote 62 In der Behördendienstordnung ist ein jährliches Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch vorgesehen, das mit einer Zielvereinbarung abschließen kann.Footnote 63 Für den gesamten Geschäftsbereich des Kultusministeriums existiert ein Personalentwicklungskonzept, das jedoch nicht auf Lehrkräfte abzielt; das Personalentwicklungskonzept für den Bereich der Lehrkräfte werde noch überarbeitetFootnote 64 (s. Infobox Personalentwicklung im Verwaltungsbereich des Sächsischen Ministeriums für Kultus). Darin findet sich ein Gesprächsleitfaden, der den Prozess von der Vorbereitung mit Themenabfrage im Vorfeld, einen thematischen Fragenkatalog sowie Vordrucke für Zielvereinbarungen und die allgemeine Dokumentation beinhaltet.
Sachsen ermächtigt und verpflichtet die Schulleiterinnen und Schulleiter zu UnterrichtsbesuchenFootnote 65, konkretisiert dies jedoch nicht weiter. Dennoch haben sie für den „geregelten und ordnungsgemäßen Schulablauf“ und die „Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften“ zu sorgen.Footnote 66 Im Rahmen der regelmäßigen dienstlichen Beurteilung, die alle drei Jahre erfolgt, sind mehrere Unterrichtsbesuche vorgesehen (vgl. Abschn. 6.3).
Infobox Personalentwicklung im Verwaltungsbereich des Sächsischen Ministeriums für Kultus
An der Personalentwicklung im Verwaltungsbereich des SMK sind … die Bediensteten, die Personalreferate sowie die Personalvertretungen beteiligt und tragen Verantwortung – je nach Stellung und Funktion in unterschiedlicher Ausprägung. (S. 13).
Das institutionalisierte Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch als Instrument der Personalentwicklung ist demgegenüber langfristig und zukunftsorientiert ausgerichtet. Es ist ein wesentliches Element einer zielorientierten Zusammenarbeit und eines kooperativ verstandenen Führungsstils und bildet die Grundlage für andere Instrumente der Personalentwicklung. Das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch findet in der Regel einmal jährlich statt; es ist abzugrenzen vom Erörterungsgespräch, das im Zuge des Beurteilungsverfahrens geführt wird. (S. 49).
Bei der Gesprächsvorbereitung sind grundsätzlich folgende Themenbereiche zu berücksichtigen
-
I.
Aufgaben, Aufgabenerfüllung und Arbeitsumfeld,
-
II.
Führung und Zusammenarbeit,
-
III.
Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten,
-
IV.
Auswertung einer bestehenden/Abschluss einer neuen Zielvereinbarung (sofern relevant).
Die Schulleiterinnen und Schulleiter in Sachsen-Anhalt sind verpflichtet, „sich u. a. durch Unterrichtsbesuche über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Schule zu informieren“ und in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Lehrkräften zu führen.Footnote 67 Zu den Unterrichtsbesuchen sind sie verpflichtet und berechtigt.Footnote 68 Für die regelmäßigen Gespräche werden fünf thematische Punkte empfohlen: a) Qualität der unterrichtlichen, erzieherischen und außerunterrichtlichen Arbeit, b) Schlussfolgerungen aus Qualitätsvergleichen wie zentralen Leistungserhebungen usw., c) individuelle Fortbildungsplanung, d) künftige berufliche Entwicklung, e) Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit. Die wesentlichen Ergebnisse sollen dokumentiert werden und „als Anknüpfungspunkt für weitere Gespräche bzw. Übereinkünfte“ dienen.Footnote 69 Die Förderung der beruflichen Entwicklung und der Fort- und Weiterbildung wird ausdrücklich als Aufgabe benannt. Dabei ist der Fortbildungsplan der Schule zu berücksichtigen und es sollen einvernehmlich Maßnahmen der Fortbildung festgelegt werden. Fortbildungsveranstaltungen „mit besonderer schulfachlicher Bedeutung“ können für bestimmte Teilnehmerkreise oder für alle Lehrkräfte verpflichtend geregelt werden.
In Schleswig–Holstein liegt eine Rahmenvereinbarung für ein ressortübergreifendes Personalentwicklungskonzept der Landesverwaltung vor. Die Schulen können weitgehend frei über die Anwendung der dort enthaltenen Instrumente entscheiden. Die beiden Instrumente Rückmeldungen an Führungskräfte und Mitarbeitergespräche sind für den Schulbereich verbindlich vorgesehen. Es existiert eine Handreichung zur Durchführung der MitarbeitergesprächeFootnote 70 an Schulen, die der o.g. Rahmenvereinbarung entspricht. Das Gespräch soll dokumentiert werden, aber – wie in Bremen – weder in die Personalakte übernommen noch an Dritte weitergeben und auch nicht im Rahmen dienstlicher Beurteilungen verwendet werden. Das Abschließen von Zielvereinbarungen wird empfohlen, stellt jedoch keine Verpflichtung dar. In der Handreichung finden sich Kriterien für die Vereinbarung von Zielen. Im Rahmen der Verantwortung für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule und der „Fortentwicklung der Qualität schulischer Arbeit einschließlich der Personalführung und -entwicklung“ sind die Schulleiterinnen und Schulleiter auch in Schleswig–Holstein verpflichtet, Unterrichtsbesuche vorzunehmen.Footnote 71 „Sie haben sich über den Stand der Arbeit in den einzelnen Klassen auf dem Laufenden zu halten“ und dazu neben den Unterrichtsbesuchen auch „Einsicht in die Arbeiten der Schüler“ zu nehmen. Dies soll in kollegialer Form geschehen und zu Besprechungen in der Lehrerkonferenz oder Fachkonferenzen führen.Footnote 72 Im Orientierungsrahmen sind regelmäßige Unterrichtsbeobachtungen und deren Auswertung im Gespräch mit der Lehrkraft als Qualitätsmerkmal definiert.Footnote 73
Thüringen verankert ein Recht auf Beratung im Rahmen der Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche.Footnote 74 Die Auswertung des Fortbildungsportfolios ist verbindlicher Bestandteil dieser Gespräche, bei dem auch Vereinbarungen zu Qualifizierungsmaßnahmen geschlossen werden sollen.Footnote 75 Es existiert ein Leitfaden zur Durchführung an den Schulen. Darin finden sich auch Themenvorschläge, die sich auf die Bereiche a) Tätigkeit, Aufgaben und Arbeitssituation, b) Entwicklungsziele und -möglichkeiten, c) Ziele, d) Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Leitungspersonen und Außenstehenden (Eltern, Institutionen) beziehen. Verantwortlich für die Gespräche sind die Schulleiterinnen und Schulleiter. Sie können diese Aufgabe jedoch auch an ihre Stellvertretungen übertragen. Es kann eine Niederschrift angefertigt und im Einvernehmen können Vereinbarungen dokumentiert werden, jedoch ist eine Weitergabe an Dritte nicht zulässig, sofern nichts anderes vereinbart wird. An die personalführende Dienststelle wird nur ein Formular mit dem Zeitpunkt der Durchführung weitergegeben.Footnote 76 Der zuständige Personalrat hat einen Leitfaden erstellt. Danach sind die Gespräche regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre durchzuführen. Sofern eine Niederschrift mit Gesprächsinhalten und ggf. Vereinbarungen angefertigt wird, darf diese nur mit ausdrücklicher Zustimmung an Dritte weitergegeben werden. Auf dem Dokumentationsbogen wird der Zeitpunkt des Gesprächs, Fortbildungswünsche bzw. Fortbildungsbedarfe und Zielvorstellungen für die weitere berufliche Tätigkeit aus Sicht der Lehrkraft und der Schulleiterin bzw. des Schulleiters festgehalten und an die personalführende Dienststelle weitergegeben. Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind verantwortlich für einen geordneten Schulbetrieb und Unterricht, sowie die Beratung der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals.Footnote 77 Um sich über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule zu informieren, sollen Schulleiterinnen und Schulleiter in Thüringen Unterrichtsbesuche durchführen und können sich zusätzlich „schriftliche Unterrichtsausarbeitungen und Aufzeichnungen vorlegen lassen“. Dabei sollen sie darauf achten, dass die „Anforderungen in den einzelnen Fächern das rechte Maß einhalten“ und auf „die Angemessenheit der Aufgabenstellung und der Benotung durch die Lehrer“.Footnote 78 Die besuchten Unterrichtsstunden sollen besprochen werden.Footnote 79
7.2 Leistungsprämien und -zulagen im Schulsystem
Im Folgenden werden zunächst die allgemeinen Regelungen des Beamtenrechts sowie die korrespondierenden Tarifregelungen für Angestellte dargestellt, die die Grundlage für eine Gewährung von Leistungsprämien und -zulagen im Schulsystem darstellen. Im Anschluss werden die Regelungen zur Gewährung von Leistungsprämien für Lehrkräfte der beiden Länder Bayern und Sachsen dargestellt. Das sind die einzigen Länder, die derzeit Leistungsprämien für Lehrkräfte vorsehen.
7.2.1 Leistungsprämien und -zulagen im öffentlichen Dienst
Im Zuge umfassender Reformen des öffentlichen Dienstes wurde in vielen europäischen Staaten die Bezahlung flexibilisiert (Demmke 2019 S. 380). Im deutschen öffentlichen Dienst wurde die rechtliche Grundlage für eine stärker an Leistungselementen orientierte Besoldung im Jahr 1997 mit dem Dienstrechtsreformgesetz gelegt. Parallel zur Verabschiedung des Gesetzes wurde die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung in Kraft gesetzt, die eine Honorierung besonderer Leistungen von Einzelnen oder Gruppen ermöglicht. Die Bundesleistungsbesoldungsverordnung (BLBV) und die dazu ergangenen Durchführungshinweise legen fest, dass eine Leistungsprämie oder -zulage nur aufgrund einer „herausragend besonderen Leistung“ gewährt werden darf, die eine anforderungsgemäße Leistung erheblich übertrifft.Footnote 80 Die Entscheidung über die Gewährung einer Leistungsprämie oder -zulage ist unabhängig von der dienstlichen Beurteilung. Dem Dienstherrn bleibt überlassen, „im Rahmen des ihm eingeräumten Beurteilungsspielraums über die herausragende Leistung zu bestimmen“ (Deutscher Bundestag. Wissenschaftliche Dienste 2018 S. 10).
Mit der Föderalismusreform wurde 2006 die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für beamtenrechtliche Sachverhalte abgeschafft. Die Regelungskompetenz für die Laufbahnen, die Besoldung und die Versorgung der Landesbeamten sowie der Beamten in den Kommunen liegt seither ausschließlich bei den Ländern (Bull 2008); das 2009 verabschiedete Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) regelt lediglich die besonderen Rechte und Pflichten, die sich aus dem Beamtenstatus ergeben.
Obwohl die gesetzliche Regelungskompetenz für die Besoldung bei den Ländern liegt, wird in diesem Kapitel auch auf die Bundesgesetzgebung Bezug genommen, weil diese und die auf sie bezogene Rechtsprechung häufig prägend für die Regelungen der Länder wirkte und wirkt.
Bei den Angestellten erfolgte die Einführung eines leistungsorientierten Entgelts im Zuge der Ablösung des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Auf dieser Grundlage vereinbarten die Tarifparteien ab 2007/2008 die Einführung eines leistungsorientierten Entgelts. Aufgrund der großen Vorbehalte der Personalvertretungen wurde allerdings bereits in der Tarifrunde 2009 der § 18 TV-L, in dem das leistungsorientierte Entgelt geregelt worden war, zugunsten der allgemeinen Erhöhung der Entgelte wieder aufgehoben (Vogel 2019 S. 411).Footnote 81 Der TVöD sieht grundsätzlich zwei Entscheidungsgrundlagen für eine leistungsorientierte Bezahlung vor: eine systematische Leistungsbeurteilung oder Zielvereinbarungen. Grundlage der systematischen Leistungsbeurteilung ist eine möglichst objektive Messung der Leistung auf der Grundlage definierter Standards. Für die leistungsorientierte Bezahlung auf der Grundlage einer Zielvereinbarung ist der Soll-Ist-Vergleich, also ein Abgleich der erbrachten Leistung mit vorher verabredeten Zielen, jeweils bezogen auf einen bestimmten Zeithorizont (i. d. R. ein Jahr), maßgeblich (Vogel 2019 S. 412).
Im Rahmen einer Novelle des Bundesbesoldungsgesetzes im Jahr 2002 wurde für den Bereich der Hochschulen die Besoldungsgruppe C durch die Besoldungsgruppe W ersetzt. Hier ist neben einem Grundgehalt die Gewährung von an Zielvereinbarungen gekoppelten befristeten und unbefristeten Leistungszulagen durch die Hochschulen vorgesehen. Trotz Kritik an der Ausgestaltung wird das Prinzip leistungsbezogener Gehaltskomponenten im Hochschulbereich nur noch selten infrage gestellt.
Grundsätzlich werden bei leistungsbezogenen Entgeltsystemen Leistungsprämien und Leistungszulagen unterschieden. Bei Leistungsprämien handelt es sich um einmalige Zahlungen, die in der Regel an eine Zielvereinbarung gekoppelt sind. Grundlage für die Zumessung einer Prämie ist in den meisten Fällen eine Aufstellung von Leistungen. In der Regel wird eine Leistungsprämie ex post gewährt. Eine Leistungszulage erfolgt für die befristete Übernahme bestimmter Aufgaben als monatliche Zulage. Sie wird befristet und widerruflich gewährt.
Während für die dienstliche Beurteilung mehr oder weniger ausdifferenzierte Kriterienkataloge zur Bestimmung von Leistung, Eignung und Befähigung vorliegen, wird die Entscheidung darüber, was als besondere Leistung hinsichtlich der Vergabe einer Leistungsprämie oder -zulage zu werten ist, den Dienstvorgesetzten überlassen. So schreibt beispielsweise die Bundesleistungsbesoldungsverordnung (BLBV) in § 9 Abs. 3 lediglich vor, dass die Entscheidung zu dokumentieren ist. Wie der nachfolgend zitierte Ausschnitt aus der bayrischen VerwaltungsvorschriftFootnote 82 zeigt, ist dort die Bestimmung einer Leistung nicht auf Outputs (Lazear 2018) bezogen (s. Infobox Bestimmung von Leistung in Bayern).
Infobox Bestimmung von Leistung in Bayern
Die Leistungsprämie dient … der Honorierung kurzfristiger Leistungen qualitativer oder quantitativer Art. Sie bietet sich besonders dann an, wenn zeitgebundene Projekte zu bearbeiten sind oder zusätzliche Aufgaben wahrgenommen werden, dadurch eine vorübergehende Mehrbelastung eintritt und die Mehrbelastung mit einer herausragenden besonderen Leistung verbunden ist. Mehrarbeit im Rahmen einer Vertretung kann Grundlage für eine Leistungsprämie sein, wenn sie im Einzelfall besonders belastend wirkt (z. B. wegen der langen Zeitspanne, in der Mehrarbeit geleistet wird oder wegen der zu bewältigenden Menge an Arbeit) und dabei die eigenen und die fremden Aufgaben gleichwohl sachgerecht erledigt werden.
In dieser Bestimmung des Leistungsbegriffs in der bayrischen Verordnung werden Mehrarbeit, Belastung und die Erbringung einer „herausragenden besonderen Leistung“ ineinander geblendet. Außerdem werden keine Kriterien zur Identifikation einer herausragenden Leistung formuliert. In einigen Verordnungen wird sogar explizit betont, dass den Entscheidungsberechtigten Bewertungsspielräume eingeräumt werden, wie im nachfolgenden Auszug aus einem Runderlass des Ministeriums für Finanzen und Energie des Landes Schleswig–Holstein (s. Infobox Operationalisierung von Leistung in Schleswig–Holstein).
Infobox Operationalisierung von Leistung in Schleswig–Holstein
Den Entscheidungsberechtigten wird … ein Bewertungsspielraum eingeräumt. Hinsichtlich der Merkmale Arbeitsqualität und -quantität ist von Bedeutung, dass die Erfüllung einer Leistungskomponente nicht auf Kosten der anderen Komponente gehen kann. Die Gewährung einer Prämie im Hinblick auf Arbeitsquantität ist z. B. nicht gerechtfertigt, wenn die Arbeitsqualität merklich gelitten hat.
Während z. B. in Nordrhein-Westfalen (s. Infobox Entscheidung über Leistungszulagen und -prämien in Nordrhein-Westfalen) oder Schleswig–Holstein die Entscheidung über eine Gewährung einer Leistungsprämie bei der oberen Dienstbehörde liegt, trifft sie in Brandenburg der oder die Dienstvorgesetzte.
Infobox Entscheidung über Leistungszulagen und -prämien in Nordrhein-Westfalen
Die Entscheidung über die Gewährung der Leistungsprämien und über die Gewährung und den Widerruf von Leistungszulagen trifft die zuständige oberste Dienstbehörde. Sie kann die Entscheidungsbefugnis auf andere Stellen übertragen. In den der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts entscheidet … die für beamtenrechtliche Entscheidungen zuständige Stelle.
Eine Auswertung der aktuellen Besoldungsgesetze und Verordnungen der Länder ergab, dass Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig–Holstein und Sachsen Leistungszulagen und/oder Leistungsprämien für Beamte unter dem Vorbehalt einer haushaltsrechtlichen Regelung vorsehen.Footnote 83 In den Besoldungsgesetzen von Hamburg und Sachsen-Anhalt wird die Landesregierung ermächtigt, Leistungsprämien oder -stufen für Beamte in einem eigenen Gesetz bzw. einer Verordnung zu regeln. Eine solche Verordnung liegt bislang allerdings nicht vor. Die Besoldungsgesetze der anderen Länder enthalten jenseits der Regelungen für die W-Besoldung an Hochschulen keine Hinweise auf leistungsbezogene Entgeltkomponenten für den öffentlichen Dienst (s. Abb. 7.5 Regelungen zu leistungsbezogenen Entgeltkomponenten im Besoldungsrecht der Länder).
In Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig–Holstein und Sachsen ist das Leistungsprinzip auch durch die Einführung der sogenannten LeistungsstufenFootnote 84 verankert worden. Unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln können Leistungsstufen gezahlt werden, wenn dauerhaft herausragende Leistungen erbracht werden.Footnote 85 Leistungsstufen können für den Zeitraum bis zum Erreichen der nächsten Stufe gewährt werden, d. h. es wird das Grundgehalt der nächsthöheren Stufe gezahlt. Der Betrag, der für die Gewährung von Leistungsstufen zur Verfügung steht, ist ebenso wie für Leistungszulagen und Leistungsprämien gedeckelt. Im Bundesbesoldungsgesetz ist beispielsweise geregelt, dass maximal 15 % der Beamtinnen und Beamten mit A-Besoldung innerhalb eines Jahres eine Leistungsprämie und Leistungszulage erhalten. Die Zulage darf zudem maximal sieben Prozent des Anfangsgrundgehalts betragen. Insgesamt stehen 0,3 % der Besoldungssumme einer Behörde für die leistungsorientierte Bezahlung zur Verfügung.Footnote 86
Weil sowohl Leistungszulagen und Leistungsstufen im Unterschied zu Leistungsprämien auf längerfristig erbrachte Leistungen zielen, haben einige Bundesländer Leistungszulagen zugunsten der Leistungsstufen wieder abgeschafft.
7.2.2 Leistungsanreize für Lehrkräfte
Im Unterschied zum Hochschulbereich werden im Schulbereich häufig Bedenken gegen Leistungsanreize artikuliert. Die Wirksamkeit solcher Anreize wird mit Hinweis auf Studien in der Privatwirtschaft oder Studien zu Systemen leistungsbezogener Bezahlung von Lehrkräften in den angelsächsischen Ländern bezweifelt (s. den Überblick bei Winkler 2013). Eine neue Metaanalyse von 37 (hauptsächlich US-amerikanischen) Studien, die Leistungsanreize in Schulen untersuchen, zeigt durchaus positive Effekte von leistungsbezogenen Entgeltsystemen für Lehrkräfte auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern (Pham et al. 2021 S. 545). Allerdings ist die Stärke der Effekte abhängig von der Ausgestaltung der Anreizsysteme. Dabei zeigt die Kombination von leistungsbezogenen Bezahlelementen mit Angeboten zur professionellen Weiterentwicklung die höchsten Effekte (Pham et al. 2021 S. 545; Heneman III et al. 2006). Ein weiterer Faktor für erfolgreiche Anreizsysteme scheint die Vergabe von Anreizen aufgrund einer Beurteilung von Lehrkräften durch Schulleitungen zu liegen (Podgursky und Springer 2007). Eine Studie von Dee und Wyckoff (2015) zeigt, dass finanzielle Anreize sogar eine weitere Steigerung der Leistung von High-Perfomance-Lehrkräften erklären können.
Von den 2019 für den OECD Bericht „Bildung auf einen Blick“ erfassten 48 Ländern oder subnationalen Einheiten sehen 19 eine zusätzliche Entgeltkomponente für besondere Leistungen beim Unterrichten vor (OECD 2020 S. 498)Footnote 87. Entscheidend für die schulische Personalentwicklung ist allerdings nicht nur, dass Leistungsanreize im Schulsystem implementiert sind, sondern auch, dass die Schulleitung über die Vergabe der Zulagen entscheiden kann. Nur fünf der 19 Länder, die leistungsbezogene Zulagen vorsehen, legen die Entscheidung über die Gewährung dieser Zulagen in die Hände der Schulleitung.
Extrazahlungen für die Übernahme von Aufgaben im Schulmanagement und der Schulentwicklung gewähren 21 Staaten, in acht davon entscheidet die Schulleitung über die Gewährung der zusätzlichen Entgeltkomponenten für diese Aufgaben. Häufig werden auch Beratungstätigkeiten oder außerunterrichtliche Aktivitäten extra vergütet (OECD 2020, Web Table D 3.17Footnote 88).
Welche Zulagen in Deutschland für Lehrkräfte vorgesehen sind, ist in den einzelnen Ländern in eigenen Verordnungen geregelt. Zulagen werden häufig gewährt für die Übernahme von Aufgaben außerhalb der Schule (z. B. in der Lehrkräftebildung), für die kommissarische Übernahme der Schulleitungstätigkeit oder als einmalige Zulage aufgrund einer besonderen Mehrbelastung (z. B. aktuell eine Corona-Zulage, die für Schulleitungen oder Lehrkräfte bezahlt wird). Eine besondere Rolle spielen seit einigen Jahren Zulagen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen, die in einigen Ländern (noch) nicht der Besoldungsgruppe A13 zugeordnet sind, obwohl mit der Einführung der neuen Studienstruktur die Studiendauer zwischen den Lehrämtern angeglichen wurde und somit ein Grund für die niedrigere Einstufung entfällt. Diese Lehrkräfte erhalten teilweise Zulagen, um die Differenz zur A13-Besoldung zu reduzieren. Weitere Zulagen wurden z. B. in Berlin oder Nordrhein-Westfalen für Schulen in sozialen Brennpunkten oder in den ostdeutschen Bundesländern für Schulen in ländlichen Gebieten eingeführt.
Einen Sonderfall stellt Thüringen dar. Mit der Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes im Jahr 2018 wurden wie auch in anderen Ländern die sogenannten funktionslosen Beförderungen abgeschafft. Allerdings wurden keine neuen Funktionsstellen und damit Beförderungsmöglichkeiten geschaffen. Es existieren nur die Ämter der Schulleiterinnen und Schulleiter und deren Stellvertreter sowie ggf. der zweiten Stellvertretenden. Für diese Positionen werden spezifische Aufgaben definiert. Erst durch eine Änderung im Besoldungsgesetz, die im Januar 2021 in Kraft trat, wurden Zulagen für Lehrerinnen und Lehrer, die besondere Aufgaben an den Schulen wahrnehmen, eingeführt.Footnote 89 Diese Zulagen sind allerdings nicht ruhegehaltsfähig (s. Infobox Sonderfall Thüringen).
Infobox Sonderfall Thüringen
Zulage für besondere Funktionen.
In Thüringen sind unterhalb der stellvertretenden Schulleitung keine Funktionsstellen vorgesehen. Im Januar 2021 wurde durch eine Änderung im Besoldungsgesetz die Gewährung von Zulagen für die Übernahme besonderer Aufgaben ermöglicht.
11. Zulagen für die Übernahme besonderer Aufgaben an Schulen
-
(1)
Für die Übernahme einer der folgenden Aufgaben an der Schule kann Beamten eine Stellenzulage nach Anlage 8 gewährt werden
-
a)
Verantwortlicher für die Ausbildung,
-
b)
Koordinator für außerunterrichtliche Angelegenheiten,
-
c)
Beratungslehrer,
-
d)
Koordinator für die Sekundarstufe I,
-
e)
Koordinator für die Schuleingangsphase und den Übertritt in die Sekundarstufe I (an Grundschulen mit bis zu 180 Schülern und an Gemeinschaftsschulen mit einer Primarstufe mit bis zu 360 Schülern),
-
f)
Koordinator für den gemeinsamen Unterricht,
-
g)
Multiplikator für den digitalen Unterricht,
-
h)
Leiter einer Abteilung, die an einer berufsbildenden Schule bis zu 240 Schüler umfasst
-
a)
-
(2)
Die Zulage wird nur gewährt, wenn nicht eine Zulage nach einer anderen Ziffer der Besoldungsordnung A gewährt wird. Erfüllt ein Beamter mehrere der in Absatz 1 genannten Aufgaben, wird die Zulage nur einmal gewährt. Soweit der Beamte für eine in Absatz 1 genannte Aufgabe Abminderungsstunden erhält, ist die Gewährung der Zulage ausgeschlossen.
-
(3)
Stellenzulagen nach Absatz 1 dürfen an einer Schule mit
-
a)
bis zu 180 Schülern höchstens 2,
-
b)
mehr als 180 bis zu 240 Schülern höchstens 3,
-
c)
mehr als 240 bis zu 360 Schülern höchstens 4,
-
d)
mehr als 360 bis zu 420 Schülern höchstens 5,
-
e)
mehr als 420 bis zu 540 Schülern höchstens 6,
-
f)
mehr als 540 Schülern höchstens 7Lehrern gewährt werden
-
a)
Im Unterschied zu den beschriebenen Zulagen sind Leistungsprämien für Lehrkräfte in Deutschland umstritten (vgl. z. B. die Stellungnahme der GEW-Bayern 2016Footnote 90). Zwar wollten nach einer Meldung des Spiegels vom 4. Mai 2001 zum damaligen Zeitpunkt neben Bayern auch Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg die Möglichkeit der neuen Besoldungsordnungen im öffentlichen Dienst nutzen und Leistungsprämien für Lehrkräfte einführen; diese Absicht führte allerdings nicht zu einer nachhaltigen Verankerung von leistungsbezogenen Elementen der Vergütung im Schulbereich. Zwei Einwände, die gegen die probeweise Einführung von Leistungsstufen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen in Baden-Württemberg formuliert wurden, werden auch häufig in der Diskussion um Leistungsprämien vorgetragen: Zum einen habe die „Umsetzung der Leistungsstufenverordnung … an den Schulen des Landes zu einer großen Unruhe geführt“ und zum anderen sollten die Mittel besser für die Sicherung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.Footnote 91
Von den elf Ländern, die in ihren Besoldungsgesetzen bzw. Verordnungen leistungsbezogene Entgeltkomponenten im öffentlichen Dienst vorsehen (s. Abb. 7.5 Regelungen zu leistungsbezogenen Entgeltkomponenten im Besoldungsrecht der Länder), haben im Schulbereich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Bayern und Sachsen Leistungsprämien für Lehrkräfte eingeführt. In beiden Ländern liegt die Entscheidung über die Gewährung einer Leistungsprämie bei der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter (s. die entsprechenden Infoboxen weiter unten).
Bei der Einführung leistungsbezogener Anreize müssen drei Fragen beantwortet werden (Winkler 2013 S. 43): Wie wird Leistung operationalisiert? Wie wird Leistung gemessen? Welche Anreize werden in welchem Umfang für eine Leistung gewährt? Außerdem ist für die Frage der schulischen Personalentwicklung von Belang, wer über die Gewährung von Leistungsanreizen entscheidet.
Während in den angelsächsischen Ländern der Messung der Leistungen von Lehrkräften und ihrer Verknüpfung mit sogenannten „Knowledge- and Skill-Based Pay Schedules“ (Heneman et al. 2006) eine lange Tradition haben (Bartlett 2000), wird in den deutschen Ländern die Operationalisierung von Leistung im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungszulagen und -prämien, wie oben beschrieben, in die Hand der Dienstvorgesetzen gelegt.
Zentrales Merkmal der sogenannten Merit Pay Systeme ist, dass in „standards-based teacher evaluation systems, teachers' performance is evaluated against a set of standards that define a competency model of effective teaching. Such systems replace the traditional teacher evaluation system and seek to provide a more thorough description and accurate assessment of teacher performance“ (Heneman III et al. 2006 S. 1). In den USA und England existieren verschiedene Rahmenkonzepte oder Standards, wie z. B. der weit verbreitete „Framework for Teaching“ (Danielson 1996) oder die Standards des National Board for Professional Teaching Standards (https://www.nbpts.org/). Grundlage ist jeweils ein Modell, das verschiedene Leistungsdimensionen unterscheidet. Im Framework for Teaching sind das z. B.: planning and preparation, the classroom environment (classroom management), instruction, and professional responsibilities. Für jede Dimension werden konkrete Leistungsindikatoren operationalisiert. Eine Einschätzung jedes Indikators erfolgt bezogen auf vier Leistungsstufen. Die Leistungsmessung ist die Grundlage für die Gewährung von Leistungsprämien. Sie dient aber auch dem Feedback an die Lehrkraft sowie der Identifikation von Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf. Eine Erfolgsbedingung für die Implementation eines Systems leistungsbezogener Bezahlung ist einer Studie von Heneman III et al. (2006) zufolge, dass ein Alignment mit den anderen Bereichen des Personalmanagements stattfindet. Für die Akzeptanz der Lehrkräfte ist neben der theoretischen Begründung der Qualitätsindikatoren die Validität der Beurteilung entscheidend. Die Validität (und dadurch vermittelt die Wirkung von leistungsbezogenen Entgeltkomponenten auf Schülerleistungen) wiederum kann durch ein Training der Beurteilenden und die Gestaltung des Beurteilungsprozesses erheblich gesteigert werden (Heneman III et al. 2006).
Im Unterschied zu den angelsächsischen Ländern werden die Fragen nach der Operationalisierung und Messung der Leistungen von Lehrkräften in den beiden deutschen Ländern, die Leistungsprämien für Lehrkräfte eingeführt haben (Bayern und Sachsen), nur sehr vage beantwortet. Entsprechend der oben dargestellten Regelungen des Besoldungsrechts der Länder, die die Grundlage für die Gewährung von leistungsbezogenen Entgeltkomponenten im Schulsystem darstellen, haben die Entscheidungsberechtigten in Deutschland einen großen Spielraum bei der Operationalisierung der Leistung. Nicht nur die Entscheidung über die Gewährung einer Leistung, sondern auch die Definition von Merkmalen der Leistung sowie ihre Überprüfung erfolgt, abgesehen von der personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmung, in der Verantwortung der Dienstvorgesetzten. Modelle zur Definition von Leistungsdimensionen oder gar operationalisierte Leistungsindikatoren existieren über die dienstliche Beurteilung hinausgehend nicht. Dies gilt auch für die Gewährung von Leistungsanreizen in Schulen in Bayern und Sachsen (vgl. die nachfolgenden Infoboxen Bayern undSachsen). Studien über die Effekte dieser von den angelsächsischen Konzepten deutlich abweichenden Konzeption der Leistungsprämie existieren bis dato nicht.
Infobox Leistungsprämie für Lehrkräfte in Bayern
In Bayern ist die Honorierung herausragender Leistungen im öffentlichen Dienst seit 1998 möglich. Bis 2011 wurde die Honorierung herausragender Leistungen in einer Verordnungsermächtigung geregelt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum neuen Dienstrecht erfolgt die Vergabe von Leistungsprämien in Schulen auf der der Grundlage der Art.67 f. BayBesG. Die Befugnis zur Vergabe und zum Widerruf von Leistungsprämien und -zulagen haben die unmittelbaren Dienstvorgesetzten, also die Schulleiter bzw. im Volksschulbereich die Schulämter – Art. 68 Abs. 2 Satz 1 BayBesG.
Eine Regelung zum Verfahren der Leistungsbestimmung erfolgt nicht.
Die Höhe der Leistungsprämie wird wie folgt begrenzt: eine Leistungsprämie „wird maximal in Höhe des Anfangsgrundgehalts einer Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung A oder des Grundgehalts einer Besoldungsgruppe der Besoldungsordnung B gewährt, der der Beamte oder die Beamtin zum Zeitpunkt der Festsetzung der Leistungsprämie angehört. … Sie soll in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Leistung gewährt werden. … Sie kann als Einmalbetrag oder in maximal zwölf monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt werden. … Eine Kürzung entsprechend der Arbeitszeit gemäß Art. 6 findet nicht statt.“Footnote 92
Die Personalvertretungen sind „vor der Vergabe über die Empfänger der Leistungszulagen einschließlich Höhe und Dauer der konkret zu gewährenden Zulagen zu informieren. Zu diesem Zweck ist der Personalvertretung eine Liste zur Einsicht vorzulegen; diese Liste darf aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nur innerhalb der Dienststelle eingesehen werden. … Die Dienststelle ist jedoch nicht verpflichtet, dem Personalrat die Erwägungen darzulegen, die den jeweils getroffenen Entscheidungen zugrunde liegen. Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit gebietet es, dass der Personalrat vor der Vergabe Gelegenheit hat, seine Überlegungen vorzutragen.“Footnote 93
Am 8.10.2020 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Fall einer Klage eines bayerischen Personalrats allerdings entschieden, dass Dienstvereinbarungen über Kriterien zur Vergabe von Leistungsprämien auch für Beamte, d. h. auf der Ebene des Schulamts zwischen Schulamt und Personalrat geschlossen werden können.
Infobox Prämienbudget für Schulleitungen in Sachsen
Sachsen hat die Vergabe von Leistungsprämien für Lehrkräfte durch ein der Schule zugewiesenes Prämienbudget gestärkt. In dem 2018 verabschiedeten Handlungsprogramm zur nachhaltigen Sicherung der Bildungsqualität in Sachsen, wird die Einführung von Leistungsprämien beschrieben: „Jede Schule erhält ab 1. Januar 2019 ein frei aufteilbares Prämienbudget zur Ausgabe individueller und kollektiver Leistungsprämien. Über die Vergabe entscheidet der Schulleiter in Abstimmung mit dem örtlichen Personalrat. Das Prämienbudget wird auf die öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen entsprechend der Anzahl der Lehrkräfte an jeder Schule aufgeteilt. Die Zuweisung des zusätzlichen Prämienbudgets erfolgt bis zum 31. Dezember 2023.“ (Sächsisches Staatsministerium für Kultus [SMK] 2018 S. 9).
Grundlage für die Vergabe von Leistungsprämien ist die Leistungsprämienverordnung – LPVO. Gewährt werden kann eine Leistungsprämie dann, „wenn der Beamte, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsqualität oder Arbeitsquantität oder den wirtschaftlichen Erfolg, eine herausragende besondere Leistung erbringt oder erbracht hat. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch erfüllt, wenn der Beamte zusätzlich zu den Aufgaben seines Dienstpostens die Aufgaben eines anderen Dienstpostens übernimmt und beide trotz der dadurch bedingten außergewöhnlichen Belastung sachgerecht erledigt. Die Abwesenheitsvertretung muß langfristig sein und mindestens drei Monate angedauert haben.“ § 2 Abs. 1 sächs LPVO.
„Die Leistungsprämie wird in einem Einmalbetrag bis zur Höhe des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe, der der Beamte während der Erbringung der herausragenden besonderen Leistung ausschließlich oder überwiegend angehört hat, gewährt; die Höhe ist entsprechend dem Grad der besonderen Leistung zu bemessen. Eine Neubewilligung ist erst nach Ablauf eines Jahres zulässig.“
In Bayern sind neben Leistungsprämien auch Leistungsstufen für Lehrkräfte prinzipiell vorgesehen. So ist in der Verordnung zur dienstlichen Beurteilung als Beurteilungsanlass die „Feststellung, ob dauerhaft herausragende Leistungen vorliegen“ formuliert.Footnote 94 In der Praxis scheint die Gewährung von Leistungsstufen für Lehrkräfte jedoch die absolute Ausnahme zu sein.Footnote 95
7.2.3 Anrechnungsstunden für die Übernahmen von Aufgaben der Schulentwicklung
Schulen erhalten für jedes Schuljahr eine Zuweisung von Unterrichtsstunden bzw. Lehrkraftstellen. Der größte Teil der Stundenzuweisung erfolgt zweckgebunden. Neben der Abdeckung der Stundentafel (Grundversorgung) werden beispielsweise Stunden für Deutsch als Zweitsprache/Sprachförderung, Inklusion sowie Stunden für die Reduktion der Unterrichtsverpflichtung aus AltergründenFootnote 96 oder aufgrund besonderer Beeinträchtigungen zugewiesen. Maßgeblich für die Stundenzuweisung ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler oder der Klassen bzw. die Zahl der Lehrkräfte, die einen besonderen Anspruch haben. Weitere Faktoren wie z. B. die Anzahl von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunft begründen in manchen Ländern zusätzliche Stundenzuweisungen.
Mit Ausnahme des Hamburger Arbeitszeitmodells orientiert sich die Stundenzuweisung in den Ländern im Wesentlichen am sogenannten Deputatsmodell.Footnote 97 Auf der Grundlage einer pauschalen Veranschlagung von unterrichtsbezogenen Aufgaben (wie Vor-, Nachbereitung von Unterricht, Korrekturen) und weiteren Aufgaben (wie z. B. Elternarbeit) werden Unterrichtsverpflichtungen für Lehrkräfte definiert. Durch Anrechnungsstunden für Funktionsstellen, wie Schulleiterin bzw. Schulleiter, stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender Schulleiter oder Ermäßigungsstunden bei Vorliegen besonderer Belastungen oder Beeinträchtigungen wird die Unterrichtsverpflichtung reduziert. Kritik an diesem Modell wurde nicht nur hinsichtlich der undifferenzierten Veranschlagung des Zeitaufwands für unterrichtsbezogene Tätigkeiten geübt, die Unterschiede zwischen den Fächern, z. B. beim Korrekturaufwand, nicht berücksichtigt, sondern auch wegen des fehlenden Einbezugs außerunterrichtlicher Aufgaben, insbesondere der vergleichsweise neuen Aufgaben der Schulentwicklung.
Im Unterschied zum traditionellen Deputatsmodell definiert das Hamburger Modell zur Gestaltung der LehrerarbeitszeitFootnote 98 Anteile der Arbeitszeit für a) unterrichtsbezogene Aufgaben (Erteilung von Unterricht; Vorbereitung, Nachbereitung, Korrektur; Beratung/Information von Schüler/innen und Eltern; Fortbildung; …), b) funktionsbezogene Aufgaben (Schulleitung; Mitarbeit in Gremien; Wahrnehmung besonderer fachlicher Aufgaben; Betreuung von Projekten; Verwaltung von Fachräumen, Sammlungen und Einrichtungen; Aufgaben der schulischen Verwaltung und Schulentwicklung; …), c) allgemeine Aufgaben (insbesondere die Teilnahme an allgemeinen Konferenzen, Elternabenden und sonstigen schulischen Veranstaltungen sowie die Fortbildung im Rahmen der schulischen Fortbildungsplanung, die Wahrnehmung von Aufsichten und die Erteilung von Vertretungsstunden). Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden wird so festgelegt, dass die für alle Aufgaben der drei Bereiche aufzuwendenden Zeiten in einer Unterrichtswoche dem achtunddreißigsten Teil (bezogen auf 38 Unterrichtswochen) der jährlichen Arbeitszeit entsprechen. Das Modell ermöglicht neben der Berücksichtigung außerunterrichtlicher Arbeitstätigkeiten der Lehrkräfte auch die Einbeziehung unterschiedlicher Arbeitsbelastungen in unterschiedlichen Fächern und die Anerkennung der ungleichen Verteilung der Belastungen über das Schuljahr hinweg. Den Aufgaben werden pauschalierende Zeitansätze zugrunde gelegt. Über die Verwendung des zugewiesenen Zeitkontingents für funktionsbezogene Aufgaben entscheidet die Schule bzw. die Schulleiterin oder der Schulleiter entsprechend den pädagogischen Schwerpunktsetzungen und organisatorischen Gegebenheiten.
Obwohl kein weiteres Land ein dem Hamburger Modell entsprechendes Arbeitszeitmodell eingeführt hat, sehen doch alle Länder Anrechnungsstunden vor, über die die Schulen selbst entscheiden können. Diese Stunden sind für die schulische Personalentwicklung dann interessant, wenn sie neben den Funktionsstellen (s. Kap. 5 in diesem Band) Anreize für die Gewinnung von engagierten und kompetenten Lehrkräften für besondere schulische Aufgaben darstellen. Wenn Schulleiterinnen und Schulleiter über schulbezogene Anrechnungsstunden entscheiden können, können diese als Instrument der individualisierten Personalentwicklung eingesetzt werden und entsprechendes Anreizpotenzial entfalten.
Die Zuweisung dieser Anrechnungsstunden ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich kann zwischen Deputaten bzw. Pauschalen für Schulleiterinnen und Schulleiter, für die Schulleitung insgesamt und für weitere schulbezogene Aufgaben unterschieden werden.
In Hessen wird ein Leiterdeputat, ein Leitungsdeputat und ein Schuldeputat ausgewiesen.Footnote 99 Schulleiterinnen und Schulleiter können Leitungsaufgaben übertragen und Anrechnungsstunden aus dem Leiterdeputat, dem Leitungsdeputat und dem Zuschlag zur Grundversorgung gewähren.Footnote 100 Für die Verteilung des Schuldeputats legt die Schulleiterin oder der Schulleiter der Gesamtkonferenz einen Vorschlag vor.
Auch im Saarland sind Anrechnungsstunden für Schulleiter, für die Schulleitung (Vertretung des Schulleiters bzw. der Schulleiterin und Koordinierungsaufgaben) und Schuldeputate vorgesehen. Für die Schuldeputate werden in der Verordnung allerdings ausschließlich Belastungen (Unterricht in Korrekturfächern oder Abschlussklassen) als Anrechnungsgründe angeführt. Die Übernahme von Aufgaben der Schulentwicklung spielt hier offensichtlich keine Rolle. Die Zuweisung der Anrechnungsstunden für Mitglieder der Schulleitung erfolgt durch die Schulleiterinnen und Schulleiter. Die Zuweisung der Schuldeputate ist in der Verordnung nicht eindeutig geregelt. Bemerkenswert ist auch, dass Anrechnungsstunden, die vom Schulleiter bzw. der Schulleiterin nicht in Anspruch genommen werden, entfallen.Footnote 101 Im Unterschied zur hessischen Regelung (und auch Regelungen in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig–Holstein) ist eine Übertragung der Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter auf andere Lehrkräfte nicht möglich.
Auch die Verordnung in Schleswig–Holstein sieht ein Budget für Schulleiterinnen und Schulleiter sowie ein Budget für stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter vor. Ein weiteres Zeitbudget wird für weitere Leitungsfunktionen der allgemeinbildenden Schulen zugewiesen. Außerdem erhalten Schulen ein Zeitbudget für pädagogische Arbeit und für Schulentwicklung: „Über die Verteilung des Budgets für Leitungs- und Koordinierungsaufgaben … entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung der Lehrerkonferenz. … Über die Verwendung des Budgets für pädagogische Arbeit und Schulentwicklung … entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage der von der Lehrerkonferenz gebilligten Grundsätze. Die Vergabe von Stunden aus dem Budget erfolgt für einen Zeitraum von höchstens zwei Schuljahren.“Footnote 102
In Niedersachsen weist die Verordnung Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter aus. Neben Stunden für Schulleiterinnen und Schulleiter sind Stunden für die Schulleitung und Funktionen im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit der Schule vorgesehen: „Die sich für ein Mitglied einer kollegialen Schulleitung … ergebenden Anrechnungsstunden können entsprechend dem Umfang der Wahrnehmung der Aufgaben mit dessen Zustimmung anderen Mitgliedern der kollegialen Schulleitung übertragen werden“.Footnote 103 Außerdem können Anrechnungsstunden für besondere Belastungen gewährt werden.
Auch in Bayern ist Anrechnungszeit für Schulleiterinnen und Schulleiter vorgesehen, die auch auf andere Mitglieder der Schulleitung übertragen werden kann, sofern eine solche eingerichtet ist.Footnote 104 Neben der Anrechnungszeit für die Schulleitung werden Anrechnungsstunden für schulgebundene Funktionen und besondere Aufgaben gewährt, die Schulleiterinnen und Schulleiter für besondere Aufgaben fachlicher, pädagogischer und schulorganisatorischer Art an Lehrkräfte vergeben.Footnote 105 Die Vergabe von Anrechnungsstunden im Rahmen des Gesamtkontingents liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Schulleiterin oder des Schulleiters. Für den Fall der Einrichtung einer erweiterten Schulleitung ist auch ein Budget für die Schulleitung vorgesehen.
Im Unterschied zu den vorausgehend beschriebenen Regelungen, die zwischen Leiter-, Leitungs- und Schulpauschale differenzieren, ist in Bremen, was die nicht-zweckgebundenen Anrechnungsstunden betrifft, ausschließlich Leitungszeit vorgesehen. Im Rahmen dieser Leitungszeit werden Mindeststunden für Schulleiterinnen und Schulleiter, stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter sowie andere Funktionsstellen innerhalb und außerhalb der Schulleitung definiert.Footnote 106 Die Schulleiterin oder der Schulleiter verteilt die der Schule zugewiesene Leitungszeit auf die Funktionsstelleninhaberinnen und die Funktionsstelleninhaber der Schule. Die darüber hinaus gehende Leitungszeit kann an Lehrkräfte verteilt werden, die besondere Aufgaben ohne eine bestimmte Funktion wahrnehmenFootnote 107 (s. Infobox Zuweisung und Verteilung von Leitungszeit in Bremen).
In Mecklenburg-Vorpommern sind Anrechnungsstunden für Leitungs- und Koordinierungsaufgaben vorgesehen, sowie ein Schulpool für weitere Verwaltungsaufgaben und besondere pädagogische Aufgaben. Schulen können in Mecklenburg-Vorpommern außerdem auf Antrag, nach Genehmigung durch die zuständige Schulbehörde, für ein Schuljahr bis zu drei Prozent der Lehrerwochenstunden des verbindlichen Grundbudgets für Leitungsaufgaben sowie zeitlich befristete Verwaltungsaufgaben, Aufgaben der Schulorganisation und pädagogische Aufgaben einsetzen. Die Absicherung des Regelunterrichts muss nachgewiesen werden.Footnote 108
Rheinland-Pfalz sieht neben einer Pauschale für Leitungsaufgaben (Schulleiterin oder Schulleiter, Vertreterinnen oder Vertreter, didaktische Koordinatorin oder didaktischer Koordinator) ein weiteres Kontingent von Anrechnungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen und Sonderaufgaben vor. „Die Gesamtkonferenz beschließt über die Grundsätze für die Verteilung der Anrechnungspauschale. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet über die Verteilung der Anrechnungsstunden im Einzelnen. Die Verteilung ist schriftlich festzuhalten. Die Gesamtkonferenz ist über die Verteilung zu unterrichten“.Footnote 109 Über die Anrechnungsstunden für die Leitungsaufgaben entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit den anderen Mitgliedern der Schulleitung.Footnote 110
Auch in Baden-Württemberg ist ein Anrechnungskontingent für Leitungsaufgaben sowie ein Stundenpool vorgesehen. „Anrechnungen dienen dem Ausgleich unterschiedlicher zeitlicher Belastungen einzelner Lehrkräfte“.Footnote 111 Anrechnungsstunden für Aufgaben der Schulentwicklung sind nicht explizit genannt. Die Verteilung der Anrechnungen steht im pflichtgemäßen Ermessen der Schulleiterin oder des Schulleiters. Sie bzw. er informiert die Gesamtlehrerkonferenz über die Verteilung der Anrechnungen.
Nordrhein-Westfalen sieht für die Aufgaben der Schulleitung Leitungszeit vor. Neben der Leitungszeit werden den Schulen in Nordrhein-Westfalen Anrechnungsstunden für die ständige Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben und zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen, für die Mitgliedschaft im Lehrerrat und für die Tätigkeit als Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen zugewiesen, über die sie verfügen können. Die Lehrerkonferenz entscheidet über die Grundsätze für die Verteilung der Anrechnungsstunden. Die Verteilung der Anrechnungsstunden im Einzelnen obliegt den Schulleiterinnen und Schulleitern.Footnote 112
Ein Schulleitungskontingent wurde auch in Sachsen-Anhalt eingeführt.Footnote 113 Aus dem Kontingent werden Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter, die ständige Vertretung, zweite Konrektorinnen und Konrektoren, die schulfachlichen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die didaktischen Leiterinnen und Leiter sowie die pädagogischen Koordinatorinnen und Koordinatoren generiert. Über die Verteilung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Neben dem Schulleitungskontingent erhält die Schule Anrechnungsstunden für besondere Belastungen. Dies sind insbesondere Verwaltungsaufgaben, besondere unterrichtliche oder schulformspezifische Belastungen.
Berlin gewährt den Schulen schulbezogene Anrechnungsstunden für Schulorganisation sowie für die Wahrnehmung besonderer unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aufgaben, über deren Verwendung in den Schulen frei entschieden werden kann. Neben einem sogenannten Entlastungskontingent sind Anrechnungsstunden für die Schulleitung und andere Funktionsstellen vorgesehen.Footnote 114 Die Schule entscheidet über die Verteilung der Stunden. Genauere Angaben zum Entscheidungsprozedere finden sich in der Verordnung nicht.
Auch in Brandenburg werden den Schulen Stunden für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben an der Schule und zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen sowie Anrechnungsstunden für die Schulleitung zugewiesen. Die Anrechnungsstunden aus dem Schulleitungskontingent werden von den Schulleiterinnen und Schulleitern auf die Mitglieder der Schulleitung entsprechend der Aufgabenverteilung aufgeteilt. Die Anrechnungsstunden für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben an der Schule und zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen werden im Rahmen der von der Konferenz der Lehrkräfte beschlossenen Grundsätze durch Entscheidung der Schulleiterinnen und Schulleiter gewährt, „soweit sie für die Arbeit der Schule und ihre Weiterentwicklung notwendig sind“.Footnote 115
In Sachsen werden der Schule, neben personenbezogenen zweckgebundenen Anrechnungsstunden, schulbezogene Anrechnungsstunden zugewiesen, aus denen Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter, stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter, Fachleiterinnen und Fachleiter, Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, Oberstufenberaterinnen und Oberstufenberater sowie für sonstige Leitungsaufgaben und Leitungsfunktionen, für Maßnahmen der Schulentwicklung und für die Wahrnehmung besonderer unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aufgaben generiert werden müssen.Footnote 116 Die Schulleiter und Schulleiterinnen entscheiden über die Inanspruchnahme und Verteilung der schulbezogenen Anrechnungsstunden. Die Gesamtlehrerkonferenz ist vor der Verteilung vom Schulleiter anzuhören.
In Thüringen existiert keine eigene Leitungspauschale, sondern nur eine allgemeine Schulpauschale, aus der auch die Abminderungsstunden für die Schulleitung zu generieren sind.Footnote 117 Die Verteilung der Stunden obliegt der Schule. Es ist eine Mindestanrechnung von 11 Abminderungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter und stellvertretenden Schulleiterinnen und Schulleiter vorgesehen.
Die Gewährung von Anrechnungsstunden in der Verantwortung der Schule bzw. der Schulleiterinnen und Schulleiter ist in den Ländern sehr unterschiedlich, teilweise unübersichtlich geregelt (vgl. Abb. 7.6 Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen, Schulleiter, Schulleitungen und Schulen). Im Folgenden sind drei Beispiele für unterschiedliche Regelungen genauer dargestellt, um die Varianz zu verdeutlichen. In Hessen (s. InfoboxSchulleiterdeputat, Schulleitungsdeputat, Schuldeputat und Zuschlag zur Unterrichtsversorgung in Hessen) werden Deputate für Schulleiterinnen und Schulleiter, stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter sowie weitere Mitglieder der Schulleitung gesonderte Deputate festgelegt. Außerdem erhält die Schule einen Zuschlag zur Unterrichtsversorgung, über den sie frei verfügen kann. In Bremen (s. Infobox Zuweisung und Verteilung von Leitungszeit in Bremen) wird der Schule Leitungszeit zugewiesen. Für die Funktionsstellen sind Mindestdeputate definiert. Bei der Verteilung der verbleibenden Leitungszeit können auch Lehrkräfte berücksichtig werden, die besondere Aufgaben in der Schule wahrnehmen, ohne eine Funktion innezuhaben. In Thüringen (s. Infobox Schulpauschale statt Leitungspauschale in Thüringen) wird eine allgemeine Schulpauschale zugwiesen, über deren Verwendung die Schule entscheidet. Es ist lediglich ein Minimum an Anrechnungsstunden für die gesamte Schulleitung festgelegt.
Infobox Schulleiterdeputat, Schulleitungsdeputat, Schuldeputat und Zuschlag zur Unterrichtsversorgung in Hessen
In § 3 der hessischen Pflichtstundenverordnung (PflStVO) ist festgelegt, dass den Schulen für die Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters, für die weiteren Aufgaben der Schulleitung und für weitere schulische Aufgaben jeder Schule Stundendeputate zur Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl zur Verfügung gestellt.
Leiterdeputat, Leitungsdeputat und Schuldeputat errechnen sich jeweils als Summe aus einem Sockeldeputat und einem Zusatzdeputat. Das Zusatzdeputat wird durch die Multiplikation der Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einem bestimmten Anrechnungsfaktor auf der Grundlage von Schulform und -größe gebildet.
Für die Verteilung des Schuldeputats legt die Schulleiterin oder der Schulleiter der Gesamtkonferenz einen Vorschlag vor. Kann zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Gesamtkonferenz keine Einigung über die Verteilung erzielt werden, so entscheidet die Gesamtkonferenz über die Verteilung der Hälfte der Wochenstunden und die Schulleiterinnen und Schulleiter über die Verteilung der anderen Hälfte.
Die Schule erhält außerdem einen Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung (4 % der Grundunterrichtsversorgung, bei selbstständigen Schulen beträgt der Zuschlag 5 %). Dieser Zuschlag kann als Gestaltungsressource zur Realisierung schulischer Vorhaben von der Schule eigenverantwortlich verwendet werden.
In der Pflichtstundenverordnung ist geregelt, dass aus dem Zuschlag zur Unterrichtsversorgung auch ein zusätzliches Leiter- oder Leitungsdeputat generiert werden kann. Schulleiterinnen und Schulleiter einer selbstständigen Schule können den Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung sogar ganz auf das zusätzliche Leiter- und Leitungsdeputat übertragen. Schulleiterinnen und Schulleiter, die den formalen Status einer selbstständigen Schule nicht haben, können bis zu 20 %, und im Einvernehmen mit der Gesamtkonferenz weitere zehn Prozent des Zuschlags zur Grundunterrichtsversorgung auf das zusätzliche Leiter- und Leitungsdeputat übertragen.Footnote 118
Infobox Zuweisung und Verteilung von Leitungszeit in Bremen
Die Leitungszeit wird den Schulen in der Stadtgemeinde Bremen durch die Senatorin für Kinder und Bildung, in der Stadtgemeinde Bremerhaven durch den Magistrat zugewiesen.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter verteilt die der Schule zugewiesene Leitungszeit auf die Funktionsstelleninhaberinnen und die Funktionsstelleninhaber der Schule. Dabei sind jeweils mindestens
-
a)
für die Schulleiterin oder den Schulleiter sechs Unterrichtsstunden,
-
b)
für die stellvertretende Schulleiterin oder den stellvertretenden Schulleiter vier Unterrichtsstunden,
-
c)
für sonstige Funktionsstelleninhaberinnen oder Funktionsstelleninhaber innerhalb der Schulleitung zwei Unterrichtsstunden,
-
d)
für Jahrgangs- oder Fachbereichsleiterinnen oder Jahrgangs- oder Fachbereichsleiterzwei Unterrichtsstunden,
-
e)
für Oberstufenkoordinatorinnen oder Oberstufenkoordinatoren zwei Unterrichtsstunden und
-
f)
für Fachsprecherinnen oder Fachsprecher eine Unterrichtsstunde
je Funktionsstelleninhaberin oder Funktionsstelleninhaber zu vergeben.
Die darüber hinaus gehende Leitungszeit kann in der Schule frei verteilt werden, auch auf Lehrkräfte, die besondere Aufgaben in der Schule wahrnehmen, ohne eine Funktion innezuhaben.
Die Schule kann die Mindestleitungszeiten gemäß Buchstaben c, d und e zugunsten von Leitungszeiten für Lehrkräfte ohne Funktion um jeweils eine Stunde verringern. Eine solche Abweichung muss von der Schulkonferenz beschlossen werden.
Infobox Schulpauschale statt Leitungspauschale in Thüringen
In Thüringen existiert kein gesondertes Schulleitungsbudget. Abminderungsstunden für die Tätigkeit des Schulleiters oder der Schulleiter bzw. seines oder ihrer Stellvertretung müssen aus der allgemeinen Schulpauschale generiert werden. Für Schulleiterinnen und Schulleiter und ihre Stellvertretung sind hier mindestens 11 h, in der Regel die Hälfte der Pauschale vorgesehen.Footnote 119
Als Mindestwert steht einer Schule eine Schulpauschale von 13 Lehrerwochenstunden (LWS) zu.
Die Schule entscheidet in eigener Zuständigkeit, welche der folgenden Aufgaben in welchem.
Maß vergeben werden. Die Schulpauschale kann auf folgende Aufgaben verteilt werden:
-
a)
LWS für den Schulleiter
-
b)
LWS für den stellv. Schulleiter, Oberstufenleiter an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen sowie Abteilungsleiter an berufsbildenden Schulen
-
c)
LWS für Beratungslehrer und berufliche Orientierung
-
d)
eine LWS für den Gesundheitsbeauftragten
-
e)
LWS für Klassenlehrer bzw. Klassenleitungsteam
-
f)
LWS für Arbeitsgemeinschaften (inkl. Chor/Orchester)
-
g)
weitere außerunterrichtliche Aufgaben an Schule
Die Schulen entscheiden in eigener Zuständigkeit, für welche Aufgaben die vom Schulamt zugewiesenen LWS für die Zwecke dieser Pauschale genutzt werden.
Für Schulleitungsaufgaben können in der Regel die Hälfte der LWS, jedoch mindestens elf LWS der Schulpauschale verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass der Schulleiter die Lehrerkonferenz an der Festlegung allgemeiner Kriterien für die Zumessung der Stunden aus der Pauschale beteiligen muss.
Ein Beratungslehrer erhält mindestens zwei im Maximum fünf LWS.
Der Gesundheitsbeauftragte erhält eine LWS zur Unterstützung der Schulleitung (Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe).
Für die Buchstaben f und g wurde nach einer Prüfung der Altersabminderung für Lehrkräfte durch den Rechnungshof, der in seinem im Jahresbericht 2020 nicht nur eine im Vergleich zu anderen Ländern sehr großzügige Regelung, sondern auch eine fehlende Spezifizierung alternativer Einsatzmöglichkeiten der Lehrkräfte mit Altersabminderung moniert, ein Altersabminderungsvorbehalt eingeführt. Demnach soll die Schulleitung die Aufgaben f und g zunächst an die Beschäftigten herantragen, die Altersabminderungen erhalten, bevor für diese Aufgaben LWS aus der Schulpauschale vergeben werden.
Die Regelungen der Länder unterscheiden sich zunächst dahin gehend, ob zwischen schulleiterbezogenen, schulleitungsbezogenen und schulbezogenen Anrechnungsstunden differenziert wird. Während Hessen, Niedersachsen, das Saarland, Schleswig–Holstein und BayernFootnote 120 Anrechnungsstunden für alle drei Gruppen separat ausweisen, unterscheiden Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt nur zwischen schulleitungsbezogenen und schulbezogenen Anrechnungsstunden. In diesen Ländern gilt offensichtlich die erweiterte Schulleitung als Regelfall (vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern Drucksache 6/1668, 06.05.2013)Footnote 121. Die Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter werden hier aus dem Schulleitungsbudget generiert, wobei für Schulleiterinnen und Schulleiter in der Regel eine Mindestzahl an Anrechnungsstunden festgelegt bzw. eine Mindestunterrichtsverpflichtung definiert ist. Die Mindestunterrichtsverpflichtung variiert allerdings deutlich zwischen zwei (Bayern, Niedersachsen), fünf (Brandenburg) und sechs (Berlin) Stunden. Im Großteil der Länder ist eine Mindestunterrichtsverpflichtung von vier Stunden vorgesehen.
In Bremen ist nur ein Budget für die Schulleitung vorgesehen, das Funktionsstellen umfasst. Zusätzliche Anrechnungsstunden oder Ermäßigungsstunden für besondere Belastungen, die in einer früheren Fassung der Verordnung vorgesehen waren, wurden in der 2016 geänderten Fassung gestrichen (Verordnung über die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung sowie über die Zuweisung und Verteilung von Leitungszeit für Aufgaben in der Schule).Footnote 122 Hamburg, Sachsen und Thüringen sehen lediglich ein allgemeines Budget für schulbezogen Aufgaben vor, wobei Stunden für die Schulleitung vorgesehen bzw. durch die Reduktion der Unterrichtsverpflichtung definiert sind.
Schulbezogene Anrechnungsstunden, also Stunden, die in der Verantwortung der Schule vergeben werden, werden in den Verordnungen der Länder unterschiedlich definiert. In den meisten Fällen werden in den entsprechenden Budgets besondere Belastungen berücksichtigt. Wobei die Bestimmung des Begriffs „besondere Belastung“ sehr vage ist. In der Regel erfolgt keine Spezifikation bzw. es werden nur sehr allgemeine Angaben zu Belastungen gemacht. In der Verordnung Sachsen-Anhalts werden beispielsweise „Verwaltungsaufgaben, besondere unterrichtliche oder schulformspezifische Belastungen“ genannt.Footnote 123 In der Verordnung des Saarlands werden der Unterricht in Korrekturfächern, Oberstufen- oder Abschlussklassen, die Betreuung von Schulpartnerschaften und die Wahrnehmung von Aufgaben der Nachbarschaftsschule als besondere Belastungen genannt.Footnote 124
Die Formulierungen in den Verordnungen zeigen, wie unterschiedlich die nicht-zweckgebundenen Anrechnungsstunden definiert sind. Eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung wird beispielsweise gewährt für die „Wahrnehmung besonderer unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aufgaben sowie den Ausgleich besonderer zeitlicher unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Belastungen“Footnote 125, für „Verwaltungsaufgaben und besondere pädagogische Aufgaben“Footnote 126, für „besondere unterrichtliche Belastungen und Sonderaufgaben“Footnote 127, für „besondere dienstliche Tätigkeiten und zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen“Footnote 128 oder für „besondere unterrichtliche oder sonstige schulische Arbeit“Footnote 129. In der Bayerischen Verordnung für RealschulenFootnote 130 werden Anrechnungsstunden für „schulgebundene Funktionen und besondere Maßnahmen pädagogischer Art“ gewährt. „Aus dem Kontingent können Lehrkräfte mit zeitaufwendigen Sonderaufgaben (z. B. Beratungslehrkraft, Fachbetreuung, Systembetreuung, Verbindungslehrkraft) wie auch Lehrkräfte, die Maßnahmen besonderer pädagogischer Art (z. B. Pädagogische Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten oder von besonders betreuungsaufwendigen Klassen, Mitwirkung bei der Gestaltung der Schule als Lebensraum der Schülerinnen und Schüler, Betreuung außerunterrichtlicher schulischer Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler, Nachmittagsbetreuung außerhalb von Ganztagsangeboten) ausüben, Anrechnungsstunden erhalten“Footnote 131.
Nur in wenigen Verordnungen findet sich ein expliziter Hinweis auf Schulentwicklungsaufgaben. Im Leistungserlass des Ministeriums in Schleswig–Holstein ist ein Zeitbudget nicht nur für die pädagogische Arbeit, sondern explizit auch für „Schulentwicklung“Footnote 132 vorgesehen. Auch im Hamburger Arbeitszeitmodell werden Anrechnungsfaktoren für Schulentwicklungsaufgaben definiert. In Niedersachsen sind Anrechnungsstunden für die „Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit der Schule“Footnote 133 im Leitungsbudget vorgesehen. Schulleiterinnen und Schulleiter gewähren die Anrechnung dieser StundenFootnote 134.
Während in Bayern für jedes Schuljahr „die Anrechnungsstunden – je nach tatsächlichem Arbeitsanfall – neu festzulegen“ sindFootnote 135 und in Schleswig-Holstein die Gewährung von Anrechnungsstunden für Aufgaben der Schulentwicklung auf maximal zwei Jahre befristet istFootnote 136, finden sich in den Verordnungen der anderen Länder keine Hinweise auf eine zeitliche Befristung. In der Brandenburger Verordnung steht lediglich, dass „Anrechnungsstunden … auch für einen kürzeren Zeitraum als ein Schuljahr gewährt werden“ könnenFootnote 137 und in Rheinland-Pfalz findet sich die Formulierung, Anrechnungsstunden „können auch für einen geringeren Zeitraum als ein Schuljahr gewährt werden.“Footnote 138 In Hamburg ist eine Befristung implizit vorgegeben, weil die Stundenzuweisung im Rahmen des Arbeitszeitmodells jährlich neu berechnet werden muss.
Leitungsbezogene (bei erweiterter Schulleitung) und schulbezogene Anrechnungsstunden stellen prinzipiell Anreize für eine individualisierte Personalentwicklung dar, wenn Schulleiterinnen und Schulleiter über die Verteilung der Stunden entscheiden können. Die Länder haben auch hinsichtlich der Entscheidung über Anrechnungsstunden unterschiedliche Regelungen getroffen.
Die Entscheidung über die Verteilung von Anrechnungsstunden innerhalb der erweiterten Schulleitung liegt in Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt bei den Schulleiterinnen bzw. Schulleitern. In Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist eine Abstimmung über die Stundenverteilung aus dem Schulleitungsbudget zwischen Schulleiterinnen und Schulleitern und Leitungsteam vorgesehen. In der Verordnung von Nordrhein-Westfalen ist festgelegt, dass die Leitungszeit „entsprechend den tatsächlichen Belastungen zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und der Vertretung aufgeteilt werden“ soll. Kann die Schulleiterin oder der Schulleiter kein Einvernehmen mit der ständigen Vertretung und den anderen mit Leitungsaufgaben betrauten Lehrkräften herstellen, entscheidet die SchulaufsichtFootnote 139. Diese Regelung kann ebenso als Bekenntnis zu einer kollegialen Schulleitung wie als Relativierung der Entscheidungskompetenz der Schulleitung durch das Letztentscheidungsrecht der Schulaufsicht im Konfliktfall interpretiert werden. In Schleswig–Holstein muss die Schulleiterin bzw. Schulleiter die Lehrerkonferenz vor der Verteilung der Anrechnungsstunden aus dem Leitungsbudget anhören.Footnote 140 In Thüringen wird nur ein schulbezogenes Budget zugewiesen, aus dem auch die Anrechnungsstunden für Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Stellvertretenden generiert werden müssen.Footnote 141 Hamburg ist insofern ein Sonderfall, als hier ein Arbeitszeitmodell eingeführt wurde.
Was die zugewiesenen Stunden für Schulleiterinnen und Schulleiter bzw. die Unterrichtsverpflichtung betrifft, sehen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein explizit die Möglichkeit vor, Anrechnungsstunden für die Tätigkeit als Schulleiterin und Schulleiter auf andere Lehrkräfte zu übertragen. Im Saarland dagegen verfallen die Anrechnungsstunden, wenn eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter sie nicht in Anspruch nimmt. In den anderen Ländern, in denen ein Budget für Schulleitungsaufgaben vorgesehen ist, ist in der Regel eine flexible Verteilung der Stunden möglich. Teilweise ist, wie z. B. in Bremen, auch eine Übertragung von Anrechnungsstunden aus dem Leitungsbudget auf Lehrkräfte, die nicht der erweiterten Schulleitung angehören, möglich. In Bayern ist eine solche Übertragung explizit ausgeschlossen.
Was die schulbezogenen Anrechnungsstunden betrifft, entscheidet in Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen die Schulleiterin bzw. der Schulleiter allein über die Verteilung der Anrechnungsstunden (vgl. Abb. 7.7 Entscheidung über Anrechnungsstunden). In Baden-Württemberg müssen Schulleiterinnen und Schulleiter die Lehrerkonferenz bezüglich der Verteilung der Anrechnungsstunden anhören. In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen entscheidet die Schulleitung auf der Grundlage der von der Lehrerkonferenz beschlossenen Grundsätze über die schulbezogenen Anrechnungsstunden. Auf eine einvernehmliche Entscheidung wird in Nordrhein-Westfalen besonderer Wert gelegt: „Das Verfahren bei der Verteilung der Anrechnungsstunden sichert die Beteiligung der Lehrerkonferenz in grundsätzlichen Fragen und trägt gleichzeitig der besonderen Verantwortung der Schulleitung für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule Rechnung. Wegen der gemeinsamen Verantwortung von Schulleitung und Kollegium für die Schule ist es auf eine Konsensbildung hin angelegt. Dementsprechend soll die Schulleiterin oder der Schulleiter bei ihrem oder seinem Vorschlag Anregungen der Lehrerkonferenz für die Grundsätze berücksichtigen“.Footnote 142
In Hessen muss die Schulleiterin bzw. der Schulleiter Einvernehmen über die Verteilung der Anrechnungsstunden mit der Lehrerkonferenz herstellen. Wenn keine Einigung möglich ist, entscheidet die Schulleiterin bzw. der Schulleiter über die eine Hälfte der Anrechnungsstunden, die Lehrerkonferenz über die andere Hälfte.Footnote 143
In der Berliner Verordnung steht: „Für die Wahrnehmung besonderer unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aufgaben stehen den allgemein bildenden und den beruflichen Schulen sowie den Kollegs und Abendgymnasien Anrechnungsstunden zur Verfügung, über deren Verwendung in den Schulen frei entschieden werden kann“Footnote 144, eine explizite Entscheidungsberechtigung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters ist nicht festgelegt.
Bei der Verteilung von Anrechnungsstunden lässt sich eine Abstufung hinsichtlich der Beteiligung des Kollegiums im Entscheidungsprozesses erkennen:
-
Alleinige Entscheidung Schulleiterin bzw. Schulleiter,
-
Entscheidung auf der Grundlage einer Anhörung der (Lehrer-)Konferenz,
-
Entscheidung geprägt durch Grundsätze, beschlossen von der (Lehrer-)Konferenz,
-
Entscheidung im Einvernehmen mit der – /mit Zustimmung der (Lehrer-)Konferenz.
Unterschiede bestehen auch hinsichtlich des Einbezugs der Personalvertretung in die Verteilung der Stunden. Während die meisten Verordnungen, die die schulbezogenen Anrechnungsstunden regeln, keine Vorschriften zur Beteiligung des Personalrats bei der Verteilung dieser Anrechnungsstunden enthalten, die über die allgemeinen Beteiligungsrechte des Personalrats hinausgehen, ist in Thüringen festgelegt, dass der zuständige Personalrat über die „Verteilung aller Anrechnungsstunden und Wochenstunden für spezifische Aufgaben auf die einzelnen Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogischen Fachkräfte … mitzubestimmen“ hat.Footnote 145 In Rheinland-Pfalz enthält die Lehrerarbeitszeitverordnung bezüglich der Verteilung der Anrechnungsstunden die Formulierung: „Der Personalrat ist in der gesetzlich vorgesehenen Weise zu beteiligen“.Footnote 146 In Mecklenburg-Vorpommern trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Beratung mit dem Leitungsteam die Entscheidung über die Vergabe der Anrechnungsstunden aus dem Stundenpool; „der Örtliche Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte sowie die zuständige Schwerbehindertenvertretung“ sind „zu beteiligen“.Footnote 147 In Bayern ist der Personalrat bei der Vergabe von Anrechnungsstunden für schulgebundene Funktionen und besondere Maßnahmen pädagogischer Art in Realschulen und Gymnasien „zu hören“.Footnote 148
7.3 Zusammenfassung
Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen und Anreize werden in Personalentwicklungskonzepten der freien Wirtschaft als drei miteinander verknüpfte Instrumente einer individualisierten Personalentwicklung verstanden. Aber auch für den öffentlichen Dienst wird eine Verknüpfung von Zielvereinbarungen mit Elementen der leistungsorientierten Bezahlung diskutiert (Vogel 2019).
Was die rechtlichen Regelungen für den Schulbereich betrifft, werden in den deutschen Ländern Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen in einigen Ländern miteinander verknüpft. Unterrichtsbesuche der Schulleitungen stellen eine wichtige Grundlage für Gespräche zwischen Schulleitung und Lehrkräften dar und Zielvereinbarungen betreffen häufig Fortbildung. In der Mehrzahl der Länder sind Mitarbeitergespräche zwischen Schulleitungen und Lehrkräften verpflichtend vorgesehen, in den restlichen Ländern sind sie – bis auf das Saarland – zumindest optional. Zielvereinbarungen sind nur in drei Ländern verpflichtend vorgesehen. Bis auf drei Länder sind Zielvereinbarungen in allen Ländern zumindest möglich. In einigen Ländern existieren Kriterienkataloge oder Checklisten für Mitarbeitergespräche, die zur Vorbereitung und Strukturierung der Gespräche genutzt werden können. Nur in einem Land werden die Vereinbarungen, die in Mitarbeitergesprächen getroffen werden, in die Personalakte aufgenommen. Andere Länder schließen dies explizit aus.
Leistungsanreize für Lehrkräfte werden in Deutschland, wenn überhaupt, unabhängig von Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen gewährt. In Bremen wird eine Verknüpfung von Mitarbeitergespräch und leistungsbezogener Bezahlung explizit ausgeschlossen.
Obwohl leistungsbezogene Vergütungselemente im Besoldungsrecht des öffentlichen Dienstes seit der Dienstrechtsreform von 1997 möglich und im Hochschulbereich inzwischen auch flächendeckend implementiert sind, sind sie im Schulsystem aktuell lediglich in Bayern und Sachsen eingeführt. Allerdings handelt es sich bei den in diesen beiden Ländern eingeführten Leistungsprämien nicht um Output-bezogene Anreizsysteme auf der Grundlage einer standardisierten Erfassung der Arbeitsergebnisse, wie sie vor allem in den angelsächsischen Ländern üblich sind. Auch eine systematische Verknüpfung mit Zielvereinbarungen erfolgt nicht. An welchen Kriterien sich die Bewertung einer Leistung orientiert, bleibt insofern intransparent, als die entsprechenden Verordnungen den Dienstvorgesetzen hohe Entscheidungsspielräume bei der Beurteilung einer individuellen Leistung einräumen.
Anders als Leistungsprämien haben Anrechnungsstunden in Schulen in allen Ländern eine wichtige Bedeutung. Dass der Gesetzgeber mit der Gewährung von schulbezogenen Anrechnungsstunden durchaus eine Anreizfunktion verbindet, lässt sich an Formulierungen in einigen Verordnungen ablesen, die – wie z. B. die Lehrerarbeitszeitverordnung des Landes Rheinland-Pfalz – eine „gleichmäßige Verteilung der Anrechnungspauschale“ mit dem Hinweis explizit ausschließen, dass eine solche Verteilung „mit ihrer Zweckbestimmung nicht zu vereinbaren“ und deshalb „unzulässig“ istFootnote 149. Eine ganze Reihe von Ländern sieht inzwischen pauschale Stundenzumessungen für Leitungs- und sonstige schulische Aufgaben vor, über deren Gewährung in der Schule selbst entschieden werden kann. Dabei ist die Entscheidung über Anrechnungsstunden unterschiedlich geregelt. Einige Länder legen die Gewährung von Anrechnungsstunden vollständig in die Zuständigkeit des Schulleiters oder der Schulleitung.Footnote 150 In anderen Ländern ist der Einbezug der Lehrerkonferenz in Form der Abstimmung von Grundsätzen vorgesehen. In Thüringen ist die Mitbestimmung des Personalrats bei der Verteilung der Anrechnungsstunden auf die einzelnen Lehrkräfte vorgeschrieben.
Grundsätzlich legen die Formulierungen in den Verordnungen nahe, dass Anrechnungsstunden nach wie vor weniger unter dem Gesichtspunkt des Anreizes für die Übernahme von spezifischen Aufgaben der Schulentwicklung als unter dem Gesichtspunkt der Kompensation von allgemeinen Belastungen (z. B. Korrekturen) betrachtet werden.
Eine Befristung der gewährten Anrechnungsstunden für schulbezogene Aufgaben ist nur in Schleswig-Holstein und Bayern explizit und in Brandenburg und Rheinland-Pfalz implizit festgelegt. In Hamburg ist die Befristung durch die kontinuierliche Aktualisierung der Stundenzumessung entsprechend des Arbeitsmodells gegeben.
Die Implementation von Instrumenten einer individualisierten Personalentwicklung unterscheidet sich zwischen den Ländern deutlich (s. Abb. 7.8 Instrumente einer individualisierten Personalentwicklung).
Insgesamt verfügen Schulleiterinnen und Schulleiter in Bayern, Bremen und Sachsen über große bis eher große Einflussmöglichkeiten, was die Instrumente einer individualisierten Personalentwicklung angeht. Im Saarland haben Schulleiterinnen und Schulleiter (bezogen auf die hier erfassten Instrumente) dagegen gar keine Einflussmöglichkeiten (vgl. Abb. 7.9 Instrumente einer individualisierten Personalentwicklung (gesamt)).
Change history
01 February 2023
Einige Korrekturen wurden im Zuge der Produktion des Buchs übersehen. Neben einigen kleineren Korrekturen wurde die Darstellung des Herausgebenden- und Autor*innenverzeichnisses vereinheitlicht und eine zentrale Widmung hinzugefügt.
Notes
- 1.
Das muss nicht zwangsläufig die Schulleiterin oder der Schulleiter sein. In vielen Fällen ist eine Delegation der Aufgaben an die stellvertretende Schulleitung oder ein weiteres Mitglied des Schulleitungsteam möglich.
- 2.
URL: https://www.gew-nrw.de/mitarbeiter-innengespraeche.html. Abruf am: 17.08.2021.
- 3.
IV Abs. 4 bw VwV Fortbildung und Personalentwicklung.
- 4.
II bw VwV Beratungsgespräch und dienstliche Beurteilung.
- 5.
§ 41 Abs. 2 bw SchG.
- 6.
Bw VwV Beratungsgespräch und dienstliche Beurteilung.
- 7.
§§ 4 und 5 Abs. 2 bw EvaluationsVO.
- 8.
§ 41 Abs. 2 bw SchG.
- 9.
I bay Bkm. Mitarbeitergespräch.
- 10.
II bay Bkm. Mitarbeitergespräch.
- 11.
Nr. I bay Bkm. Mitarbeitergespräch
- 12.
III bay Bkm. Mitarbeitergespräch.
- 13.
I bay Bkm. Mitarbeitergespräch.
- 14.
VI bay Bkm. Mitarbeitergespräch.
- 15.
Bay Richtlinien dienstliche Beurteilung.
- 16.
§ 24 Abs. 2 bay LDO.
- 17.
§ 57 Abs. 2 BayEUG; § 26 Abs. 3 bay LDO.
- 18.
Bln BLVO.
- 19.
Bln BLVO.
- 20.
§ 69 Abs. 4 bln SchG.
- 21.
Nr. 3.1 bln VV Zuordnung.
- 22.
Bln BLVO.
- 23.
§§ 5–7 bbg VVLEG-L.
- 24.
Bbg VVLEG-L.
- 25.
§ 70 BbgSchulG.
- 26.
§ 71 Abs. 2 BbgSchulG.
- 27.
§ 19 Abs. 3 brem LDO; § 3 brem DV PE-Gespräche.
- 28.
§ 2 brem DV PE-Gespräche.
- 29.
§ 19 Abs. 3 brem LDO.
- 30.
Brem DV PE-Gespräche.
- 31.
Brem DV PE-Gespräche.
- 32.
§ 17 Abs. 2 brem LDO.
- 33.
§ 63 Abs. 1 S. 4 BremSchulG.
- 34.
§ 17 Abs. 1 brem LDO.
- 35.
§ 19 Abs. 3 brem LDO.
- 36.
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg Personalamt (Hrsg.). (2003). Mitarbeiterinnen-/ Mitarbeiter- Vorgesetzten- Gespräch.
- 37.
§ 6 Abs. 1 hmb BeurtRL-Lehrkräfte.
- 38.
§ 89 Abs. 3 S. 3 HmbSG.
- 39.
Nr. 3.3 hmb DA Lehrerinnen und Lehrer.
- 40.
§ 17 Abs. 6 S. 1 hess LDO.
- 41.
§ 13 hess Grds Zusammenarbeit und Führung LVW.
- 42.
vgl. Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung in der hessischen Landesverwaltung i.d.F. vom 04.04.2007 und 28.12.2021.
- 43.
§ 66 Abs. 2 LehrBiG HE 2011.
- 44.
§ 88 Abs. 2 Nr. 3 SchulG HE 2017.
- 45.
§ 18 Abs. 1 hess LDO.
- 46.
§17 Abs. 3 S. 1 mv LehbildG M-V.
- 47.
§ 14 Abs. 4 S. 1 mv BildDLaufbVO M-V.
- 48.
§ 14 Abs. 4 mv BildDLaufbVO M-V.
- 49.
§ 101 Abs. 4 Nr. 2 mv SchulG M-V.
- 50.
§ 101 Abs. 4 mv SchulG M-V.
- 51.
§ 101 Abs. 4 Nr. 2 mv SchulG M-V.
- 52.
§ 43 Abs. 1 NSchG.
- 53.
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 nds NLVO.
- 54.
§ 43 Abs. 1 und 2 NSchG.
- 55.
Im Curriculum der Schulleitungsqualifizierung wird in einer Fußnote darauf hingewiesen: „Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarung sind vom MSW für den Schulbereich nicht eingeführt. Sie unterliegen der personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmung.“ Derselbe Hinweis findet sich auch bei der GEW (https://www.gew-nrw.de/mitarbeiter-innengespraeche.html. Abruf am 15.08.2021).
- 56.
§ 22 Abs. 2 nrw ADO.
- 57.
§ 21 Abs. 2 nrw ADO.
- 58.
Nr. 2.6 rp DO-Schulen.
- 59.
Nr. 2.4 rp DO-Schulen.
- 60.
3.2.1.7 rp DO-Schulen.
- 61.
III Nr. 8 saarl VwV dB LuL.
- 62.
§ 3 Abs. 4 saarl ADOS.
- 63.
§ 3 Abs. 6 saarl ADOS.
- 64.
§ 16 Abs. 3 saarl SchumG; § 3 Abs. 4 saarl ADOL.
- 65.
§ 16 Abs. 4 saarl SchumG.
- 66.
§ 42 Abs. 1 S. 6 SächsSchulG.
- 67.
§ 16 sächs VwV Behörden – Dienstordnung.
- 68.
https://www.smk.sachsen.de/personal.html. Zugegriffen: 12.08.2021.
- 69.
§ 42 Abs. 2 S. 2 SächsSchulG.
- 70.
§ 42 Abs. 1 SächsSchulG.
- 71.
Sächsisches Staatsministerium für Kultus [SMK]. Personalentwicklungskonzept für den Verwaltungsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK).
- 72.
Nr. 7.3 Nr. 1 st RdErl. Stärkung SL.
- 73.
§ 26 Abs. 5 S. 2 SchulG LSA.
- 74.
Nr. 7.3 Nr. 2 st RdErl. Stärkung SL.
- 75.
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig–Holstein (Hrsg.). (2009). Mitarbeitergespräch. Personalentwicklung, Zusammenarbeit, Förderung, Führung. Verfügbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Fuehrungskraefte/Material/Downloads/Personalentwicklung/mitarbeitergespraech.html.
- 76.
§ 33 ABs. 2 sh SchulG.
- 77.
§ 3 Abs. 5 sh Lehrerdienstordnung.
- 78.
III Leitung und Qualitätsentwicklung: Unterrichtsentwicklung: URL: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schule_qualitaet/Downloads/orientierungsrahmen.html. Abruf am: 13.09.2021.
- 79.
§ 35 Abs. 5 ThürLbG.
- 80.
§§ 5 Abs. 5 S. 2 und 35 Abs. 2 ThürLbG.
- 81.
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.), Leitfaden zur Durchführung von Mitarbeiter/innen-Vorgesetzten-Gesprächen für den Bereich der Schulen des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.
- 82.
§ 33 Abs. 1 ThürSchulG.
- 83.
§ 28 Abs. 3–4 th LDO.
- 84.
§ 33 Abs. 1 S. 5 ThürSchulG.
- 85.
BLBV; Hinw BLBV.
- 86.
Entsprechend erhalten in Bayern, wo eine Leistungsprämie auch für Lehrkräfte eingeführt ist, nur verbeamtete Lehrkräfte und Angestellte kommunaler Schulen, nicht aber angestellte Lehrkräfte im Landesdienst eine Leistungsprämie. Die GEW beschreibt es in Bayern als ihr Verdienst, dass es gelungen sei „Elemente der leistungsorientierten Bezahlung im Tarifvertrag zu verhindern.“ (https://www.gew-bayern.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/by/dokumente/Schule/Ratgeber_Schule_2016/Leistungsstufen_Leistungspraemien.pdf).
- 87.
Diese präzisiert Art. 67 des Bayerischen Besoldungsgesetzes; vgl. auch die Darstellung der bayerischen Situation und der Rolle der Personalräte in der BLLV-Zeitschrift Nr.3/2021, S. 46 – verfügbar unter URL: https://www.bllv.de/fileadmin/BLLV/Bilder/BLLV/Verbandsmedien/Bayerische_Schule/bs_21_3/Internet_Bay_Schule_03.pdf.
- 88.
Art. 67.1 BayVwVBes.
- 89.
Sh LPVO.
- 90.
§ 6 Abs. 1 nrw LPZVO.
- 91.
Laut eines Berichts der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags von 2018 hatten zum damaligen Zeitpunkt Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Brandenburg, Sachsen und Rheinland-Pfalz Regelungen zur Einführung von Leistungsanreizen im öffentlichen Dienst getroffen. Bayern hat zum Zeitpunkt der Verfassung des Berichts als einziges Land ein festes Budget für die Vergabe von Leistungsprämien vorgesehen. Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland haben keine leistungsorientierten Bezahlinstrumente eingeführt (Deutscher Bundestag. Wissenschaftliche Dienste 2018, S. 12).
- 92.
Leistungsstufen dürfen nach Auskunft der bayrischen GEW in Schulen nur in absoluten Ausnahmefällen vergeben werden (https://www.gew-bayern.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/by/dokumente/Schule/Ratgeber_Schule_2016/Leistungsstufen_Leistungspraemien.pdf). Sie sind insofern in ihrer Bedeutung als Anreizsysteme im Schulsystem zu vernachlässigen.
- 93.
Art. 66 Abs. 2 Satz 1 bayBesG.
- 94.
§ 42a BBesG.
- 95.
Allerdings ist auch im Bericht „Bildung auf einen Blick“ der OECD die Definition von Leistungsanreizen unscharf: „Zusätzliche Vergütungen, entweder in Form von gelegentlichen zusätzlichen oder jährlichen Zahlungen oder durch eine Erhöhung des Grundgehalts, werden … für herausragende Leistungen von Lehrkräften im Sekundarbereich I gewährt. Zusätzliche Zahlungen können auch Bonuszahlungen für besondere Unterrichtsbedingungen sein, z. B. das Unterrichten von Schülern mit besonderen Lernbedürfnissen in Regelschulen und das Unterrichten in benachteiligten oder abgelegenen Gegenden bzw. Gegenden mit hohen Lebenshaltungskosten.“
- 96.
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b14b2c92-en/index.html?itemId=/content/component/b14b2c92-en#annex-d1e30356. WEB Table D3.17. Criteria used for base salaries and additional payments awarded to teachers in public institutions, by level of education (2019). Abruf am: 28.07.2021.
- 97.
§ 40 ThürBesG.
- 98.
Anlage 1, Besoldungsordnungen A und B ThürBesG.
- 99.
- 100.
Bw Drucksache 12/5787. Landtag von Baden-Württemberg 12. Wahlperiode. Anfrage des Abg. Norbert Zeller SPD und Antwort des Finanzministeriums: Leistungsstufen und Leistungsprämien vom 04.12.2000.
- 101.
Art. 67 Abs. 2 bayBesG.
- 102.
Bay Drucksache 16/6904.
- 103.
§ 2 Abs. 1 Sächs LPVO.
- 104.
Nr. 6.1 bay Richtlinien dienstliche Beurteilung.
- 105.
So die bayrische GEW in einem Informationsblatt für Lehrkräfte (https://www.gew-bayern.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/by/dokumente/Schule/Ratgeber_Schule_2016/Leistungsstufen_Leistungspraemien.pdf).
- 106.
Die Altersermäßigung ist allerdings umstritten. Einzelne Länder verweisen zwar darauf, dass es sich lediglich um eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung handelt, allerdings ist nicht geregelt, in welchen Bereichen Lehrkräfte alternativ eingesetzt werden können. Der Thüringer Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht von 2020, die Gewährung von zwei Anrechnungsstunden bei Erreichen des 55. Lebensjahrs sehr kritisch kommentiert und angesichts des hohen Unterrichtausfalls eine Abschaffung der Altersermäßigung gefordert. Dies würde 490 zusätzliche Lehrerstellen schaffen. Das zuständige Ministerium hat daraufhin eines Altersermäßigungsvorbehalt in der Organisation des Schuljahres 2021/2022 formuliert.
- 107.
Eine Reihe von Ländern wie Bremen (§ 9 des Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz – BremLAAufG) haben zwar die Möglichkeit der Einführung neuer Arbeitszeitmodelle vorgesehen, bislang ist aber lediglich Hamburg den Weg einer Festlegung pauschalierender Zeitansätze für unterschiedliche unterrichtliche und außerunterrichtliche Aufgaben gegangen.
- 108.
Hmb LehrArbzVO.
- 109.
§§ 4–6 hess PflStVO.
- 110.
§ 3 Abs. 4 hess PflStVO.
- 111.
§ 4 Abs. 3 saarl PflichtstundenVO.
- 112.
Leitungszeiterlass. Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 31. August 2010, geändert durch Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 21. Juni 2020, § 9.
- 113.
§ 13 nds ArbZVO-Schule.
- 114.
In Bayern existieren getrennte Verordnungen für Gymnasien, Realschulen, Grund- und Mittelschulen.
- 115.
Nr. 2.2 bay Bkm. Anrechnungsstunden Lehrkräfte.
- 116.
Brem VO Anrechnungsstunden Leitung.
- 117.
§ 4 brem VO Anrechnungsstunden Leitung.
- 118.
§ 1 Abs. 6 mv UntVersVO M-V.
- 119.
Anlage 1: Nr. 1.2.3 rp LehrArbZVO.
- 120.
Anlage 1: Nr. 1.1 rp LehrArbZVO.
- 121.
IV bw VwV Anrechnungsstunden und Freistellungen.
- 122.
Nrw VO zu § 93 Abs. 2 SchulG mit AVO-RL.
- 123.
St ArbZVO-Lehr.
- 124.
Bln Zumessungsrichtlinie 2019/20.
- 125.
Nr. 2 und 3 bbg VV Anrechnungsstunden.
- 126.
SächsLKAZVO.
- 127.
Th VVOrgS 2021.
- 128.
Hess PflStVO.
- 129.
Von den Personalvertretungen wird diese Möglichkeit der Umschichtung von Stunden zugunsten der Schulleitung durch Schulleiterinnen und Schulleiter sehr kritisch betrachtet (https://www.gew-hessen.de/fileadmin/user_upload/themen/Stellenzuweisung/190527_brA4_unterrichtsversorgung_web.pdf).
- 130.
§ 4 brem VO Anrechnungsstunden Leitung.
- 131.
Th VVOrgS (2021)
- 132.
In seinem Jahresbericht kommt der Thüringische Rechnungshof auf der Grundlage einer Befragung von Schulleitungen zur Einschätzung, dass diese Bemessung nicht ausreicht.
- 133.
Ein Schulleitungsbudget ist nur dort vorgesehen, wo eine erweiterte Schulleitung eingerichtet werden kann.
- 134.
Mv Drucksache 6/1668. Landtag Mecklenburg-Vorpommern 6. Wahlperiode. Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Berger, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Arbeitsbelastung von Schulleiterinnen und Schulleitern – und Antwort der Landesregierung vom 06.05.2013 (Drucksache 6/1668).
- 135.
Ermäßigungen aus Altersgründen oder aufgrund einer Schwerbehinderung sind in der Verordnung geregelt.
- 136.
§ 10 st ArbZVO-Lehr.
- 137.
§ 6 saarl PflichtstundenVO.
- 138.
§ 4 SächsLKAZVO.
- 139.
§ 11 mv LehrArbzLVO M-V.
- 140.
§ 8 rp LehrArbZVO.
- 141.
§ 6 Abs. 1 hess PflStVO.
- 142.
§ 6 saarl PflichtstundenVO.
- 143.
Es existieren getrennte Verordnungen für Gymnasien, Realschulen, Mittel- und Grundschulen.
- 144.
Nr. 3.2 bay Bkm. Leitungszeit.
- 145.
§ 8 sh Leitungszeiterlass.
- 146.
§ 12 nds ArbZVO-Schule.
- 147.
Nds Drucksache 17/8442. Niedersächsischer Landtag 17. Wahlperiode. Anfrage des Abgeordneten Grant Hendrik Tonne (SPD) an die Landesregierung, eingegangen am 06.07.2017, an die Staatskanzlei übersandt am 13.07.2017 und Antwort des Niedersächsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung vom 17.08.2017. Sind Entlastungsstunden verzichtbar?
- 148.
Nr. 2.2 bay Bkm. Anrechnungsstunden Lehrkräfte.
- 149.
§ 9 sh Leitungszeiterlass.
- 150.
Nr. 1.4 bbg VV Anrechnungsstunden.
- 151.
Anlage 1: 1.2.3 rp LehrArbZVO.
- 152.
§ 5 nrw VO zu § 93 Abs. 2 SchulG mit AVO-RL.
- 153.
§ 9 sh Leitungszeiterlass.
- 154.
Nr. 3.6.1 th VVOrgS (2021).
- 155.
Nr. 2.5 nrw VO zu § 93 Abs. 2 SchulG mit AVO-RL.
- 156.
§ 6 Abs. 7 hess PflStVO.
- 157.
Abschnitt VI bln Zumessungsrichtlinie (2019/20).
- 158.
Nr. 3.6.1 th VVOrgS (2021).
- 159.
Nr. 1.2.3 rp LehrArbZVO.
- 160.
§ 7 Abs. 6 mv LehrArbzLVO M-V.
- 161.
Nr. 2.1 bay Bkm. Anrechnungsstunden Lehrkräfte.
- 162.
Anlage 1: 1.2.3 rp LehrArbZVO.
- 163.
Die Information der oder Abstimmung mit den Personalvertretungen über Rahmenbedingungen wurde bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Literatur
Bach, A., Böhnke, A. & Thiel, F. (2020). Improving instructional competencies through individualized staff development and teacher collaboration in German schools. International Journal of Educational Management, 34(8), 1289–1302. https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2019-0294
Bartlett, S. (2000). The development of teacher appraisal: A recent history. British Journal of Educational Studies, 48(1), 24–37. https://doi.org/10.1111/1467-8527.00131
Bull, H. P. (2008). Neue Entwicklungen im Deutschen Öffentlichen Dienst: Veränderungen des Bewusstseins und der Rechtslage. Zeitschrift Für Staats- Und Europawissenschaften (ZSE)) / Journal for Comparative Government and European Policy, 6(4), 638–665. Verfügbar unter: http://www.jstor.org/stable/26165448
Buhren, C. G. & Rolff, H.‑G. (2009). Personalmanagement für die Schule. Ein Handbuch für Schulleitung und Kollegium (Beltz Pädagogik, Bd. 2). Weinheim: Beltz.
Danielson, C. (1996). Enhancing professional practice. A framework for teaching. Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development.
Dee, T. S. & Wyckoff, J. (2015). Incentives, selection, and teacher performance: Evidence from IMPACT. Journal of Policy Analysis and Management, 34(2), 267–297. https://doi.org/10.1002/pam.21818
Demmke, C. (2019). Reform der öffentlichen Dienste im internationalen Vergleich. In S. Veit, C. Reichard & G. Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform (5., vollständig überarbeitete Auflage 2019, S. 373–384). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Deutscher Bundestag. Wissenschaftliche Dienste. (2018). Besoldung und Vergütung im öffentlichen Dienst. WD 6 - 3000 - 114/18.
Große, S. (2019). Qualität des öffentlichen Schulwesens als Verfassungsgebot? Zugleich zum Institut der schulischen Eigenverantwortung (Studien zum Schul- und Bildungsrecht, Bd. 17). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://doi.org/10.5771/9783845297262
Heneman III, H., Milanowski, A., Kimball, S. & Odden, A. (2006, Mai). Standards-based teacher evaluation as a foundation for knowledge- and skill-based pay. CPRE Policy Briefs. https://doi.org/10.12698/cpre.2013.rb45
Holling, H. & Liepmann, D. (2007). Personalentwicklung. In H. Schuler (Hrsg.), Lehrbuch Organisationspsychologie (Psychologie-Lehrbuch, 4., aktualisierte Aufl., S. 345–384). Bern: Huber.
Jacob, B. A. & Lefgren, L. (2008). Can principals identify effective teachers? Evidence on subjective performance evaluation in education. Journal of Labor Economics, 26(1), 101–136. https://doi.org/10.1086/522974
König, S. & Rehling, M. (2006). Mitarbeitergespräche. Erfolgsfaktoren, Potenziale und Defizite in der öffentlichen Verwaltung (Edition der Hans-Böckler-Stiftung, Unternehmensmitbestimmung und Unternehmenssteuerung, Bd. 156). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. Verfügbar unter: http://hdl.handle.net/10419/116401
Lazear, E. P. (2003). Teacher incentives. Swedish economic policy review, (10 (2)), 179–214.
Lazear, E. P. (2018). Compensation and incentives in the workplace. The Journal of Economic Perspectives. https://doi.org/10.1257/jep.32.3.195
Locke, E. A. & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting & task performance. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. A 35-year odyssey. The American Psychologist, 57(9), 705–717. https://doi.org/10.1037//0003-066x.57.9.705
Meetz, F. (2007). Personalentwicklung als Element der Schulentwicklung. Bestandsaufnahme und Perspektiven (Klinkhardt Forschung). Zugl.: Duisburg-Essen, Univ., Diss., 2007. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
OECD (Hrsg.). (2020). Bildung auf einen Blick 2020. OECD-Indikatoren. Bielefeld: wbv Publikation. Verfügbar unter: https://doi.org/10.3278/9783763965915
Pham, L. D., Nguyen, T. D. & Springer, M. G. (2021). Teacher merit pay: A meta-analysis. American Educational Research Journal, 58(3), 527–566. https://doi.org/10.3102/0002831220905580
Podgursky, M. J. & Springer, M. G. (2007). Teacher performance pay. A review. Journal of Policy Analysis and Management, 26(4), 909–950. https://doi.org/10.1002/pam.20292
Semmler, J. & Wewer, G. (2005). Mitarbeitergesprache. In S. von Bandemer, F. Nullmeier & G. Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform (SpringerLink Bücher, 3. Aufl., S. 290–296). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Tarkian, J. (2020). Personalentwicklung im Kontext testbasierter Steuerung im Schulsystem. Eine qualitative Studie über Praktiken, Bedingungen und Barrieren schulleitungsseitiger Nutzung von VERA-Arbeiten zur evidenzbasierten Entwicklung des Lehrkräftehandelns. https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/27915.
Thillmann, K., Bach, A., Wurster, S. & Thiel, F. (2015). School-based staff development in two federal states in Germany. International Journal of Educational Management, 29(6), 714–734. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2014-0094
Tondorf, K., Bahnmüller, R. & Klages, H. (2004). Steuerung durch Zielvereinbarungen. Anwendungspraxis, Probleme, Gestaltungsüberlegungen [eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung] (Modernisierung des öffentlichen Sektors Sonderband, Bd. 17, 2., unveränd. Aufl.). Berlin: Ed. Sigma.
Vogel, D. (2019). Personalbeurteilung und leistungsorientierte Bezahlung. In S. Veit, C. Reichard & G. Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform (5., vollständig überarbeitete Auflage 2019, S. 407–417). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Winkler, C. (2013). Entwicklungsgespräche und Anreizsysteme für schwedische Lehrkräfte. Instrumente des schulischen Personalmanagements vor dem Hintergrund des neuen Steuerungsmodells (Springer eBook Collection). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19576-6
Verzeichnis der Rechtsquellen der Länder
Bw VwV Beratungsgespräch und dienstliche Beurteilung. Beratungsgespräch und dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 21.07.2000 i.d.F. vom 10.08.2009 (K.u.U. 2009, S. 200).
Bw VwV Fortbildung und Personalentwicklung. Leitlinien zur Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Baden-Württemberg vom 24.05.2006 i.d.F. vom 11.11.2009 (K. u. U. 2006, 244).
Bw SchG. Schulgesetz für Baden-Württemberg vom 01.08.1983 i.d.F. vom 19.03.2020 (GBl. 1983, 397, K.u.U. 1983, 584, S. 53).
Bw EvaluationsVO. Verordnung des Kultusministeriums über die Evaluation von Schulen vom 10.06.2008 i.d.F. vom 19.02.2019 (GBl. 2008, 206).
Bw VwV Anrechnungsstunden und Freistellungen. Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums Anrechnungsstunden und Freistellungen für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 06.06.2014.
Bay Bkm. Anrechnungsstunden Lehrkräfte. Anrechnungsstunden und Stundenermäßigungen für Lehrkräfte sowie Unterrichtspflichtzeit der tarifbeschäftigten Lehrkräfte an staatlichen Gymnasien. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 27.06.3019 (BayMBl. Nr. 252).
BayVwVBes. Bayerische Verwaltungsvorschriften zum Besoldungsrecht und Nebengebieten. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22.12.2010 (FMBl. 2011 S. 9, StAnz. 2011 Nr. 2).
BayBesG. Bayerisches Besoldungsgesetz vom 05.08.2010 i.d.F. vom 09.04.2021 (GVBl. S. 410, 764).
BayEUG. Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 31.05.2000 i.d.F. vom 24.07.2020 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K).
Bay LDO. Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bayern vom 05.07.2014 i.d.F. vom 12.2019 (KWMBl. S. 112; BayMBl. Nr. 331).
Bay Bkm. Mitarbeitergespräch. Durchführung des Mitarbeitergesprächs an den staatlichen Schulen-Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 16.05.2014 (KWMBl. 2014 S. 109).
Bay Richtlinien dienstliche Beurteilung. Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in Bayern vom 07.09.2011 i.d.F. vom 15.07.2015 (KWMBl. S. 306).
Bay Bkm. Leitungszeit. Unterrichtspflichtzeit, Stundenermäßigungen und Anrechnungsstunden der Lehrkräfte an staatlichen Realschulen. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 17.04.2019 (BayMBl. 2019 Nr. 141).
Bln SchG. Schulgesetz für das Land Berlin vom 26.01.2004 i.d.F. vom 11.06.2020 (GVBl. 2004, 26, S. 255).
Bln BLVO. Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten der Laufbahnfachrichtung Bildung vom 18.12.2012 i.d.F. vom 18.12.2018 (GVBl. 2012, 546).
Bln Zumessungsrichtlinie 2019/20. Verwaltungsvorschriften für die Zumessung von Lehrkräften an öffentlichen Berliner Schulen ab Schuljahr 2019/20 vom 18.11.2019 (Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 11/2019).
Bln VV Zuordnung. Verwaltungsvorschriften über die einheitliche Gestaltung und Zuordnung von Aufgabenbereichen an öffentlichen Schulen des Landes Berlin vom 11.02.2020 (SenBJW - II C4.1).
BbgSchulG. Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg vom 02.08.2002 i.d.F. vom 18.12.2018 (GVBl. I Nr. 35, 78).
Bbg VV Anrechnungsstunden. Verwaltungsvorschriften über Anrechnungsstunden für Lehrkräfte vom 30.05.2008 i.d.F. vom 18.01.2017 (Abl. MBJS/17, [Nr. 3], S.24).
Bbg VVLEG-L. Verwaltungsvorschriften über die Führung eines Leistungs- und Entwicklungsgespräches mit Lehrkräften an öffentlichen Schulen vom 24.06.2016.
BremSchulG. Bremisches Schulgesetz vom 28.06.2005 i.d.F. vom 26.06.2018 (Brem.GBl. S. 304).
Brem DV PE-Gespräche. Dienstvereinbarung über Personalentwicklungsgespräche an den Schulen der Stadtgemeinde Bremen nach § 19 Absatz 3 der Lehrerdienstordnung vom 31.03.08.
Brem LDO. Verordnung über die Aufgaben der Lehrkräfte und Lehrer in besonderer Funktion an öffentlichen Schulen vom 05.08.2005 i.d.F. vom 04.02.2015.
Brem VO Anrechnungsstunden Leitung. Verordnung über die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung sowie über die Zuweisung und Verteilung von Leitungszeit für Aufgaben in der Schule vom 21.06.1982 i.d.F. vom 02.08.2016 (Brem.GBl. S. 434).
Hmb DA Lehrerinnen und Lehrer. Dienstanweisung für Lehrerinnen und Lehrer vom 05.03.2010 (MBlSchul Nr. 07).
HmbSG. Hamburgisches Schulgesetz vom 16.04.1997 i.d.F. vom 31.08.2018 (HmbGVBl. 1997, S. 97, HmbGVBl. S. 280).
Hmb BeurtRL-Lehrkräfte. Richtlinie über die Beurteilung der Lehrkräfte und des Schulleitungspersonals an staatlichen Schulen vom 04.12.2013.
Hmb LehrArbzVO. Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen vom 01.07.2003 i.d.F. vom 15.02.2011 (HmbGVBl. 2003, S. 197, HmbGVBl. S. 79).
Hess LDO. Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 04.11.2011 i.d.F. vom 09.11.2016 (ABl. S. 870).
Hess Grds Zusammenarbeit und Führung LVW. Grundsätze über Zusammenarbeit und Führung in der hessischen Landesverwaltung. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 08.06.2018 (StAnz. 28/2018 S. 850).
LehrBiG HE 2011. Hessisches Lehrerbildungsgesetz vom 28.09.2011 i.d.F. vom 05.02.2016 (GVBl. I 2011 590).
SchulG HE 2017. Hessisches Schulgesetz vom 01.08.2017 i.d.F. vom 28.06.2020 (GVBl. 2017, 150).
Hess PflStVO. Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte vom 19.05.2017 (ABl. 2017, 191).
Mv LehrArbzLVO M-V. Landesverordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an staatlichen Schulen vom 16.03.2016 i.d.F. vom 29.06.2021 (GVOBl. M-V 2016, 77, ber. S. 515).
Mv LehbildG M-V. Lehrerbildungsgesetz vom 25.11.2015 i.d.F. vom 18.06.2020.
Mv SchulG M-V. Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern. vom 10.09.2010 i.d.F. vom 02.12.2019 (GVOBl. M-V S. 172).
Mv BildDLaufbVO M-V. Verordnung über die Laufbahnen der Fachrichtung Bildungsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern vom 21.01.2014 i.d.F. vom 18.06.2020.
Mv UntVersVO M-V. Verordnung über die Unterrichtsversorgung für die Schuljahre 2020/2021 bis 2024/2025 vom 07.07.2020 (Mittl.bl. BM M-V 2020, 191, GVOBl. M-V 2020, 792).
Nds NLVO. Niedersächsische Laufbahnverordnung vom 30.03.2009 i.d.F. vom 05.05.2020 (Nds. GVBl. S. 66).
NSchG. Niedersächsisches Schulgesetz vom 03.03.1998 i.d.F. vom 07.11.2019 (Nds. GVBl. S. 66).
Nds ArbZVO-Schule. Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen vom 14.03.2012 i.d.F. vom 29.06.2020 (Nds. GVBl. 2012, 106).
Nrw ADO. Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen vom 18.06.2012 i.d.F. vom 30.11.2014 (ABl. NRW. S. 32, 384).
Nrw LPZVO. Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen vom 10.03.1998 i.d.F. vom 29.06.2021 (BGBl. I S. 1065).
Nrw VO zu § 93 Abs. 2 SchulG mit AVO-RL. Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) mit Verwaltungsvorschriften zur Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (AVO-Richtlinien 2021/2022 - AVO-RL) vom 18.04.2005 ) (GV. NRW. S. 218; BASS 11–11 Nr. 1).
Rp DO-Schulen. Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (DO-Schulen) Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 22.06.2019 (GAmtsbl. 2019, S. 151).
Rp LehrArbZVO. Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung vom 30.06.1999 i.d.F. vom 05.02.2021 (GVBl. 1999, 148).
Saarl ADOL. Allgemeine Dienstordnung für Lehrer vom 10.11.1975a (GMBl. 1975a, S. 896, GMBl. 1978, S. 605).
Saarl ADOS. Allgemeine Dienstordnung für Schulleiter vom 16.02.1975b (GMBl. 1975b, S. 210).
Saarl VwV dB LuL. Richtlinien für die dienstliche Beurteilung von Lehrern und Lehrerinnen im Schuldienst des Saarlandes vom 15.10.1987 i.d.F. vom 28.11.1991 (Amtsblatt 1987 S. 1167).
Saarl SchumG. Schulmitbestimmungsgesetz vom 27.03.1974 i.d.F. vom 11.12.2012 (Amtsbl. S 687).
Saarl PflichtstundenVO. Verordnung über die Festlegung der Zahl der Unterrichtsstunden der beamteten Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen vom 21.07.1987 i.d.F. vom 22.09.1998 (Amtsblatt 1999, 2).
Sächs LPVO. Leistungsprämienverordnung vom 27.10.1998; geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 10.05.2007 (SächsGVBl. S. 149) (SächsGVBl. S. 597).
SächsSchulG. Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in der Neufassung des Sächsischen Schulgesetzes vom 27.09.2018.
SächsLKAZVO. Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Arbeitszeit der beamteten Lehrkräfte vom 07.07.2017 (SächsGVBl.S. 242).
Sächs VwV Behörden - Dienstordnung. Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur Regelung des Dienstbetriebes für die Behörden des Freistaates Sachsen (Dienstordnung) vom 28.06.2018 i.d.F vom 17.12.2019 (Dienstordnung).
SchulG LSA. Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 09.08.2018 (GVBl. LSA 2018, 244, 245).
St RdErl. Stärkung SL. Stärkung der Stellung der Schulleiterinnen und Schulleiter. RdErl. des MK vom 03.03.2010 (SVBl. LSA 2010, 67).
St ArbZVO-Lehr. Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 19.12.2019 (GVBl. LSA S. 102, 120).
Sh Leitungszeiterlass. Bemessung des schulischen Zeitbudgets für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben sowie für die pädagogische Arbeit und für Schulentwicklung. Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 31.08.2010 (NBl. MBK. Schl.-H. 2010 Seite 277).
Sh Lehrerdienstordnung. Dienstordnung für Lehrer und Lehrerinnen an allen öffentlichen Schulen im Lande Schleswig-Holstein Erlass des Kultusministers vom 17.02.1950 i.d.F. vom 18.06.1998 (NBI. Schl.-H Schulw. S. 31; zuletzt geändert durch Erlass vom 18. Juni 1998 (NBI. MBWFK. Schl.-H. S. 234)).
Sh LPVO. Hinweise zur Landesverordnung über die Gewährung von Prämien für besondere Leistungen. Runderlass des Ministeriums für Finanzen und Energie vom 23.03.2000 (Amtsbl. Schl.-H. 2000 S. 264).
Sh SchulG. Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz vom 24.01.2007 i.d.F. vom 01.07.2020 (GVOBl. 2007, 39, ber. S. 276).
Th LDO. Dienstordnung für Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogische Fachkräfte an den staatlichen Schulen in Thüringen vom 30.11.2011 (GABl. 1993, 235, GABl. 2001, 326).
ThürBesG. Thüringer Besoldungsgesetz vom 18.01.2016 i.d.F. vom 21.12.2020 (GVBl. 2016, 1, 166, 202).
ThürLbG. Thüringer Lehrerbildungsgesetz vom 12.03.2008 i.d.F. v. 02.07.2019 (GVBl. 2008, 45; GVBl. S. 210, 235).
ThürSchulG. Thüringer Schulgesetz vom 30.04.2003 i.d.F. vom 02.07.2019 (GVBl. S. 210, 228).
Th VVOrgS 2021. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) zur Organisation des Schuljahres 2020/2021 vom 28.02.2020 (ABl.TMBJS 3/2020).
Bundesgesetze
BBesG. Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 73 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist.
Hinw BLBV. Durchführungshinweise zur Bundesleistungsbesoldungsverordnung vom 23. Juli 2009 (BGBl. I S. 2170) zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Verordnungen aus Anlass des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes zur Fussnote [1] Vom 11. Oktober 2021 vom 11.10.2021 (GMBl S. 1298).
BeamtStG. Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz) vom 17.06.2008 (zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.06.2021) (BGBl. I S. 1010, BGBl. I S. 2250).
BLBV. Verordnung des Bundes über leistungsbezogene Besoldungsinstrumente (Bundesleistungsbesoldungsverordnung - BLBV).
BLBV. Verordnung des Bundes über leistungsbezogene Besoldungsinstrumente (Bundesleistungsbesoldungsverordnung) zur Fussnote [1] vom 23.07.2009b (BGBL I Seite 2170).
Parlamentarische Anfragen, Urteile etc.
Bay Drucksache 16/6904. Bayerischer Landtag 16. Wahlperiode. Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Horst Arnold SPD vom 02.11.2010 Leistungszulagen im Lehrerinnenund Lehrerbereich vom 11.02.2011 (Drucksache 16/6904).
Mv Drucksache 6/1668. Landtag Mecklenburg-Vorpommern 6. Wahlperiode. Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Berger, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Arbeitsbelastung von Schulleiterinnen und Schulleitern - und Antwort der Landesregierung vom 06.05.2013 (Drucksache 6/1668).
Bw Drucksache 12/5787. Landtag von Baden-Württemberg 12. Wahlperiode. Anfrage des Abg. Norbert Zeller SPD und Antwort des Finanzministeriums: Leistungsstufen und Leistungsprämien vom 04.12.2000.
Nds Drucksache 17/8442. Niedersächsischer Landtag 17. Wahlperiode. Anfrage des Abgeordneten Grant Hendrik Tonne (SPD) an die Landesregierung, eingegangen am 06.07.2017, an die Staatskanzlei übersandt am 13.07.2017 und Antwort des Niedersächsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung vom 17.08.2017. Sind Entlastungsstunden verzichtbar?
Konzeptionelle Dokumente
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.). (2009). Mitarbeitergespräch. Personalentwicklung, Zusammenarbeit, Förderung, Führung. Verfügbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Fuehrungskraefte/Material/Downloads/Personalentwicklung/mitarbeitergespraech.html
Sächsisches Staatsministerium für Kultus (Hrsg.).. Personalentwicklungskonzept für den Verwaltungsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (SMK).
Sächsisches Staatsministerium für Kultus. (2018). Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“.
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg Personalamt (Hrsg.). (2003). Mitarbeiterinnen-/ Mitarbeiter- Vorgesetzten- Gespräch.
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. (2013). Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin. Qualitätsbereiche und Qualitätsmerkmale. Berlin: Berlin.
Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin (Hrsg.). (2011). Landesweite Leitlinien für Personalentwicklung.
Staatskanzlei des Saarlandes. (2016). Personalmanagementkonzept der Saarländischen Landesverwaltung. Saarbrücken.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Thiel, F., Schewe, C.M. (2022). Instrumente individualisierter Personalentwicklung: Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen und Anreizsysteme. In: Thiel, F., Schewe, C.M., Muslic, B., Lankes, EM., Maritzen, N., Riecke-Baulecke, T. (eds) Personalentwicklung in Schulen als Führungsaufgabe. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36925-5_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36925-5_7
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-36924-8
Online ISBN: 978-3-658-36925-5
eBook Packages: Education and Social Work (German Language)