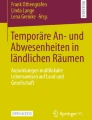Zusammenfassung
Das Kapitel fokussiert erstens die Bleibeorientierung von Geflüchteten in ländlichen Wohnorten. Dafür werden sowohl statistische Daten aus dem Ausländerzentralregister (AZR) als auch narrative Interviews analysiert. Neben der Frage, wie viele bleiben und wer bleibt, werden auch strukturelle Rahmenbedingungen und individuelle Konstellationen, die das Bleiben wahrscheinlicher machen, thematisiert. Zweitens diskutiert das Kapitel, wie Bleiben mit Einstellungen der Lokalbevölkerung zusammenhängt und drittens inwiefern Haltestrategien von der Lokalpolitik artikuliert werden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
1 Einleitung
Ob und unter welchen Umständen Geflüchtete in ländlichen Wohnorten wohnen (bleiben), ist in der Forschung bislang wenig betrachtet worden (Weidinger et al. 2017). Erkenntnisse darüber sind aber sowohl für die Ausgestaltung der Integrationsarbeit vor Ort als auch die Bewertung des Potenzials von Neuzugewanderten, Impulse für ländliche Entwicklung zu geben, hochrelevant. Deshalb geht dieses Kapitel der Frage der Bleibeorientierung von Geflüchteten nach. Wer sind diejenigen, die unter bestimmten strukturellen Voraussetzungen und individuellen Konstellationen (nicht) bleiben wollen und welche Gründe für das Bleiben lassen sich identifizieren? Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern Einstellungen der Aufnahmegesellschaft für das Bleiben relevant sind und ob, und wenn ja, wie eine Bleibeorientierung durch Akteur*innen vor Ort gefördert werden kann. Solche Haltestrategien werden adressiert, indem Orientierungen und Aktivitäten hinsichtlich der Beeinflussung von Entscheidungen über das Weiterwandern von Geflüchteten identifiziert werden.
2 Konzeptioneller Rahmen: Bleiben und Gehen
Geflüchtete stellen sich häufiger die Frage, an einem Ort wohnen zu bleiben oder umzuziehen, vor allem dann, wenn sich Lebensumstände verändern oder sie wahrnehmen, dass sie bestimmte Ziele an einem anderen Ort besser erreichen können. Bleiben oder Gehen wird also immer wieder neu ausgehandelt. Eine Wohnstandortverlagerung wird dann vorgenommen, wenn das Individuum diese als subjektiv sinnvoll erachtet, sie also mit einer Nutzensteigerung für das Individuum oder die Familie einhergeht (Weichhart 2009). Das Individuum bewertet strukturelle Faktoren, also Rahmenbedingungen, die in den räumlichen Charakteristika eines Wohnortes begründet sind, in Bezug auf die aktuellen und angestrebten Lebensumstände. Zudem werden individuelle Konstellationen und ortsbezogene Charakteristika mit in den Entscheidungsprozess einbezogen.Footnote 1
2.1 Rahmenbedingungen an Wohnorten
Rahmenbedingungen an Wohnorten, die im Aushandlungsprozess zwischen Bleiben und Weiterwandern herangezogen werden, umfassen zunächst räumliche Charakteristika von Orten. In theoretisch-konzeptionellen Ausführungen zu Multilokalität begreift Weichhart (2009) solche Strukturen als Standortofferten, also Attribute von Orten, die dazu geeignet sind, bestimmte Nutzungsansprüche zu befriedigen. Die Kombination solcher Standortofferten wird vom Individuum bezüglich der Handlungen der alltäglichen Lebenspraxis bewertet. Ein Ort – und der dazugehörige Aktionsraum – muss also Bedürfnisse von Menschen befriedigen und zur Erreichung von Zielen beitragen. Dabei sind passende Ressourcen für bevorzugte Aktivitäten, die ein Ort bereitstellt, maßgeblich (place dependence, Scannell und Gifford 2014). Zu den Attributen und Fähigkeiten eines Ortes können beispielsweise Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten für sich und die Familie, öffentliche Infrastrukturangebote und Sozialleistungen zählen. Natürliche und kulturelle Annehmlichkeiten bzw. soziale Netzwerke und die Migrationsgeschichte eines Ortes bzw. einer Region können ebenfalls solche Attribute und Fähigkeiten darstellen.
2.2 Individuelle Faktoren
Stimmen subjektiv bedeutsame Nutzungsansprüche nicht mit der Kombination an Standortofferten überein, muss das Individuum ggf. den Wohnstandort wechseln. Neben funktionalen Charakteristika von Orten sind affektive, also emotionale Bindungen an Orte, für das Bleiben oder Weiterwandern entscheidend. Diese werden mit den Begriffen place-based-belonging – verstanden als persönliches Gefühl des Zuhause-Seins an einem Ort (Yuval-Davis 2006) – oder place attachment konzeptionalisiert. Letzteres umfasst emotionale Bindungen, die Personen zu ihrem Wohnort entwickeln (Lewicka 2010), und wird als Prozess verstanden, bei dem die Anwesenheit an einem Ort (exposition) sowie zunehmende Vertrautheit zur Steigerung von Bindungen beiträgt. Bindungen werden zudem stärker, wenn Personen Bedeutungen an Orte zuschreiben oder biographische Ereignisse dort erfahren (Lewicka 2011). Place dependence und auch place attachment dürfen jedoch nicht allein auf einen Ort oder eine Gemeinde bezogen werden, sondern müssen auch Aktionsräume von Individuen berücksichtigen (s. Kap. 8).
Wie in der Migrationsforschung bereits ausführlich diskutiert, kann die Position im Lebensverlauf (life course) die Entscheidung für Bleiben oder Weiterwandern beeinflussen. Vor dem Beginn bestimmter, neuer Lebensabschnitte, z. B. vor der Aufnahme eines Studiums, der Gründung einer Familie, dem Ende einer Beziehung oder dem Eintritt in den Ruhestand, ist ein Wechsel des Wohnstandortes wahrscheinlicher als in Phasen der Konsolidierung (Ní Laoire 2008; Wingens et al. 2011).
2.3 Aushandlung von Bleiben und Gehen
Der Aushandlungsprozess von Bleiben und Gehen findet über einen längeren Zeitraum statt und umfasst die Reflexion über die Absicht, Möglichkeit und ggf. die Verwirklichung dieser (motility, Kaufmann 2002). Das „Aspiration-Ability-Modell“Footnote 2 nach Carling (2002) beschreibt diesen Prozess mit Bestrebungen und Wünschen des Individuums und ggf. dessen Familie einerseits und der Fähigkeit der Realisierung andererseits. Die Entscheidung ist dabei nicht ausschließlich und stets rational begründet, sondern umfasst auch vermeintlich irrationale ad-hoc-Argumentationen.
Das von Carling entwickelte Modell sieht Wohnstandortverlagerungen als Ergebnis eines zweistufigen Prozesses. Im ersten Schritt wird beurteilt, ob der Wohnstandort verlagert werden soll oder ob eine Beibehaltung bevorzugt wird (aspiration). Im zweiten Schritt wird dann geprüft, ob die Entscheidung umsetzbar ist oder nicht (ability). In Anlehnung an das Aspiration-Ability-Modell von Carling (2002) wird das Bleiben (staying) ebenfalls als Ergebnis eines zweistufigen Prozesses gesehen. Dabei wird zunächst beurteilt, ob eine Beibehaltung des Wohnstandorts gewollt ist oder eine Wohnstandortverlagerung bevorzugt wird. Danach wird bewertet, ob die Entscheidung des Bleibens umsetzbar ist oder nicht, da eine Wohnstandortverlagerung mit Transaktionskosten verbunden wäre oder – im Fall von Geflüchteten – z. B. rechtlich eingeschränkt ist. Sowohl Bestrebung (aspiration) als auch Fähigkeit (ability) zum Bleiben sind vom Zusammenspiel aus individuellen (individual level characteristics) und strukturellen Kontexten (staying environment, emigration interface) bestimmt (Carling und Schewel 2018, s. Abb. 6.1). Als staying environment verstehen wir den sozialen, ökonomischen und politischen Kontext, in welchem Bleiben sozial konstruiert wird, während emigration interface Migrationspolitiken und Regulierungen umfasst, die mögliche Bleibemodi aufgrund festgelegter Voraussetzungen vordefiniert (Stichwort: Wohnsitzauflage).
Das „Aspiration-Ability-Bleibemodell“. (Quelle: Modifiziert nach Carling und Schewel 2018, S. 946)
In Anlehnung an die Typologie von Mata Codesal (2018) zu Formen der „Immobilität“ unterscheiden wir zwei unterschiedliche Typen von „Bleiben“. Diese verstehen wir als Zusammenspiel von Aspiration und Ability.
-
Diejenigen, die bleiben wollen und bleiben können, sind stayers (s. desired immobility/aquiescent immobility)
-
Diejenigen, die gehen wollen, aber bleiben müssen, sind in-voluntary stayers (s. involuntary immobility)
Bei der Diskussion zur Bleibeorientierung nicht relevant sind diejenigen, die bleiben wollen, aber nicht bleiben können (involuntary migrants), und Personen, die gehen wollen und gehen können (voluntary migrants).
3 Leitfragen und analytischer Zugang
Von Interesse ist zunächst, besser zu verstehen, welche Konstellationen die Bleibeorientierung Geflüchteter anzeigen. Das heißt, „Wer sind diejenigen, die unter bestimmten individuellen und strukturellen Voraussetzungen bleiben wollen?“ und was sind die Gründe für das Bleiben?
- Leitfrage 1::
-
Wie viele bleiben und wer bleibt?
- Leitfrage 2::
-
Warum bleiben Geflüchtete in ländlichen Regionen? Welche Rolle spielen ortsbezogene Charakteristika und individuelle Konstellationen?
Das Bleibe- bzw. Abwanderungsverhalten der Geflüchteten aus den Untersuchungslandkreisen wird zunächst auf der Grundlage von Daten des Ausländerzentralregisters (AZR) untersucht. Fokussiert wird die Gruppe der Geflüchteten mit befristet anerkanntem Schutzstatus im Zeitraum Januar 2012 bis März 2021. Der Analyse zugrunde liegen des Weiteren qualitative Daten aus Interviews mit Geflüchteten sowie Protokolle der Fokusgruppen.Footnote 3 Die Wohnbiographien der Geflüchteten geben Hinweise auf Wohnstandortmobilitäten in der Vergangenheit, die Frage nach der Bleibeabsicht und den Gründen dafür verweisen auf die Zukunft. In der Analyse wurden positive, neutrale und negative Aspekte ländlicher Regionen als Gründe für das Bleiben oder Weiterwandern identifiziert.
- Leitfrage 3::
-
Welche Rolle spielt die Einstellung der Aufnahmegesellschaft für das Bleiben?
Gesellschaftliche Strukturen, lokale Akteur*innen und die Einstellung der Residenzbevölkerung können für Bleibe- oder Weiterwanderungsentscheidungen der Geflüchteten eine wichtige Rolle spielen. Abgeleitet aus dem Modell zur lokalen Rezeptivität (s. Kap. 5) wird die Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft untersucht, soziale und gesellschaftliche Ressourcen einzusetzen, um einen Verbleib von Geflüchteten vor Ort zu unterstützen.
Der Analyse liegen Daten aus der quantitativen Bevölkerungsbefragung zugrunde, insbesondere die Frage, ob der betreffende Ort vorteilhafter Wohnort für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist. Dies kann einen Hinweis darauf liefern, ob ein Bleiben der Geflüchteten erwünscht ist. Vertiefend analysiert wurde diese Frage mit Daten aus qualitativen Interviews mit Akteur*innen der Zivilgesellschaft. Darüber hinaus wurde der Frage nachgegangen, ob das Bleiben der Geflüchteten aus der Expertenperspektive seitens zivilgesellschaftlicher Akteur*innen antizipiert wird bzw. ob ein Halten für machbar gehalten wird. In der Analyse dieser Items wurde vor allem die Verflechtung mit lokalen Gegebenheiten (z. B. ökonomische und infrastrukturelle Gegebenheiten und lokale Migrations-/Integrationserfahrungen) und entsprechenden Diskursen berücksichtigt.
- Leitfrage 4::
-
Welche Haltestrategien zeichnen sich ab?
Zunächst wurden Orientierungen und Aktivitäten hinsichtlich der Beeinflussung der Migrationsentscheidung Geflüchteter herausgearbeitet, um aktive Haltepolitiken zu identifizieren. In einem zweiten Schritt wurde nach Übereinstimmungen und mismatches zwischen Bleibefaktoren gesucht, die einerseits von Geflüchteten benannt wurden und andererseits von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft wahrgenommen werden. Zugrunde liegen codiertes Interviewmaterial sowie einschlägige Dokumente.
4 Ergebnisse
4.1 Bleibeverhalten von Geflüchteten
Den Verbleib von Geflüchteten in ländlichen Regionen analysieren wir zunächst retrospektiv anhand von Daten des Ausländerzentralregisters. Anschließend diskutieren wir die Perspektive der Geflüchteten und stellen Ergebnisse aus den Wohnbiographien vor.
4.1.1 Analyse des Bleibeverhaltens auf der Grundlage von Daten des Ausländerzentralregisters
Mit dem AZR führt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Registerbehörde eine zentrale Datenbank, in die seitens der kommunalen Ausländerbehörden Informationen zu Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit eingepflegt werden.Footnote 4 Gespeichert werden Daten von Ausländer*innen, die für mindestens drei Monate in Deutschland leben bzw. gelebt haben. Das Forschungsdatenzentrum des BAMF ermöglichte dem Thünen-Institut einen projektbezogenen Datenzugriff auf das AZR. Untersucht wurden Geflüchtete mit befristetem, anerkanntem Schutzstatus.Footnote 5 Diese Auswahl orientiert sich an der Zusammensetzung der narrativen Interviews mit Geflüchteten (s. Kap. 3).
Die Daten aus dem AZR wurden in zwei Datensätzen – einem Basisdatensatz und einem Mobilitätsdatensatz – übergeben und enthalten 926.473 Beobachtungen und 21 Variablen (Basisdatensatz) bzw. 3.043.255 Beobachtungen und 19 Variablen (Mobilitätsdatensatz). Beide Datensätze wurden in Rücksprache mit dem BAMF geprüft und bereinigt, da die Datenqualität des AZR nicht selten als problematisch eingestuft wird (s. Erfahrungen von Kühn und Heimann 2021). Bei der Überprüfung der Datensätze wurden u. a. Doppeleinträge, Geburtseinträge als Meldedatum, Fehlzuweisungen, unplausible Werte (z. B. Hundertjährige) und ähnliches reduziert. Danach wurden die Datensätze verknüpft und als Auswertungsdatensatz aufbereitet.
Die über das BAMF bereitgestellten Daten sind nur auf Ebene der Ausländerbehörden verfügbar, d. h., eine Auswertung innerhalb des Zuständigkeitsbereiches einer Ausländerbehörde, wie beispielsweise eine Differenzierung nach Gemeinden, ist nicht möglich. Im Falle der acht untersuchten Landkreise sind die Zuständigkeitsbereiche der Ausländerbehörden deckungsgleich mit den Untersuchungslandkreisen.
Gebliebene
Als Gebliebene werden Personen betrachtet, die am 31.03.2021 im jeweiligen Untersuchungslandkreis gemeldet sind und ihren Aufenthalt dort für länger als 90 Tage hatten. Dieser Gruppe gegenübergestellt werden Geflüchtete, die nicht mehr im Landkreis gemeldet sind, dies aber im Zeitraum vom 01.01.2012 bis zum 30.03.2021 für mindestens 90 Tage waren.
Gebliebenenquote insgesamt
Die Ergebnisse im linken Teil der Tab. 6.1Footnote 6 verdeutlichen, dass in den Untersuchungslandkreisen in Bayern, Hessen und Niedersachsen – mit Ausnahme des Landkreises Regen – jeweils noch ca. zwei Drittel der Geflüchteten mit Aufenthaltstitel, die zwischen 2012 und 2021 im Landkreis für länger als 90 Tage gemeldeten waren, am 31.03.2021 dort weiterhin gemeldet sind. Am höchsten ist der Anteil dieser Gebliebenen mit rund 77 % im Landkreis Vechta, gefolgt vom Landkreis Waldeck-Frankenberg mit 69 %. Beide Landkreise haben auch bezogen auf 1000 Einwohner*innen mit 22,1 bzw. 17,8 den höchsten Anteil an Gebliebenen mit anerkanntem Schutzstatus aller Landkreise. In den sächsischen Landkreisen liegt der Anteil der Gebliebenen hingegen deutlich niedriger (ca. 39 % im Landkreis Nordsachsen, Landkreis Bautzen ca. 29 %). In ihren jeweiligen Bundesländern zählen die Untersuchungslandkreise überwiegend zu den Landkreisen mit einem leicht bis deutlich überdurchschnittlichen Anteil an Gebliebenen (s. rechter Teil der Tab. 6.1). Nur in den Landkreisen Bautzen und Northeim entspricht der Anteil der Gebliebenen exakt dem jeweiligen Durchschnitt ihres Bundeslandes.
Ein möglicher Faktor für Unterschiede zwischen den Landkreisen könnte die unterschiedliche sozioökonomische Lage der Landkreise sein.Footnote 7 So hat Vechta als der Landkreis mit der günstigsten sozioökonomischen Ausgangssituation aller Untersuchungslandkreise auch die höchste Gebliebenenquote, dieser Zusammenhang gilt umgekehrt für die beiden sächsischen Landkreise und trifft auch für die westdeutschen Landkreise im bundeslandinternen Vergleich zu. Das gilt jedoch nicht im Vergleich der beiden sächsischen Landkreise untereinander sowie im Vergleich des Landkreises Northeim und dem Werra-Meißner-Kreis mit dem Landkreis Regen. Möglicherweise könnte hier der Faktor Ländlichkeit, d. h. die größere Zentrenferne der Landkreises Bautzen und Regen, von Bedeutung sein.
Neben sozioökonomischer Lage und Ländlichkeit könnte auch die 2016 in Kraft getretene Wohnsitzregelung Einfluss auf die Gebliebenenquote haben.Footnote 8 Die Untersuchungslandkreise Northeim und Vechta sowie die niedersächsischen Landkreise insgesamt weisen im Vergleich mit den anderen Bundesländern einen hohen Anteil von Gebliebenen aus. Dabei besteht in Niedersachsen – im Gegensatz zu den anderen drei Bundesländern – „nur“ eine negative Wohnsitzauflage, die lediglich den Zuzug in bestimmte Großstädte erschwert, die Wohnstandortentscheidung ansonsten aber innerhalb des Bundeslandes nicht weiter begrenzt. Die übermittelten Datensätze des AZR enthalten jedoch keine individuellen Informationen zum Merkmal Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG und lassen eine entsprechende Auswertung nicht zu.
Gebliebene nach Alter
Die in Tab. 6.2Footnote 9 dargestellte Differenzierung der Anwesenheit nach Altersgruppen macht Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Bleibe- und Abwanderungsverhalten zwischen verschiedenen Altersgruppen und zwischen den Untersuchungslandkreisen deutlich. Zur Strukturierung der Ergebnisse wurden Altersgruppen – überwiegend in 5-Jahres-Schritten – gebildet.Footnote 10
Die Verteilung der Anwesenheit nach Altersgruppen ist recht homogen, wenn man die Niveauunterschiede der Gebliebenenquoten zwischen den Landkreisen ausblendet. In allen Landkreisen ist unter den Gebliebenen die Gruppe der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren klar überrepräsentiert, die Gruppe der jüngeren Erwachsenen ab 19 bis unter 40 Jahren hingegen unterrepräsentiert. Bei der Gruppe der älteren Erwachsenen über 40 Jahren variiert dagegen die Bleibequote zwischen den Landkreisen. Allerdings ist diese Gruppe deutlich kleiner als die beiden zuvor genannten Gruppen (etwas über 16 % im Vergleich zu jeweils etwas über 40 % aller Gebliebenen).
Ein Grund für dieses Verteilungsmuster könnte sein, dass möglicherweise Familien mit Kindern unter den Gebliebenen überrepräsentiert sind und jüngere Erwachsene ohne Kinder unterrepräsentiert. Das Bleiben der Erwachsenen wäre dann davon abhängig, ob sie zu Familien mit Kindern gehören oder nicht. Allerdings ist in dem AZR-Datensatz auch dieses Merkmal nicht hinterlegt, sodass diese Annahme mit den vorliegenden Daten nicht überprüft werden kann.
Gebliebene nach Herkunftsländern
Geflüchtete mit dem Herkunftsland Syrien bilden in allen Landkreisen die größte Gruppe der Gebliebenen. In den sächsischen Landkreisen ist allerdings der Abstand zur Gruppe der Afghan*innen und der Gruppe mit den sonstigen Nationalitäten deutlich geringer als in den westdeutschen Landkreisen – mit Ausnahme des Werra-Meißner-Kreises. In den Landkreisen Vechta (71 %) und Regen (85 %) haben Syrer*innen einen besonders hohen Anteil unter allen Gebliebenen mit Aufenthaltsstatus, in den sächsischen Landkreisen einen vergleichsweise niedrigen.Footnote 11 Geflüchtete mit afghanischer Herkunft sind in allen Landkreisen im Verhältnis zur jeweiligen Gebliebenenquote im Landkreis häufiger noch anwesend, allerdings haben sie nur in den sächsischen Landkreisen einen Anteil von über 20 %. Dagegen stimmen die Gebliebenenquoten der Geflüchteten mit syrischer Nationalität in allen westdeutschen Untersuchungslandkreisen mit der jeweiligen durchschnittlichen Gebliebenenquote überein, was, im Bezug zum Anteil an allen Gebliebenen, auch dem bedeutenden Anteil dieser Gruppe geschuldet ist. In nahezu allen Landkreisen liegen dagegen Personen mit dem Herkunftsland Irak unterhalb der jeweiligen durchschnittlichen Gebliebenenquote.
Anteil nach Aufenthaltsstatus
Auch die Differenzierung nach Schutztiteln zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Untersuchungslandkreisen. Über alle Landkreise ist die Gruppe mit Anerkennung der Fluchteigenschaft nach § 3, Abs. 4 AsylG bei den Gebliebenen unterproportional, die Gruppe der Personen mit subsidiärem Schutz dagegen überproportional im Verhältnis zum Durchschnitt vertreten. Besonders ausgeprägt sind beide Phänomene wiederum in den sächsischen Landkreisen. Auch im Landkreis Regen sind gebliebene Geflüchtete mit subsidiärem Schutz deutlich überrepräsentiert.
Fazit
Aus der Analyse der AZR-Daten bleibt festzuhalten: Das Bleibeverhalten Geflüchteter mit befristetem Aufenthaltsstatus variiert erheblich zwischen den Landkreisen, es zeigen sich aber auch Gemeinsamkeiten. Die große Spannbreite beim Anteil Gebliebener zwischen 77 % (Landkreis Vechta) und 28 % (Landkreis Bautzen) steht für die erheblichen Unterschiede zwischen den westdeutschen und den sächsischen Untersuchungslandkreisen. Auch der relativ große Unterschied des Landkreises Regen von den anderen westdeutschen Landkreisen fällt auf. Diese Variationen erscheinen nur teilweise mit Unterschieden in der sozioökonomischen Ausgangssituation konform zu gehen. Übereinstimmungen gibt es dagegen bei der Altersstruktur der Gebliebenen. Es zeigt sich in allen Landkreisen einheitlich eine deutlich höhere Gebliebenenquote bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren und eine deutlich geringere bei jungen Erwachsenen zwischen 19 und 40 Jahren. Ob dies mit einer stärkeren Bleibeorientierung von geflüchteten Familien zusammenhängt, wie häufig in der Literatur beschrieben, kann anhand der AZR-Daten nicht geklärt werden.
4.1.2 Bisheriges Wanderungsverhalten und Bleibeabsicht aus der Perspektive der Geflüchteten
Die befragten, gebliebenen Geflüchtete berichten retrospektiv von ihrem bisherigen Wanderungsverhalten. Insgesamt lassen sich seit der Ankunft in Deutschland im Durchschnitt 3,6 Umzüge feststellen, wobei Geflüchtete im Landkreis Vechta seltener (2,8), und im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim häufiger (4,4) umzogen (s. Tab. 6.3). Auffällig ist, dass Umzüge innerhalb des Landkreises, die in den AZR-Daten nicht abgebildet werden können, in einigen Landkreisen einen hohen Anteil an allen Umzügen aufweisen (z. B. Landkreis Regen 55 %, Werra-Meißner-Kreis 51 %, s. Tab. 6.3). Geflüchtete zogen verstärkt von peripheren Landgemeinden in die infrastrukturell besser ausgestatteten Klein-/Kreisstädte. Zum Zeitpunkt der Befragung hielten sich Geflüchtete im Durchschnitt 40 Monate in Deutschland auf (35 im Landkreis Nordsachsen, 47 im Landkreis Vechta) und verbrachten einen Großteil davon im ländlichen Untersuchungslandkreis (35 Monate, Minimum bei 30 Monaten im Landkreis Bautzen, Maximum bei 45 im Landkreis Vechta) bzw. am heutigen Wohnort (s. Tab. 6.3). Die erkennbare Stabilisierung von Wohnverhältnissen in allen Bundesländern ist darauf zurückzuführen, dass Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte, die als
vorübergehende Unterkunft vorgesehen waren, verlassen werden konnten. Eine private Wohnsitznahme reduziert die Umzugshäufigkeit also. Wie in Tab. 6.3 ersichtlich ist, dauert dies im Durchschnitt ca. 200 Tage, wobei deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern erkennbar sind.
In die Zukunft geblickt, drückten befragte Geflüchtete zu etwa einem Drittel eine Bleibeabsicht im ländlichen Landkreis aus, je ein weiteres Drittel war unentschieden oder wollte den Landkreis eher verlassen. Während in den niedersächsischen Landkreisen Vechta und Northeim die Bleibeabsicht etwas höher lag, wollten in den Landkreisen Regen und sehr deutlich in Bautzen mehr befragte Geflüchtete die Region in der Zukunft verlassen.
4.2 Gründe und Voraussetzungen für Bleiben
Der Verbleib Geflüchteter in ländlichen Regionen wurde in den Interviews und Fokusgruppen mit verschiedenen Faktoren begründet („Ich möchte bleiben, weil …“) bzw. von unterschiedlichen Konstellationen abhängig gemacht („Ich möchte bleiben, wenn …“).
Zentral war dabei für die Teilnehmenden zunächst das Vorhandensein eines guten Arbeitsplatzes bzw. die räumliche Nähe zum Arbeitsort und zu potenziellen Arbeitsmöglichkeiten. Fehlende Arbeitsmöglichkeiten vor Ort und gefühlt mehr und bessere Arbeitsmöglichkeiten in größeren Städten waren hingegen wesentliche Gründe dafür, den Wohnort zu verlassen.
Also so lange ich da arbeite, würde ich den Ort nicht verlassen. Sollte ich dann einen besseren Job finden oder ein Problem in der Arbeit haben, dann würde ich ja einen anderen Job suchen, an einem anderen Ort. Also die Arbeit ist der Hauptgrund, warum man da ist. (Syrer, 40–50 Jahre, B_III_GEF_041)
Also ich fühle mich mit meiner Familie ganz wohl hier, also in KLEINSTADT. Aber das kommt darauf an, wo ich eine Arbeit finde später. Also wenn ich zum Beispiel eine gute Arbeit hier finden kann in KLEINSTADT, dann würde ich gerne hier bleiben. Wenn ich aber zum Beispiel Arbeit in KREISSTADT oder Hamburg oder einer anderen Stadt finde, dann würde ich umziehen. Also im Prinzip je nachdem wo die Arbeit ist. (Syrer, 30–40 Jahre, D_VII_GEF_115)
In wenigen Fällen berichteten Geflüchtete zudem davon, dass die fehlende Akzeptanz potenzieller Arbeitgeber*innen, Geflüchtete einzustellen, ein Wegzugsgrund ist (s. Kap. 8). Geflüchtete, die eine Selbständigkeit anstrebten, führten schließlich das geringe Kundenpotenzial und eine hohe Konkurrenzsituation an.
In Bezug auf Sprache und Bildung stabilisieren insbesondere ein Platz in einem Sprach- und Integrationskurs und, noch wichtiger, ein Platz (für die Kinder) in einer Kinderbetreuungseinrichtung oder der Regelschule die Wohnverhältnisse. Insbesondere Letzteres fördert die Bleibeorientierung. Bildungseinrichtungen müssen für Geflüchtete nicht nur verfügbar, sondern auch in räumlicher Nähe gut erreichbar sein. Das Vorhandensein von weiterführenden Bildungsmöglichkeiten für Geflüchtete oder deren Kindern wird oftmals als Vorbedingung für das Bleiben gesehen. Schließlich führt das Fehlen entsprechender Weiterbildungs- bzw. Sprachkursangebote, gepaart mit der Vorstellung eines besseren Angebots in Ballungsräumen, dazu, dass Geflüchtete dazu tendieren, ländliche Regionen zu verlassen.
Also die Schule für die Kinder, das ist sehr wichtig. Und vielleicht wenn die Kinder auf eine andere, neue Schule gehen müssen (…), würde ich vielleicht denken, dass ich in eine andere Stadt oder ein anderes Dorf umziehen könnte. Es kommt auf die Schule und die Kinder an. (Syrerin, 30–40 Jahre, D_VIII_GEF_134)
Des Weiteren trägt das Eingebundensein in soziale Netzwerke zu einer Bleibeorientierung bei. Positiv wirkt sich dabei etwa der Kontakt Geflüchteter und ihrer Kinder zur Lokalbevölkerung aus (social bridges). Aus Dankbarkeit gegenüber der freundlichen und hilfsbereiten Lokalbevölkerung im Allgemeinen und den Ehrenamtlichen im Besonderen wollen viele vor Ort wohnen bleiben und nicht noch einmal andernorts komplett neu anfangen.
Ich möchte hier wohnen (bleiben). Ich habe viele Leute hier kennengelernt. Und die Frau VORNAME auch und VORNAME auch. Ich möchte dann hierbleiben. Ich möchte nicht in eine große Stadt. Wenn ich in eine große Stadt ziehe, bin ich neu und alleine und das ist nicht schön. Wenn ich hier bin, das ist gut. Ich habe Freunde und das macht mir Spaß. So ist es gut. Ich möchte nicht umziehen in ein anderes Land, eine andere Stadt. Ich möchte hierbleiben. (Syrer, 20–30 Jahre, B_IV_GEF_051)
Geflüchtete stellen auch den Vorteil heraus, dass in den vergangenen Jahren viele andere Personen aus ihren Herkunftsländern zugezogen sind und man im Landkreis leicht Anschluss finden kann (social bonds). Soziale Kontakte und familiäre Bindungen vor Ort werden aber auch als Voraussetzungen des Bleibens gesehen (s. Kap. 8). Geflüchtete reflektieren, dass Familienmitglieder und Verwandte auch andernorts, vor allem in Ballungszentren wohnen und ziehen eine Abwanderung in Erwägung.
IP2: Unsere Verwandten leben in Frankfurt, deswegen wäre es schön, wenn unser Mietvertrag abläuft und mein Sprachkurs auch, dass ich einen Job in Frankfurt finde und wir nach Frankfurt ziehen können.
IP1 [spricht Dari]: Es ist natürlich immer schöner, wenn man dort wohnt, wo auch die Verwandten sind. Wir möchten sehr gerne bei den Sachen, die unsere nähere Verwandtschaft betreffen, wie zum Beispiel Hochzeiten dann dabei sein, aber wenn wir von hier dort(hin) anreisen müssen, dann ist das sehr umständlich und wenn wir dann zurückkommen, sind wir sehr spät erst wieder zuhause. (…)
Interviewerin: Das heißt, wenn Ihre Familie hier wohnen würde, dann könnten Sie auch hier wohnen?
IP1 [spricht Dari]: Wenn die hier wären, dann würde ich gar nicht das Bedürfnis haben, wo anders hinzuziehen, dann würde ich auch einfach hierbleiben. Es gibt sehr vieles, was meine nähere Verwandtschaft betrifft und ich kann einfach nicht da sein, weil ich so weit weg wohne.
(Afghanisches Paar, 30–40 Jahre, C_V_GEF_069)
Daneben können auch Mitarbeitende staatlicher bzw. nicht-staatlicher Institutionen (social links) die Bleibe- bzw. Wegzugsentscheidung beeinflussen, etwa wenn geraten wird, in die Großstadt umzuziehen, um Arbeit zu finden. Ein weiterer Begründungszusammenhang, der in Bezug auf eine mögliche Abwanderung angeführt wird, sind schließlich fehlende Begegnungsmöglichkeiten, verbunden mit einer angenommenen, leichteren Kontaktaufnahme in Städten.
Die Entscheidung, zu bleiben, wird insbesondere von geflüchteten Familien zudem damit begründet, dass es – im Gegensatz zu Städten – auf dem Land ruhig und sicher sei, wodurch man dort Kinder gut großziehen könne. Soziale Kontrolle gewährleistet, dass Kinder etwa alleine auf der Straße spielen können.
KLEINSTADT ist gut für Kinder wegen der Erziehung, ja. KLEINSTADT ist nicht so groß, hier kann ich meine Kinder kontrollieren [lacht]. Ich denke, in der Großstadt kann ich das nicht machen. Ich weiß nicht, was dort passiert. (…) Und hier gibt es viel Kontrolle auch in der Schule. Die Lehrerin ruft an und sagt mir, was in der Schule passiert ist. Wenn mein Kind etwas gemacht hat, ruft sie schnell an und sagt es mir. (Syrerin, 30–40 Jahre, A_I_GEF_012)
Eine wahrgenommene Langeweile vor Ort trägt im Umkehrschluss hingegen dazu bei, dass Geflüchtete in Zukunft eher wegziehen wollen.
Ein weiterer Aspekt, der die Entscheidung, in Zukunft auf dem Land wohnen zu bleiben, positiv beeinflusste, ist der im Vergleich zu Ballungsräumen günstigere Wohnraum und die Unterstützung beim Zugang zu privatem Wohnraum. Gleichzeitig stellt das Vorhandensein einer guten und preiswerten Wohnung (oder eines Hauses), die sich in der Nähe des Arbeitsortes befindet, eine Bedingung für das Bleiben dar. Die fehlende Verfügbarkeit von Wohnungen bzw. Häusern vor Ort kann im Gegensatz dazu einen Grund darstellen, den Wohnort in Zukunft zu wechseln. Dies gilt ebenso für zukünftige Veränderungen, bedingt etwa durch Familiennachzug oder Auszug von Mitbewohner*innen.
In Bezug auf Versorgungs- und Freizeitmöglichkeiten wird das Vorhandensein von wohnortnahen Einkaufsmöglichkeiten (sowohl allgemeiner als auch zielgruppenspezifischer Natur) positiv bewertet und kann ein Grund sein, vor Ort wohnen zu bleiben. Gleichwohl wird ein Umzug in Erwägung gezogen, wenn Einkaufsmöglichkeiten nicht verfügbar sind. Ein (gefühlt) umfassenderes Angebot von Versorgungsorten in größeren Städten kann zu Weiterwanderung führen. Das Fehlen wohnortnaher Freizeitmöglichkeiten (z. B. Kino, Ausgehmöglichkeiten, Spielplätze), das Landgemeinden häufiger betrifft als Kleinstädte, kann ebenfalls zur Entscheidung wegzuziehen, beitragen.
Schließlich kann auch die räumliche Nähe bzw. Erreichbarkeit individuell bedeutsamer Orte der Versorgung, der Begegnung, der Arbeit oder der Bildung die Bleibeorientierung begünstigen. Das Fehlen kurzer Wege zu diesen Orten bzw. eine als schlecht wahrgenommene Erreichbarkeit wird hingegen als negativ bewertet.
Wenn wir nach KLEINSTADT umziehen wollen, wäre das sehr gut für uns, weil wir viel Geld für Verkehrsmittel ausgeben. (…) Dort kann man zu Fuß zu dem arabischen oder syrischen Laden gehen und kaufen was man braucht. Deswegen finde ich wäre KLEINSTADT sehr gut für uns. (Syrer, 80–90 Jahre, C_VI_GEF_096)
Da Geflüchtete vor Ort zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV wenig flexibel und lange zu den Zielen unterwegs sind, kommen dem Führerscheinerwerb und der Verfügbarkeit eines Privat-Pkws eine entscheidende Rolle zu (s. Kap. 7). Sie werden von den Geflüchteten als Vorbedingung für das Bleiben gesehen.
4.3 Steuerung der Bleibeorientierung durch die Lokalpolitik
Politische Steuerung kann im Bereich von Bleiben und Halten unter zwei Aspekten betrachtet werden. Erstens stellt sich die Frage, ob das „Halten“ überhaupt als explizites politisches Ziel lokaler Politik formuliert wird, das konkrete Maßnahmen oder deren strategische Bündelung zur Folge hat. Eine solche explizite lokale Haltepolitik wäre als zielgerichtetes Handeln lokaler Stakeholder zu definieren, das allgemeinverbindliche Entscheidungen über Maßnahmen herbeiführen will, die Geflüchtete freiwillig (Überzeugung, „gutes Leben“) oder verpflichtend mittels rechtlicher Regelungen (Wohnsitzauflage) an das jeweilige lokale Gemeinwesen binden. Zweitens – und selbst wenn die Haltepolitik nicht explizit formuliert wird – können die Erfolgsaussichten, Geflüchtete am Wohnort zu halten, danach bewertet werden, ob es gelingt, die oben skizzierten Bleibefaktoren zu stützen und günstige Rahmenbedingungen in den relevanten Integrationsdimensionen zu schaffen. Dazu aber müssen diese relevanten Dimensionen auch durch Politik und Verwaltung erkannt werden. Ein mismatch (Massey 2020) zwischen Anforderungen und Maßnahmen oder eine verkürzte Betrachtung der Multidimensionalität von Bleibefaktoren würde dagegen Erfolgsaussichten lokaler Politik drastisch schmälern (s. Scholten 2020).
Während der zweite Aspekt eher indirekt über einen Abgleich mit politischen Maßnahmen analysiert werden kann, wurden die Einschätzungen zur Bleibeperspektive von Geflüchteten und aktive „Haltemaßnahmen“ in den Experteninterviews explizit erfragt.Footnote 12 Darüber hinaus finden sich an verschiedensten Stellen im Material Hinweise zu Halteorientierungen und Annahmen über die Bleibeorientierung Geflüchteter. Betrachtet man also zunächst die Frage, ob und wie Halteorientierungen und aktive Haltepolitiken in den untersuchten Landkreisen durch Politik und Verwaltung artikuliert werden, so ergeben sich auf Kreisebene drei grobe Ausprägungen. Wichtig dabei ist, dass die befragten Expert*innen eines untersuchten Landkreises selten ein einheitliches Bild in der Bewertung der Halteorientierung abgeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Halteorientierung nicht als offizielle Politik „von oben“ vorgegeben ist.
Solch dezidierte Halteorientierungen lassen sich dennoch in drei der untersuchten Landkreise feststellen. Hier wird Halten als Aufgabe lokaler Politik beschrieben und entsprechend mit klar benennbaren aktiven Haltepolitiken verbunden. Zu diesen gehört beispielsweise die Wohnsitzauflage, die gerade von den hessischen Landkreisen befürwortet und sogar beim Land eingefordert wurde:
[…] ich war ein Verfechter mit meinen Kollegen [Name], die Wohnsitzauflage haben zu wollen. […] Wir haben auch darauf gesetzt, dass die Menschen für uns eine Bereicherung sind und in Räumen, die eher von Abwanderung gekennzeichnet sind, zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen beitragen können. (*_V_POL_226)
Hier wird die Zuwanderung Geflüchteter dezidiert mit dem demographischen Wandel in ländlichen Regionen zusammengebracht. Die Wohnsitzauflage wird in diesem Zusammenhang weniger als ein sicherheitspolitisches Kontrollinstrument gesehen, sondern vielmehr als entwicklungspolitisches Instrument sowie nicht zuletzt als Absicherung von lokalen Investitionen in Integrationsprozesse.
Während die Wohnsitzauflage als restriktive Steuerungsmaßnahme gelten kann, versuchen Landkreise auch, Anreize für das Bleiben zu setzen. Ein Beispiel ist die aktive Förderung der Familienzusammenführung, die von der Verwaltung eines der drei Landkreise betrieben wird. Die Einheit der Familie wird dort als Bleibefaktor ernstgenommen:
Deswegen haben wir ja auch bewusst diesen Familiennachzug forciert. Dass wir gesagt haben, die Leute werden eher heimisch, wenn sie ihre Familie hier haben, und bleiben dann auch. Und wollen nicht nur als erstes wieder weg. (D_VIII_POL_286)
Darüber hinaus werden Programme zur Förderung der lokalen Arbeitsmarktintegration Geflüchteter explizit als Haltestrategie genutzt.
Arbeit, klar, ist Voraussetzung und wenn die einen Arbeitsplatz bekommen oder so, nehmen das an, haben auch vor, hier langfristig auch zu wohnen und zu bleiben. Und so stärkt man den ländlichen Raum mehr oder weniger auch. (C_VI_ZIV_236)
Auffällig ist, dass beide hessischen Landkreise – als Befürworter der Wohnsitzauflage – sowie ein niedersächsischer Landkreis mit gutem Arbeitsmarkt explizit das Halten politisch adressieren. Die meisten Gesprächspartner*innen in den fünf anderen untersuchten Landkreisen zeichnen sich eher durch implizite Halteorientierungen aus. Sie formulieren das Halten als Hoffnung; eine dezidierte Haltepolitik sehen sie außerhalb ihrer Möglichkeiten. Stattdessen hoffen sie, dass die individuelle Teilhabe in wichtigen Integrationsdimensionen die Chancen auf Bleiben erhöht.
Neben der Arbeitsmarktintegration sind es insbesondere die Bildungsteilhabe von Kindern und die social bridges der Familien, die aus Sicht der befragten Expert*innen Anlass zur Hoffnung geben.
Indem sie in den Kindergarten gehen, indem sie in die Schule gehen und indem sie so sagen: „Ja, die Kinder sind jetzt hier dabei. Die Kinder fühlen sich wohl. Dann bleiben wir eben auch hier.“ Das sehe ich als die große Chance im ländlichen Raum. Aus der Sicht der Geflüchteten. (A_II_POL_162)
Der Zusatz „aus Sicht der Geflüchteten“ verweist jedoch darauf, dass es in solchen Fällen weniger um ein aktives Halten geht als vielmehr um ein Streben nach Teilhabe für Geflüchtete. Das Bleiben ist dann ein durchaus willkommener Nebeneffekt – nicht jedoch das Ziel politischer Bemühungen.
Neben expliziten und impliziten Halteorientierungen zeigen zahlreiche Gesprächspartner*innen auch keinerlei Halteorientierung (z. B. D_VIII_POL_271). Dies bedeutet keinesfalls, dass sie eine flüchtlingsfeindliche Einstellung aufweisen, sondern schlicht, dass sie das Halten als nicht gestaltbar bewerten. Sie verweisen stattdessen darauf, dass Geflüchtete individuell entscheiden müssen, ob sie die lokalen Gegebenheiten hin- und annehmen möchten:
Ich sage mal, das liegt ja in erster Linie nicht nur an dem Landkreis, ob die dableiben, sondern ich sage mal, in erster Linie liegt es an jedem einzelnen persönlich, ob er das akzeptiert und dableibt. (B_III_VER_181)
Eine derartige politische Grundhaltung geht meist mit einem eher assimilativen Integrationsverständnis einher. Nicht der Landkreis muss sich um das Bleiben Geflüchteter bemühen, sondern die Geflüchteten selbst müssen ihre Chancen vor Ort nutzen – oder eben weiterwandern. „Halten“ wird als außerhalb der lokalen Zuständigkeit wahrgenommen – wie hier im Landkreis VII, der im Folgenden als Fallbeispiel dient.
Zu halten hier? Nee. Gibt es nicht. Wir machen unseren Job so gut wie es geht, das muss reichen, das muss reichen als Maßnahme. Ja, nee, aber so richtig, nein. (D_VII_VER_257)
Diese Haltung folgt hier auch den ernüchternden Erfahrungen der vergangenen Jahre. Nach 2015 hatten noch mehr Kommunen gehofft, mit den Geflüchteten den demographischen Wandel auszugleichen, sahen sich dann aber mit Weiterwanderung konfrontiert.
Und insofern müssen wir jetzt feststellen, dass durch die vorhandene Euphorie, die da war, Menschen in den ländlichen Raum zu gewinnen […], nicht bewahrheitet hat und die Ehrenamtlichen, da ist eine Frustration da, weil die Flüchtlinge […] nicht hier in der Gegend bleiben. (D_VII_POL_255)
Generell erklären sich dies viele befragte Expert*innen, so auch im Landkreis VII, mit den Strukturbedingungen ländlicher Regionen. Menschen würden eben einfach in die Stadt ziehen – das sei auch bei Deutschen nicht anders: „Wenn man es steuern könnte, würde man es ja für die Deutschen auch steuern.“ (D_VII_VER_261)
Selbst wenn ein Landkreis eher implizite Halteorientierungen aufweist oder gar völlig passiv bleibt, lässt sich auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Wunsch nach aktiven Haltepolitiken vorfinden. Doch in diesen Fällen bleibt der Austausch über Halteorientierungen eher informell, wie ein*e Verwaltungsmitarbeiter*in einer Landkreisverwaltung berichtet:
Wie gesagt, [Landgemeinde] ist ein typisches Beispiel, wo, glaube ich schon, auch ein Wunsch da ist, die Leute dann zu halten […] Aber wie gesagt, von Landkreisseite […], dass sich da aktiv für eingesetzt wird, [da] könnte ich keine Aussage drübermachen. Weder positiv noch negativ. (D_VII_VER_260)
Grundsätzlich zeigen sich die drei skizzierten Ausprägungen der Halteorientierung (Halten als Aufgabe, Halten als Hoffnung, Halten als nicht gestaltbar) auch auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen. Wichtig zu betonen ist allerdings, dass die Handlungsspielräume hier noch deutlicher eingeschränkt sind – u. a. durch aufenthaltsrechtliche Zuständigkeiten und übergeordnete Politiken des Landkreises. Eine aktive Haltepolitik einer kreisangehörigen Gemeinde in einem diesbezüglich eher passiven Landkreis sorgt nicht nur für viel Frust in der Gemeinde, sondern schmälert auch die Erfolgsaussichten. Wie so häufig in ländlichen Regionen (und Landkreisen generell), bestimmt die Qualität der Kooperationsbeziehungen zwischen Landkreis und kreisangehöriger Gemeinde den Erfolg politischer Maßnahmen (u. a. Matland 1995, Hupe und Hill 2015).
Selbst wenn keine aktiven Haltepolitiken vorliegen, muss dies nicht bedeuten, dass Geflüchtete aus ländlichen Regionen abwandern. Im Sinne derjenigen, die Halten als Hoffnung formulieren, kann gelingende Integrationsarbeit dazu beitragen, dass Menschen vor Ort wohnen bleiben. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Schwerpunkte der Integrationsarbeit mit den wichtigen Bleibefaktoren aufseiten der Geflüchteten übereinstimmen. Auch wenn sich an dieser Stelle nur ein grober Überblick geben lässt, so kann doch festgestellt werden, dass die bleiberelevanten Faktoren unterschiedlich stark im Bewusstsein der Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung verankert sind.
Die wohl stärkste Übereinstimmung gibt es mit Blick auf die Bedeutung des Arbeitsmarktes. Dies folgt einer Grundannahme deutscher Integrationspolitik, dass Integration vor allem durch die Faktoren Arbeit und Sprache bestimmt sei (u. a. Schammann 2017). Doch bereits der zweite Aspekt, das Erlernen der deutschen Sprache, führt zu den ersten kleinen Unterschieden. Auch wenn Geflüchtete Deutschkenntnisse als wichtig für ihre Teilhabechancen ansehen, wird der lokal verfügbare Platz in einem Deutschkurs doch gegenüber anderen Bildungs- und v. a. Arbeitsmarktangeboten als weniger wichtig wahrgenommen. Gleichzeitig dreht sich ein großer Teil der (lokalen) Integrationspolitik um die Organisation von Deutschkursen, während andere Bildungsangebote etwas weniger intensiv bearbeitet werden.
Umgekehrt gibt es auch Bleibefaktoren, die von Geflüchteten als besonders wichtig eingeschätzt werden, jedoch auf politischer Ebene weniger stark sichtbar sind. Dazu gehört beispielsweise die Bedeutung von familiengerechten Rahmenbedingungen, die die Bleibewahrscheinlichkeit enorm erhöhen können. Diese Erkenntnis ist zwar bei den spezialisierten „Integrationsprofis“ der Verwaltung durchaus verbreitet, wird aber insbesondere in politischen Gremien immer wieder zugunsten der Arbeitsmarktintegration vernachlässigt. Die gerade in ländlichen Regionen offenbar besseren Haltechancen für Familien münden daher bislang kaum in aktive Haltepolitiken.
Nicht unterschätzt werden sollten dagegen die Rolle des günstigeren Wohnraums sowie die Bedeutung von social bridges und social links. Die meisten Befragten gehen davon aus, dass die im Gegensatz zu urbanen Räumen übersichtlichen Strukturen in Ämtern und Behörden sowie eine möglichst enge ehrenamtliche Begleitung zu den Bleibefaktoren in ländlichen Regionen zählen.
Eben wir haben Leute gehabt, die sind nach Köln und kamen dann wieder und haben gesagt, da komme ich noch nicht mal in die Ausländerbehörde. Und hier, hier kann ich einfach vorbeikommen und komme dran. (C_V_VER_223)
Allerdings gilt auch hier, dass die soziale Nähe in ländlichen Regionen eher als eine Strukturbedingung denn als bewusst gestaltbar wahrgenommen wird. In der Folge existieren keine dezidierten Haltepolitiken, die ganz bewusst und strategisch an diesen besonderen Chancen ländlicher Regionen ansetzen und sie „haltestrategisch“ nutzen.
4.4 Rolle der Aufnahmegesellschaft für die Bleibeorientierung Geflüchteter
Die Aufnahmegesellschaft spielt eine wesentliche Rolle bei Entscheidungen von Geflüchteten, an einem ländlichen Wohnort zu verbleiben oder nicht. Neben der Schaffung eines aktiven Willkommensklimas bzw. halteorientierter Politikansätze (s. Abschn. 6.4.3) ist es auch die kollektive Orientierung der lokalen Bevölkerung, Migrant*innen am Ort halten zu wollen oder eben nicht, die durch konkrete Alltagspraktiken zum Ausdruck kommt und damit Signalwirkung für die Geflüchteten oder andere Migrant*innen aufweist.
Im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts steht daher die Frage, ob in der lokalen Bevölkerung ein Bleiben der Geflüchteten antizipiert, für machbar gehalten oder erwünscht ist. Die kollektive Haltung zu dieser Frage ist nicht nur das Ergebnis einer Summe von individuellen Einstellungsmustern, sondern ist ebenso in der Geschichte des Ortes, insbesondere seiner Migrationsgeschichte, verankert (s. dazu das Modell lokaler Rezeptivität in Kap. 5). Dazu wird zunächst aus der Bevölkerungsbefragung dargestellt, welche aggregierten soziodemographischen Merkmale und Einstellungsmerkmale der Residenzbevölkerung sich als begünstigend für die Entwicklung einer inklusiven, offenen und toleranten Haltung gegenüber Geflüchteten oder anderen Neuankommenden erweisen. Anschließend wird auf Grundlage von Experteninterviews untersucht, welche standortbezogenen Charakteristika (insbesondere lokale Migrationsgeschichte und lokale Erfahrungen mit kultureller/religiöser Diversität) die Entstehung einer Halteorientierung fördern. Beide Faktorenbündel können sowohl direkt als auch indirekt Einfluss auf die Entwicklung einer Bleibeorientierung seitens der Geflüchteten sowie einer Halteorientierung seitens der lokalen und politisch handelnden Akteur*innen haben. Abschließend betrachten wir, anknüpfend an die Deutungsmusteranalyse des Integrationsbegriffs (s. Abschn. 5.4.5), die kollektiven Vorstellungen hinsichtlich der Linearität und Prozesshaftigkeit von Integration als einen Bestandteil von Haltestrategien.
4.4.1 Halten oder Gehen lassen: Einstellungen der lokalen Bevölkerung
Im Rahmen der Bevölkerungsbefragung wurde erhoben, inwieweit der eigene Ort von den Befragten (n = 904) als guter Wohnort für Geflüchtete eingeschätzt wird: Im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen (z. B. Familien mit Kindern, Rentner*innen) wird die eigene Gemeinde von einer Minderheit als „guter Ort“ (14 %) für Geflüchtete eingeschätzt. In der regionalen Differenzierung zeigen sich dabei prägnante Unterschiede (s. Abb. 6.2): Während Befragte der beiden sächsischen Fallstudienlandkreise sich am reserviertesten in der Einschätzung ihres Wohnortes zeigten, reagierten insbesondere Befragte in den Landkreisen Vechta, Werra-Meißner-Kreis und Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim überdurchschnittlich positiv auf diese Frage.
Hierbei können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, beispielsweise – unabhängig von der eigenen Einstellung gegenüber Ausländer*innen – auch die Einschätzung der Integrationsinfrastruktur oder die gesellschaftliche Stimmung. Die Daten zeigen, dass tendenziell der Wohnort positiver für Geflüchtete bewertet wird, wenn eine offene Einstellung gegenüber Ausländer*innen vorliegt. Die Offenheit gegenüber „Ausländer*innen“ wiederum korreliert nicht nur mit der Häufigkeit positiver Kontakte zu Ausländer*innen (s. Kap. 5), sondern auch mit dem Alter: Tendenziell zeigen in den Befragungsergebnissen jüngere Menschen häufiger offene und zugewandte Haltungen als ältere Befragte, insbesondere Muslim*innen gegenüber. Die verstärkte Alterung in ländlichen Regionen als Effekt des demographischen Wandels kann demnach als ein maßgeblicher Einflussfaktor bezüglich der Offenheit gegenüber Geflüchteten identifiziert werden.
Die oben dargestellten Zusammenhänge zeigen sich auch bezüglich der Haltung zur weiteren Aufnahme von Geflüchteten in den Gemeinden, was indirekt auf eine Halteorientierung hinweisen kann: Nur 7,3 % der Befragten stimmen der Aussage „voll und ganz“ zu, dass ihr Wohnort (noch mehr) Geflüchtete aufnehmen kann, und nur 26,8 % stimmen der Aussage „eher“ zu. Die Zurückhaltung gegenüber der zusätzlichen Aufnahme von Geflüchteten ist also stärker ausgeprägt als die grundsätzliche Offenheit gegenüber einer Aufnahme von Geflüchteten. Dabei gab es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern, wobei sich besonders die Befragten aus den bayerischen und sächsischen Landkreisen zurückhaltender gegenüber einer Aufnahme äußern. Im Landkreis Bautzen (SN) geben 79 % der Befragten an, dass ihr Wohnort keine Geflüchteten mehr aufnehmen könne („eher nicht“ und „überhaupt nicht“); im Landkreis Nordsachsen (SN) 74 %, im Landkreis Regen (BY) 73,3 % und im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim immerhin noch 66,7 %. Für die sächsischen Landkreise konnte hier insbesondere ein hoher Wert relativer Deprivation (d. h. ein subjektives Gefühl der Benachteiligung, z. B. sozioökonomischer Natur) nachgewiesen werden, der als ein Teil der Erklärung ablehnender Einstellung heranzuziehen ist (s. auch Schneider et al. 2021). Ebenso weisen alle vier Landkreise in Bayern und Sachsen die geringsten Werte in der Kontakterfahrung mit Migrant*innen auf (s. Kap. 8).
4.4.2 Lokale Migrationsgeschichte und Diversitätserfahrungen
Hinsichtlich der aus der lokalen Geschichte abzuleitenden Faktoren von Rezeptivität sind vor allem die lokalen Erfahrungen mit (internationaler) Migration und durch Migration entstandene Diversität zu nennen, die eine Hintergrundfolie für die Beurteilung der langfristigen Bleibeorientierung von Geflüchteten darstellen und Unterschiede in der Entwicklung von Integrationsstrukturen erklären. Eine erste kollektiv erinnerte Migrationsepoche ist dabei die zahlreiche Aufnahme von Geflüchteten und Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs. Einige Gesprächspartner*innen reflektieren dabei die anfängliche Ablehnung der ‚volksdeutschen‘ Vertriebenen:
Aber es war mehr oder weniger auch Zwangseinquartierung, die ja nicht immer gewünscht war. […] Ich glaube, es waren so an die 200 Geflüchtete allein hier in diesem Dorf. […] Mein Vater ist auch geflüchtet, also ich bin noch Flüchtling erster Generation (lachend), also da kennt man das wie ist es, wenn man mit NICHTS sich auf den Weg machen muss und woanders vielleicht gar nicht willkommen ist. (B_III_ZIV_330)
Zwar hätten die Kriegsflüchtlinge und Vertriebenen im Vergleich zu den jetzigen Geflüchteten den Vorteil der geringeren kulturellen Distanz, die sich insbesondere in der Sprache zeigte und Integrationsverläufe erleichterte. Dennoch war auch bei diesen Gruppen auf der Basis von z. B. konfessionellen Unterschieden anfänglich eine starke Abgrenzung zwischen Einheimischen und Zugewanderten zu spüren und es kam auch zu gewaltvollen Abwehrreaktionen seitens der Einheimischen.
IP1: Es gab bis zum Zweiten Weltkrieg keine evangelischen hier.
IP2: ob man evangelisch war oder katholisch. Ja. Die Evangelen hatten eine eigene Schule. Die durften/nach dem Motto: „Spiele nicht mit den Schmuddelkindern“, so war das damals. So habe ich das auch erlebt.
IP1: Es gab einen Strich auf dem Pausenhof, auf der einen Seite die katholischen, […] und auf der anderen die Evangelen. (D_VIII_ZIV_360)
Eine weitere in vielen Kommunen präsente Erfahrung ist die Ansiedlung von Arbeitsmigrant*innen ab den 1960er-Jahren. In allen Untersuchungsregionen wird dabei der Grund für ihre Anwesenheit, nämlich die Aufnahme einer Beschäftigung, als wesentlicher Faktor für eine rasche Integration hervorgehoben, wobei Integration aus der Perspektive des nachfolgenden Interviewausschnitts vor allem mit dem konfliktfreien Einfügen der Migrant*innen in den deutschen Arbeitsmarkt interpretiert wird. Dabei wird der Mangel an institutionellen Integrationsangeboten, z. B. in Bezug auf den Spracherwerb oder die schulische Integration der ‚Gastarbeiter‘-Kinder, wie auch die von den ‚Gastarbeiter*innen‘ erlebte Nicht-Anerkennung und Diskriminierung,Footnote 13 vollständig ausgeblendet.
Da hat es funktioniert. Die sind natürlich unter einem ANDEREN ASPEKT gekommen. Die sind zum Teil gerufen worden, weil sie – und die haben hier gearbeitet. Und das, was hier – was bei den neuen Mitbürgern jetzt so das Problem ist, ist halt, dass die häufig nicht arbeiten können oder dürfen. Also, die Anerkannten ja, aber da ist halt auch so das Problem, dass sie hier nichts finden oder die Sprache nicht so gut beherrschen. Das war bei den Gastarbeitern anders. Die sind ja gekommen, um hier zu arbeiten, die haben hier gearbeitet, die haben hier ganz viel gestemmt und da war die Integration LEICHTER, als mit den anderen finde ich. (B_III_POL_328)
Divergierend ist jedoch die Erfahrung mit den langfristigen Folgen der ‚Gastarbeiter‘-Zuwanderung. Während vor allem in den hessischen, teils aber auch in den bayerischen und niedersächsischen Untersuchungsregionen der langfristige Verbleib der ‚Gastarbeiter*innen‘ als Ausgangspunkt für eine wachsende gesellschaftliche Heterogenisierung betrachtet wird, ist die Rückschau in den sächsischen Untersuchungsgebieten durch Temporalität geprägt, da die meisten ‚Vertragsarbeiter*innen‘ nach dem politischen Umbruch und dem Verlust ihrer Industriearbeitsplätze nicht vor Ort verblieben. Da sie zudem grundsätzlich segregiert untergebracht waren und ein Kontakt zur deutschen Bevölkerung nicht erwünscht war, bleibt von dieser Migrationsepoche vor allem die Erinnerung der Vorläufigkeit und der Unsichtbarkeit dieser Migrant*innen.
Also es gab ja zu DDR-Zeiten Ausländer-Vertragsarbeiter im Glaswerk und mein Vikariatsvater und Mentor hat da auch sich immer sehr um die gekümmert, weiß ich noch. Aber das lief immer sehr am Rande und sehr im Verborgenen eher. Das war ja auch nicht erwünscht staatlicherseits, dass da irgendwie große Kontakte entstanden. (*_II_ZIV_310)
Diese Erfahrung setzte sich in den 1990er-Jahren mit der Aufnahme von Spätaussiedler*innen, Kontingentflüchtlingen und Asylsuchenden fort, die oftmals weiterwanderten, sobald die Wohnsitzauflagen aufgehoben wurden. Dementsprechend ist in den sächsischen Untersuchungsregionen das Selbstbild einer Durchgangsstation für Migrant*innen von historischen Erfahrungen geprägt und beeinflusst die Perspektive auf die heutigen Geflüchteten und ihre eventuellen Bleibeabsichten.
Es gab mal (…) Zeitlang, dass ganz viele Leute, also Leute aus dem, Deutsche aus dem Wolgagebiet und so weiter, aus Kasachstan, hierher kamen. Aber, da muss ich sagen, der große Teil von ihnen, haben das nur als Zwischenstation genutzt. Sondern sind dann, weil es teilweise mit der Arbeit schwierig war, das war ja hier im Osten nicht so einfach und wenn sie die Sprache nicht so genau beherrschten war es auch schwer. (*_I_ZIV_296)
Auch in den anderen Untersuchungsregionen kam es in den 1990er-Jahren zur zuweisungsgebundenen Aufnahme von Spätaussiedler*innen und Asylsuchenden z. B. aus Ex-Jugoslawien. Die Integration dieser Gruppen wird kontrovers reflektiert. Während an einigen Standorten positive Integrationsverläufe hervorgehoben werden, wird in anderen Untersuchungsgemeinden kritisiert, dass sich die Spätaussiedler*innen vorwiegend in der Eigengruppe aufhielten. Jedoch wurden in dieser Zeit vielerorts erstmals nennenswerte Integrationsinfrastrukturen wie etwa Beratungsstellen oder Sprachlern-Angebote geschaffen, die dann später eine Basis für die Integrationsarbeit der ab 2015 aufgenommenen Geflüchteten darstellt.
Der Landkreis [Name] ist ein Landkreis, der […] ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war, hier sehr, sehr viele Russland-Deutsche aufgenommen hat. Und das war schon eine Erfahrung irgendwie, auf die man vielleicht aufbauen kann. Ich glaube, dass da sehr viele sehr aktiv waren, aber wo auch manches nicht so gut geklappt hat. Also … […] Es gab auch so ganz gute Angebote von der Arbeitsagentur, also Deutsch lernen und gleichzeitig berufliche Orientierung. Das waren wirklich SEHR GUTE Angebote, aber es haben sich viele Communities so gebildet, zu denen man eigentlich keinen Zugang bekommt oder schlecht. Die sprechen heute immer noch Russisch untereinander und die heiraten auch in diesen Communities und die bauen auch alle zusammen. […] Da ist meiner Meinung nach Integration nicht wirklich gelungen. (C_V_VER_319)
In den 2000er-Jahren, vor allem nach der EU-Osterweiterung von 2004, wuchs in allen Untersuchungsregionen die Präsenz von EU-Arbeitsmigrant*innen. Teils wird dies durch die Grenznähe zu Tschechien und Polen (Landkreis Regen, Landkreis Bautzen) gefördert. Dabei gibt es länder- und branchenbezogene Unterschiede: Während vor allem die Arbeitsmigrant*innen im grenznahen Raum in allen Branchen zu finden sind, werden bulgarische und rumänische Arbeitskräfte gezielt für die großen Schlachtbetriebe vor allem in Niedersachsen angeworben. Da diese Migrant*innen offensichtlich zum Zweck der Erwerbstätigkeit (temporär) anwesend sind, werden sie außerhalb des ‚Integrationsparadigmas‘ betrachtet.
Die werden ganz anders wahrgenommen, weil sie zum Teil (..) sich gar nicht(..)/zu versuchen, zu integrieren, weil sie es auch nicht KÖNNEN. Die haben also Arbeitszeiten/viele arbeiten ja in fleischverarbeitenden Betrieben, dann Arbeitszeit irgendwie zehn bis 12 Stunden am Tag, und wenn die abends nach Hause kommen, sind sie uppe. Die brauchen nicht mehr irgendwelche Aktivitäten (.) unternehmen. (*_VIII_ZIV_355)
Diese verschiedenen Narrationen zeigen, dass ein Halten von Migrant*innen seitens der Einheimischen eng mit einer erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt gekoppelt ist. Das teilweise konflikthafte Erleben von Integration wird ausschließlich aus der Eigenperspektive dargestellt. Eine Halteorientierung, die die Schwierigkeiten von Geflüchteten und anderen Migrant*innen jenseits von Spracherwerb und Arbeitsmarktintegration antizipiert (wie etwa Einsamkeit und Ausgrenzung, s. Kap. 8), ist kaum ausgeprägt. In der Reflexion der Flüchtlingsaufnahme von 2015 äußern sich jedoch auch Stimmen, die für nachhaltige und stärker integrative (im Sinne eines whole-of-community-approach) Politikansätze plädieren, um auch lokale Stimmungen besser auffangen und konstruktiv wenden zu können.
Immer diese Feuerwehrsituation, aber es wird nicht NACHHALTIG […] weiter daran gearbeitet oder sich mit dem Thema inhaltlich beschäftigt und wenn Fördermittel freigegeben werden, Deutschland ist ein Förderstaat, mit ganz viel Förderung und Fördermöglichkeiten, aber das ist immer so, dass muss in der Öffentlichkeit irgendwie Beachtung gefunden haben und die eigentliche Arbeit ist nicht so wichtig. Wir haben was getan. Wir haben doch ein Sonderprogramm aufgelegt für Flüchtlinge und das haben wir jetzt gemacht und jetzt ist gut (lacht). (A_II_ZIV_305)
4.4.3 Linearität von ‚Integration‘
Ein weiterer Faktor für die Beurteilung einer lokalen Halteorientierung ist die Frage, wie viel Zeit Zugewanderten zugestanden wird, um sich zu integrieren. Die Analyse der Deutungsmuster von Integration (s. Abschn. 5.4.5) zeigen, dass lediglich bei teilhabeorientierten Ansätzen Integration als ein längerfristiger Prozess antizipiert wird, während assimilationsorientierte Einstellungen Integration als ein von den Migrant*innen zu erreichendes Ziel betrachten, das die Grundlage für einen längerfristigen Verbleib von Geflüchteten und anderen Zugewanderten in den ländlichen Gemeinden ist.
Das zeigte sich auch in der Reflexion der Aufnahme von Geflüchteten seit 2015, die hier exemplarisch anhand des Landkreises Northeim in Niedersachsen dargestellt wird. Die lokale Berichterstattung vermittelt zunächst den Eindruck einer breiten Willkommensbasis unter den Akteur*innen im Landkreis und einer überwältigenden Hilfsbereitschaft der Bürger*innen.Footnote 14 Die Presseartikel würdigen dieses Engagement, geben jedoch auch Kritik an den hauptamtlichen Stellen Raum, die sich anfangs zu stark auf das Engagement der Ehrenamtlichen verlassen hätten (Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), 22.06.2021).
Obgleich die Fallstudienregion Landkreis Northeim im Gesamtvergleich ein sehr hohes zivilgesellschaftliches ‚Willkommenspotenzial‘ aufweist, offenbaren sich selbst hier Schwierigkeiten, die spontane Hilfsbereitschaft in anhaltendes Engagement zu überführen und die kollektive Erwartungshaltung hinsichtlich der Integrationsgeschwindigkeit zu reflektieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Teilweise wurden überzogene Erwartungen hinsichtlich der Integrationsgeschwindigkeit und Anpassungsbereitschaft der Geflüchteten beobachtet, die schlussendlich in Enttäuschung und Rückzug seitens der Ehrenamtlichen mündeten.
Die Ehrenamtlichen vor Ort waren anfangs sehr motiviert,(..) und das hat sich aber je weiter sie die Familien begleitet haben entweder in, also bei einigen zumindest, in Frust ist es übergegangen, weil entweder nicht die Ziele erreicht wurden, die die Ehrenamtlichen sich vorgestellt hatten ursprünglich. Weil zum Teil auch die Entwicklung in den Familien oder der WEG in Richtung Selbständigkeit nicht so schnell vollzogen werden konnte. (*_VII_VER_363)
So erscheint es ca. ab dem Jahr 2017 in allen Fallstudienregionen notwendig, neue ehrenamtliche Potenziale zu erschließen, worauf beispielhaft ein Pressebericht im Landkreis Northeim vom 11.03.2017 hinweist:
Derzeit sinke zwar die Zahl der Geflüchteten, die neu nach Northeim kämen, der Bedarf an Unterstützung bei der weiteren Integration derer, die schon hier seien, sei aber unverändert hoch. („Café Dialog sucht Helfer für Flüchtlingsarbeit“, HNA, 11.03.2017)
All diese Faktoren zeigen, dass die Aufnahmegesellschaft kaum auf die Langfristigkeit von Integrationsprozessen eingestellt ist. Einerseits fehlen effektive Schnittstellen im institutionellen Gefüge der Integrationsarbeit, andererseits fehlt es der Aufnahmebevölkerung am ‚langen Atem‘, verbunden mit einer kollektiven Ausdauer im Einfordern von Integrationsmöglichkeiten gegenüber hauptamtlichen Institutionen und der eigenen Offenheit gegenüber Integrationsprozessen.
5 Zusammenfassung und Fazit
Empirische Ergebnisse zum Bleibeverhalten von Geflüchteten, die meist durch die Anwendung von Verteilungsmechanismen in ländliche Regionen gelangten, zeigten zunächst retrospektiv, dass ca. zwei Drittel der Geflüchteten mit Aufenthaltstitel, die zwischen 2012 und 2021 im Landkreis für länger als 90 Tage gemeldet waren, auch am 31.03.2021 noch dort gemeldet waren, also geblieben sind. Der Anteil der Gebliebenen in den sächsischen Landkreisen ist dabei allerdings deutlich geringer (29 % für den Landkreis Bautzen). Als mögliche Einflussfaktoren konnten raumstrukturelle Merkmale, wie die gute sozioökonomische Lage vor allem in den westdeutschen Landkreisen und die Nähe bzw. weite Entfernung von Zentren, aber auch politisch-administrative Mechanismen, wie die Anwendung von Wohnsitzregelungen, identifiziert werden. Vor allem Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene über 40 Jahren sind unter den Gebliebenen überrepräsentiert, während junge Erwachsene (ohne Familie) eher dazu tendieren, ländliche Regionen in Richtung der Ballungszentren zu verlassen. Die Gespräche mit Geflüchteten und die Erstellung individueller Wohnbiographien konnten zeigen, dass Wohnstandortmobilität ca. zur Hälfte innerhalb der Landkreise stattfindet und sich ab 90 Tagen nach der Einreise insgesamt reduziert. Die private Wohnsitznahme, die durchschnittlich 200 Tage nach der Einreise nach Deutschland erfolgte (in den Landkreisen Northeim und Waldeck-Frankenberg deutlich früher, im Landkreis Bautzen und im Werra-Meißner-Kreis erheblich später), stabilisiert die Wohnverhältnisse weiterhin. Als Gründe für eine Bleibeorientierung führten Geflüchtete zunächst Argumente an, die das Wohnumfeld betreffen, z. B. Sicherheit und Ruhe für Kinder, aber auch den leichteren Zugang zu Wohnraum im Vergleich zu Städten. Das Vorhandensein von (Weiter-)Bildungsmöglichkeiten wird insbesondere für die Zukunft als wichtige Infrastruktur betrachtet, die in Wohnortnähe vorhanden sein muss. Auch ein Arbeitsplatz stellt eine Voraussetzung für das Bleiben dar. Positiv bewertete soziale Netzwerke zur Lokalbevölkerung und anderen Migrant*innen werden ebenso genannt wie die Erreichbarkeit bedeutsamer Orte.
Darauf, inwiefern eine Bleibeorientierung von lokalen Akteur*innen in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gefördert werden kann, verweisen Halteorientierungen und aktive Haltepolitiken. In drei Untersuchungslandkreisen wurde „Halten“ als Aufgabe beschrieben, um Auswirkungen des demographischen Wandels abzuschwächen. Die Wohnsitzauflage wird dafür als nützliches Instrument beschrieben. Implizite Halteorientierungen, also ein Hoffen darauf, dass Halten möglich sei, äußern Expert*innen der anderen fünf Landkreise. Sie beziehen sich dabei auf die Teilhabe von Geflüchteten in Bezug auf wichtige Integrationsdimensionen, wie Bildung und Arbeit, durch die sich Bindungen etablieren, die dann die Chancen auf ein Bleiben erhöhen können. Integrationsarbeit kann hier positiv intervenieren, wenn deren Schwerpunkte mit den Bleibefaktoren der Geflüchteten übereinstimmen. Schließlich ist die Argumentation, dass Halten nicht gestaltbar ist und Geflüchtete im Rahmen der lokalen Konstellationen zurechtkommen müssen, verbreitet. Darüber hinaus nimmt die Zivilgesellschaft bei der Gestaltung einer Bleibeorientierung eine wichtige Rolle ein, indem beispielsweise ehrenamtliches Engagement und vielfältige Formen der Unterstützung insbesondere zu Beginn des Aufenthaltes in Deutschland einen Beitrag leisten, Bindungen an den Wohnort zu etablieren. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass die Langfristigkeit der Integrationsarbeit und die teils als schwierig wahrgenommene Zusammenarbeit mit Behörden die Energien der Zivilgesellschaft zermürben kann, was negative Effekte auf die Bleibe- und Halteorientierung haben kann. Schließlich können Einstellungen der Lokalbevölkerung gegenüber Geflüchteten, die ein Klima des Willkommenseins ausdrücken, für Haltestrategien in Wert gesetzt werden. Sowohl Erfahrungen mit Migration in der Vergangenheit, also die lokale Migrationsgeschichte, wie auch Kontakterfahrungen in der Gegenwart sind dabei wichtige Einflussfaktoren.
Notes
- 1.
Halfacree (2012) differenziert zwischen strukturellen (contextual subject) und individuellen Faktoren (calculating subject). Aus Gründen der Strukturierung werden diese im Folgenden separat diskutiert, wohlwissend, dass Interdependenzen bestehen und das eine nicht ohne das andere gedacht werden kann.
- 2.
- 3.
In die Analyse werden allerdings nur die Perspektiven derjenigen Geflüchteten einbezogen, die zum Zeitpunkt der Befragung vor Ort ansässig waren, wodurch sich eine Nichtberücksichtigung der temporär abwesenden sowie bereits abgewanderten Personen ergibt.
- 4.
Hierbei ist zu beachten, dass das AZR nicht für wissenschaftliche Auswertungen geschaffen wurde, sondern dass es sich um einen Auszug aus einer arbeitstäglichen, über lange Jahre gewachsenen Datenbank handelt. Der Nutzerkreis des AZR beinhaltet über 100.000 Zugriffsberechtigungen in ca. 14.000 Behörden und Organisationen, die für die Pflege und Qualität selbst verantwortlich sind (Kühn und Heimann 2021).
- 5.
Nach Rücksprache und Diskussion mit dem BAMF-Forschungsreferat und in Anlehnung an Kroh et al. (2016) bzw. Rösch et al. (2020) wurden für Geflüchtete mit befristetem, anerkanntem Schutzstatus Angaben zu folgenden Merkmalen im Ausländerzentralregister herangezogen/einbezogen: Nach § 25 Abs. 2 AufenthG (GFK) gewährt, nach § 25 Abs. 2 AufenthG (subsidiärer Schutz) gewährt, nach § 25 Abs. 3 AufenthG (Abschiebungsverbot), nach § 25 Abs. 1 AufenthG (Asyl) anerkannt, Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylG wie auch subsidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 AsylG gewährt sowie als Asylberechtigter anerkannt. Nicht in den Untersuchungsdatensatz aufgenommen wurden Personen nach § 55 Abs. 1 AsylG und Personen mit Duldung nach § 60a AufenthG.
- 6.
Linke Spalte: Gelb = 25 % weniger als der Bundesdurchschnitt 2017 (Rösch et al. 2020). Grün = 25 % mehr als der Bundesdurchschnitt 2017 (Rösch et al. 2020). Der Durchschnitt wird in weiß dargestellt, die Schattierungen verdeutlichen die Stärke des Abstandes bis zu den mehr/weniger 25 %. Rechte Tabellenseite: Gelb = Minimum des Bundeslandes. Grün = Maximum des Bundeslandes. Der Durchschnitt wird in weiß dargestellt, die Schattierungen verdeutlichen die Stärke des Abstandes zum Minimum/Maximum.
- 7.
Dabei nehmen wir an, dass ländliche Landkreise mit einer guten sozioökonomischen Lage vergleichsweise attraktive Bleibebedingungen aufweisen, weil sie u. a. einen aufnahmefähigeren Arbeitsmarkt und die Kommunen dort größere fiskalische Handlungsspielräume haben.
- 8.
Die Wohnsitzregelung besagt, dass anerkannte Geflüchtete (und ihre Familienangehörige) ihren Wohnsitz für bis zu drei Jahre in dem Bundesland nehmen müssen, dem sie während des Asylverfahrens zugewiesen wurden, sofern sie Sozialleistungen beziehen. Die Wohnsitzverpflichtung kann aufgehoben werden, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufgenommen wird. Die Bundesländer können weitere räumliche Beschränkungen erlassen und einen Wohnort in einem Landkreis oder einer Kommune vorschreiben (positive Wohnsitzauflage) oder bestimmte Kommunen als Wohnorte ausschließen (negative Wohnsitzauflage) (für eine Übersicht in den Bundesländern s. Rösch et al. 2020).
- 9.
Linke Tabellenseite: Gelb = 25 % weniger als der Durchschnitt des Landkreises. Grün = 25 % mehr als der Durchschnitt des Landkreises. Durchschnitt wird in weiß dargestellt, die Schattierungen verdeutlichen die Stärke des Abstandes bis zu den mehr/weniger 25 %. Rechte Tabellenseite: Farbliches Kontinuum, je dunkler desto größerer Anteil. Werte gerundet auf die volle Zahl.
- 10.
Zur Veranschaulichung ist die Abweichung der jeweiligen Altersgruppe von der Gesamtanwesenheit aller Altersgruppen farblich gekennzeichnet: Die Intensität des Grüntons zeigt den Grad der Abweichung nach oben, die Intensität des Gelbtons den Grad der Abweichung nach unten an. Auf der rechten Seite der Tabelle ist zusätzlich der Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Gesamtheit abgebildet. Auch hier veranschaulicht die Intensität des Grautons die jeweiligen Werte.
- 11.
Das könnte daran liegen, dass nicht alle Nationalitäten bundesweit gleichmäßig verteilt werden.
- 12.
Die Leitfragen lauteten: „Wie schätzen Sie eine langfristige Niederlassung von Geflüchteten im Landkreis XY ein?“ und „Gibt es aktive Maßnahmen, um neuzugezogene Bürger*innen und Geflüchtete zu einer langfristigen Niederlassung zu bewegen?“.
- 13.
Nachzulesen in verschiedenen autobiographischen Erinnerungen, die anlässlich des 50jährigen und 60jährigen Jubiläums der Anwerbeabkommen dokumentiert wurden, z. B. in der Dokumentation „Zuwanderer aus der Türkei erinnern sich.“ der Bundeszentrale für Politische Bildung (https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/anwerbeabkommen/43166/portraits) oder in der Reihe „Lebenswege“ des Online-Migrationsmuseums Rheinland-Pfalz (https://lebenswege.rlp.de/de/lebenswege/portraets/).
- 14.
Die ausführlichen Ergebnisse der Auswertung lokaler Mediendiskurse sind zu finden unter Glorius (2022).
Literatur
Carling, J. (2002). Migration in the age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Experiences. Journal of Ethnic and Migration Studies 28(1), S. 5–42.
Carling, J., & Schewel, K. (2018). Revisiting aspiration and ability in international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies 44(6), S. 945–963.
de Haas, H. (2014). Migration Theory: Quo Vadis? (= Working Paper 100). Oxford: International Migration Institute, University of Oxford. https://www.migrationinstitute.org/publications/wp-100-14/@@download/file. Zugegriffen: 11. Juni 2021.
Glorius, B. (2022, im Erscheinen). Analyse lokaler Diskurse zur Aufnahme von Geflüchteten. Einblicke in acht ländliche Untersuchungsregionen in Deutschland. Thünen Working Paper.
Halfacree, K. (2012). Heterolocal Identities? Counter-Urbanisation, Second Homes, and Rural Consumption in the Era of Mobilities. Population, Space and Place 18(2), S. 209–224.
Hupe, P., & Hill, M. (2015). ‘And the rest is implementation.’ Comparing approaches to what happens in policy processes beyond Great Expectations. Public Policy and Administration 31(2), S. 103–121.
Kaufmann, V. (2002). Re-thinking mobility: Contemporary sociology. Farnham: Ashgate.
Kroh, M., Brücker, H., Kühne, S., Liebau, E., Schupp, J., Siegert, M., & Trübswetter, P. (2016). Das Studiendesign der IABBAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten, SOEP Survey Papers 365, Berlin: DIW. https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.571019.de/diw_ssp0365.pdf. Zugegriffen: 21. Juni 2021.
Kühn, B., & Heimann, C. (2021). Hand in Hand? Datenmanagement in der lokalen Integrationsarbeit. Forschungsgruppe Migrationspolitik. Bestandsaufnahme und erste Befunde. MPRG Working Paper 01_2021. Hildesheim: Forschungsgruppe Migrationspolitik, Universität Hildesheim. https://www.unihildesheim.de/media/fb1/sozialwissenschaften/Forschungsfokus_Migrationspolitik/Startseite/MRPG_WP01_Datenmanagement.pdf. Zugegriffen: 11. Oktober 2021
Lewicka, M. (2010). What Makes Neighborhood Different from Home and City? Effects of Place Scale on Place Attachment. Journal of Environmental Psychology 30(1), S. 35–51.
Lewicka, M. (2011). Place Attachment: How Far Have we Come in the Last 40 Years? Journal of Environmental Psychology 31(3), S. 207–230.
Massey, D. (2020). Immigration policy mismatches and counterproductive outcomes: unauthorized migration to the U.S. in two eras, Comparative Migration Studies 8, Art. 21.
Mata Codesal, D. (2018). Is it simpler to leave or to stay put? Desired immobility in a Mexican village. Population, Space and Place 24(4), e2127.
Matland, R. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation, Journal of Public Administration Research and Theory 5(2), S. 145–174.
Ní Laoire, C. (2008). “Settling back”? A biographical and life-course perspective on Ireland’s recent return migration. Irish Geography 41(2), S. 195–210.
Rösch, T., Schneider, H., Weber, J., & Worbs, S. (2020). Integration von Geflüchteten in ländlichen Räumen. Forschungsbericht 36 des Forschungszentrums des Bundesamtes, Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Scannell, L., & Gifford, R. (2014). The Relations Between Natural and Civic Place Attachment and Pro-environmental Behavior. Journal of Environmental Psychology 30(3), S. 289–297.
Schammann, H. (2017). Eine meritokratische Wende? Arbeit und Leistung als neue Strukturprinzipien der deutschen Flüchtlingspolitik. Sozialer Fortschritt 66(11), S. 741–757.
Schneider, H., Bürer, M., & Glorius, B. (2021). Gesellschaftliche Einstellungen in ländlichen Räumen gegenüber Neuzugewanderten: Befragungsergebnisse und regionale Spezifika – Verbundprojekt „Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Regionen Deutschlands“ (=Thünen Working Paper 174). Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, doi: https://doi.org/10.3220/WP1619426837000.
Scholten, P. (2020). Mainstreaming Versus Alienation: Conceptualising the Role of Complexity in Migration and Diversity Policymaking. Journal of Ethnic and Migration Studies 46(1), S. 108–126.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Weichhart, P. (2009). Multilokalität – Konzepte, Theoriebezüge und Forschungsfragen. Informationen zur Raumentwicklung 1–2, S. 1–14.
Weidinger, T., Kordel, S., & Pohle, P. (2017). Bleiben oder Gehen? Einflussfaktoren auf die Wohnstandortmobilität anerkannter Flüchtlinge in ländlichen Räumen am Beispiel des Bayerischen Waldes. Europa Regional 24(3–4), S. 46–61.
Wingens, M., Windzio, M., de Valk, H., & Aybek, C. (Hrsg.). (2011). A Life-Course Perspective on Migration and Integration. Dordrecht: Springer.
Yuval-Davis, N. (2006). Belonging and the Politics of Belonging. Patterns of Prejudice 40(3), S. 197–214.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Kordel, S. et al. (2023). Bleibeorientierung Geflüchteter, die Rolle der Aufnahmegesellschaft und Haltestrategien der Lokalpolitik. In: Mehl, P., Fick, J., Glorius, B., Kordel, S., Schammann, H. (eds) Geflüchtete in ländlichen Regionen Deutschlands. Studien zur Migrations- und Integrationspolitik. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36689-6_6
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36689-6_6
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-36688-9
Online ISBN: 978-3-658-36689-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)