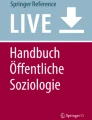Zusammenfassung
Niklas Luhmanns Die Wirtschaft der Gesellschaft (1988) stellt den Versuch dar, die vom Autor bereits seit den 1960er Jahren schrittweise entwickelte Theorie sozialer Systeme für eine Analyse der Wirtschaft fruchtbar zu machen. Insofern resultieren grundlegende Weichenstellungen des Luhmann’schen wirtschaftssoziologischen Zugriffs aus den Charakteristika dieser Gesellschaftstheorie (Luhmann,.Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1997), von denen eingangs zwei wichtige Aspekte vermerkt seien: 1) Die Systemtheorie stellt als die das Soziale konstituierenden basalen Einheiten nicht auf Akteure, Bewusstseinsakte oder Handlungen ab, sondern auf Kommunikationen. Sobald Menschen aufeinander Bezug nehmen, emergiert ein soziales System der Kommunikation, das zwar durch die jeweils involvierten psychischen Systeme in Gang gehalten wird, aber gerade nicht als deren bloße Summe zu denken ist.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Dies kann an Ort und Stelle nur sehr knapp geschehen. Es liegen zahlreiche Einführungen in die Theorie sozialer Systeme vor, hierunter auch eine Arbeit von Luhmann (2002) selbst.
- 2.
Die Rechtfertigung hierfür füllt ganze Bücher. Ein Argument von Luhmann (1984, S. 347) lautet: „Es ist […] prinzipiell falsch anzunehmen, Individuen seien besser oder jedenfalls direkter beobachtbar als soziale Systeme. Wenn ein Beobachter Verhalten auf Individuen zurechnet und nicht auf soziale Systeme, ist das seine Entscheidung. Sie bringt keinen ontologischen Primat von menschlicher Individualität zum Ausdruck, sondern nur Strukturen des selbstreferentiellen Systems der Beobachtung, gegebenenfalls also auch individuelle Präferenzen für Individuen, die sich dann politisch, ideologisch und moralisch vertreten lassen, aber nicht in den Gegenstand projiziert werden dürfen.“
- 3.
Luhmann nimmt gegenüber dem Konzept bei Parsons allerdings eine Umakzentuierung vor. Bei Parsons regeln „symbolisch generalisierte Medien“ vor allem die Austauschbeziehungen zwischen Systemen, bei Luhmann prozessieren sie zuvorderst die innersystemische Kommunikation.
- 4.
Auch der Bedürfnisbegriff ist sozialkonstruktivistisch zu denken, nicht ontologisch/anthropologisch: Bedürfnisse können selbst Effekte der Wirtschaft sein, die sie dann befriedigt (oder auch nicht befriedigt).
- 5.
Die heute im soziologischen Diskurs prominente Thematisierung von Finanzmärkten war in den 1980er Jahren noch ein Randgebiet.
- 6.
Der Geldmarkt zeichnet sich einerseits im Unterschied zu anderen Märkten wie Produktmärkten oder Arbeitsmärkten dadurch aus, dass auf ihm Anhaltspunkte, die in die Umwelt des Systems verweisen, nur hochgradig vermittelt zur Verfügung stehen. „Die Operationen dieses Marktes“, so vermutet Luhmann (S. 116) „sind im Höchstmaße selbstreferentiell bestimmt, das heißt: an der Selbstreferenz des Wirtschaftssystems und an der Reflexivität seines Mediums Geld orientiert“. Gleichzeitig und andererseits ist der Geldmarkt als einziger Markt mit allen anderen Märkten der Wirtschaft verschachtelt, weshalb er „am ehesten die Einheit des Systems im System“ repräsentiert (S. 118).
- 7.
Hieran könnte die Frage anschließen, welche Erfahrungen zu Luhmanns Lebzeiten für diesen Steuerungsskeptizismus Pate gestanden haben, beispielsweise die Krise Keynesianischer Wirtschaftssteuerung in den 1970er Jahren.
- 8.
Es ist deshalb auch wenig verwunderlich, wenn angesichts fortschreitender Ökonomisierungstendenzen in den vormals sozialstaatlich organisierten Gesellschaften des Westens seit einiger Zeit versucht wird, die These eines Primats der Ökonomie stärker mit dem Theorem funktionaler Differenzierung zu vermitteln (siehe Schimank 2009).
- 9.
Vergleichsweise evidenter ist Kaubes (2000) Feststellung einer Wechselwirkungslosigkeit von Systemtheorie (der Wirtschaft) und neoklassischer Ökonomik. Hier wäre eher zu fragen, warum sich auch die diversen Stränge heterodoxer Ökonomik bis dato kaum an Luhmann interessiert gezeigt haben.
- 10.
Bei Luhmann kommt der Einbettungsbegriff nur selten und zumeist negativ konnotiert vor, in Organisation und Entscheidung rangiert er etwa als Beispiel für „analytisch unscharfe Vorstellungen“ (Luhmann 2006, S. 408 f.).
- 11.
Ähnliches dürfte für die Luhmann-Rezeption außerhalb des deutschen Sprachraums gelten, die bis heute eher selektiv geblieben ist und eigentlich nur im Feld der Organisationssoziologie als klar identifizierbare Forschungsrichtung sichtbar ist. Eine englischsprachige Einführung in die Systemtheorie der Wirtschaft findet sich bei Boldyrev (2013).
- 12.
Eine ausführliche Diskussion dieses Streitpunkts sprengt den Rahmen des Artikels. Mein Eindruck ist, dass Luhmanns Ausführungen nach verschiedenen Seiten hin deutungsoffen sind. Dies dürfte zum einen am nicht immer zureichenden Ausarbeitungsgrad seiner Geldtheorie liegen, zum zweiten an dem Luhmann oft eigenen sparsamen Umgang mit Literaturbezügen.
- 13.
Am deutlichsten ausformuliert wird dieser Performativitätsgedanke bei Luhmann mit Blick auf den Beginn der Entwicklung dezidierter ökonomischer Theorien (Merkantilismus, Physiokratie, klassische politische Ökonomie), siehe dazu Pahl (2008).
Literatur
Baecker, D. 1988. Information und Risiko in der Marktwirtschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Baecker, D. 2006. Wirtschaftssoziologie. Bielefeld: Transcript.
Baecker, D. 2008. Wirtschaft als funktionales Teilsystem. In: Maurer, A. (Hrsg.), Handbuch der Wirtschaftssoziologie, S. 109–123. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.
Beckert, J. 1997. Grenzen des Marktes. Die sozialen Grundlagen wirtschaftlicher Effizienz. Frankfurt/M./New York: Campus.
Beckert, J. 2009. Wirtschaftssoziologie als Gesellschaftstheorie. In: Zeitschrift für Soziologie 38, S. 182–197.
Boldyrev, I. 2013. Economy as a Social System: Niklas Luhmannʼs Contribution and its Significance for Economics. In: American Journal of Economics and Sociology 72, S. 265–292.
Borrill, P. L., Tesfatsion, L. 2011. Agent-Based Modeling: The Right Mathematics for the Social Sciences? In: Davis, J. B., Hands, W. D. (Hrsg.), The Elgar companion to recent economic methodology, S. 228–258. Cheltenham: E. Elgar.
Deutschmann, C. 2001. Die Verheißung des absoluten Reichtums. Zur religiösen Natur des Kapitalismus. 2., überarb. Aufl. Frankfurt/M./New York: Campus-Verlag.
Esposito, E. 2010. Die Zukunft der Futures. Die Zeit des Geldes in Finanzwelt und Gesellschaft. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
Ganßmann, H. 1986. Geld – ein symbolisch generalisiertes Medium der Kommunikation? Zur Geldlehre der neueren Soziologie. In: Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 16, S. 6–22.
Giacovelli, S. 2014. Die Strombörse. Über Form und latente Funktionen des börslichen Stromhandels aus marktsoziologischer Sicht. Marburg: Metropolis.
Kaube, J. 2000. Wechselwirkungslosigkeit. In: de Berg, H., Schmidt, J. F. K. (Hrsg.), Rezeption und Reflexion. Zur Resonanz der Systemtheorie Niklas Luhmanns ausserhalb der Soziologie, S. 254–266. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Luhmann, N. 1974. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien. In: Zeitschrift für Soziologie 3, S. 236–255.
Luhmann, N. 1984. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Luhmann, N. 1987. Soziologische Aufklärung. Bd. 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Luhmann, N. 1997. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Luhmann, N. 2002. Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Luhmann, N. 2006. Organisation und Entscheidung. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.
MacKenzie, D., Muniesa, F., Siu, L. (Hrsg.). 2007. Do economists make markets? On the performativity of economics. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
Münch, R. 1994. Zahlung und Achtung. Die Interpenetration von Ökonomie und Moral. In: Zeitschrift für Soziologie 23, S. 388–411.
Pahl, H. 2008. Das Geld in der modernen Wirtschaft. Marx und Luhmann im Vergleich. Frankfurt/M.: Campus-Verlag.
Pahl, H. 2015. Die Komplexität und Dynamik wirtschaftlicher Systeme: Vermittlung, Beobachtung und agentenbasierte Modellierung. In: Scherr, A. (Hrsg.), Systemtheorie als Kritik. Perspektiven in Anschluss an Niklas Luhmann. Weinheim/München: Beltz Juventa (im Erscheinen).
Paul, A. T. 2002. Money Makes the World Go Round. Über die Dynamik des Geldes und die Grenzen der Systemtheorie. In: Berliner Journal für Soziologie 2, S. 243–262.
Parsons, T. 1967. Sociological Theory and Modern Society. New York: Free Press.
Parsons, T., Smelser, N. 1956. Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
Schimank, U. 2009. Die Moderne: eine funktional differenzierte kapitalistische Gesellschaft. In: Berliner Journal für Soziologie 3, S. 327–351.
Schwinn, T. 2010. Wirtschaftssoziologie als Gesellschaftstheorie? Kritische Anfragen aus einer Weberʼschen Perspektive. In: Maurer, A., Swedberg, R. (Hrsg.), Wirtschaftssoziologie nach Max Weber, S. 199–225. VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.
Strulik, T. 2012. Die Gesellschaft der „neuen Wirtschaftssoziologie“. Eine Replik auf Jens Beckerts Artikel „Wirtschaftssoziologie als Gesellschaftstheorie“. In: Zeitschrift für Soziologie 41, S. 58–74.
Zelizer, V. A. 1995. The social meaning of money. New York, NY: Basic Books.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2021 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH , ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Pahl, H. (2021). Niklas Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft. In: Kraemer, K., Brugger, F. (eds) Schlüsselwerke der Wirtschaftssoziologie. Wirtschaft + Gesellschaft. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31439-2_18
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31439-2_18
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-31438-5
Online ISBN: 978-3-658-31439-2
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)