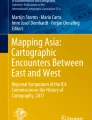Abstract
Maps are flat images of the earth‘s surface. The basis and prerequisite for their production is the relative spatial definition of the map content on the earth‘s surface, and this is usually done in the context of surveying recording processes. The particular accuracy of the portolan charts, which have passed on since the thirteenth century, suggests that these were also created on the basis of specific measurements, although details of their creation have not yet been clarified. Questions about the data base and especially about the projection of the maps have been the subject of scientific research for over 100 years (Kretschmer 1909; Campbell 2021). Here, for the first time, a method is presented that makes it possible to construct maps of the Mediterranean with simple aids (compasses and ruler) in such a way that they correspond to the accuracy and other properties of the portolan charts. A map projection is used for which there are no mapping equations, but at most a mapping description. As a surveying basis for the mapping, distances are used that have been determined with a high degree of probability since ancient times. Triangles are constructed from these lines and transferred directly to the plane without any reduction in the image. The result is a geometrically unambiguous field of support points of known ports. The missing coastal structures can be supplemented after the construction of the field of support points on the basis of traditional coastal descriptions (Portolani/Periploi).
Zusammenfassung
Karten sind ebene Abbildungen der Erdoberfläche. Grundlage und Voraussetzung für ihre Herstellung ist die relative räumliche Festlegung des Karteninhaltes auf der Erdoberfläche und diese erfolgt in aller Regel im Rahmen vermessungstechnischer Aufnahmeverfahren. Die besondere Genauigkeit der seit dem 13. Jahrhundert überlieferten Portolankarten lässt vermuten, dass auch diese auf der Grundlage konkreter Messungen entstanden sind, allerdings sind Einzelheiten ihrer Entstehung bis heute nicht geklärt. Fragen zur Datenbasis und insbesondere auch zur Abbildung der Karten sind seit über 100 Jahren (Kretschmer 1909; Campbell 2021) Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Hier soll nun erstmals ein Verfahren vorgestellt werden, das es ermöglicht, Karten des Mittelmeeres mit einfachen Hilfsmitteln (Zirkel und Maßstab) so zu konstruieren, dass sie der Genauigkeit und den sonstigen Eigenschaften der Portolankarten entsprechen. Zur Anwendung kommt dabei ein Verebnungsverfahren, für das es keine Abbildungsgleichungen gibt, sondern allenfalls eine Abbildungsbeschreibung. Als vermessungstechnische Grundlage für die Kartierung kommen dabei Strecken in Ansatz, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits seit der Antike ermittelt wurden. Aus diesen Strecken werden Dreiecke konstruiert und ohne Abbildungsreduktion direkt in die Ebene übertragen. Im Ergebnis entsteht ein geometrisch eindeutiges Stützpunktfeld für bekannte Häfen. Die noch fehlenden Küstenstrukturen können nach der Konstruktion des Stützpunktfeldes auf der Grundlage tradierter Küstenbeschreibungen (Portolani/Periploi) ergänzt werden.
Similar content being viewed by others
Avoid common mistakes on your manuscript.
1 Einleitung
Die wohl interessantesten Karten des Mittelalters sind die Portolankarten. Sie werden etwa seit dem Ende des 13. Jahrhunderts für einen Zeitraum von rund 400 Jahren überliefert und können in keiner Weise der üblichen mittelalterlichen Kartentradition zugeordnet werden. Die Portolane tauchen – soweit heute bekannt (Campbell 1987, 2021) – ohne erkennbare Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte unvermittelt auf und beschreiben mit augenscheinlicher Präzision zunächst vorwiegend die Küstenlinien des Mittelmeerraumes und des Schwarzen Meeres, später auch Teile der Atlantikküste und des Nord- und Ostseeraumes. Ihre besonderen Markenzeichen sind einmal die in allen Karten dargestellten Liniennetze (RumbenFootnote 1).
Diese entstehen durch die regelmäßige Teilung (i.d.R. 16 Teile) eines meist in der Mitte der Darstellungsfläche zentrierten großen Kreises. Die gradlinige und systematische Verbindung aller Kreisperipheriepunkte führt zu einer Linienstruktur, die das äußere Erscheinungsbild der Karten nachhaltig prägt. Dabei sind der Kreismittelpunkt und die 16 Punkte der Kreisperipherie die einzigen Punkte der Karte, die durch Nadelstiche festgelegt, also eindeutig kartiert wurden. Darüber hinaus ist aber auch die Erläuterung des Karteninhaltes kartentypisch. Sie erfolgt in Portolanen durch eine Vielzahl von Hafennamen, die i.d.R. senkrecht zur Küstenlinie landeinwärts geschrieben werden. Darüber hinaus sind alle Portolankarten, die das gesamte Mittelmeer darstellen, nach Norden ausgerichtet. Dem geübten Betrachter fällt auf, dass die Ost-West-Achse des Mittelmeeres einheitlich um einen geringen Betrag (ca. 11°) gegen den Uhrzeigersinn gedreht erscheint. Aus fachlicher Sicht faszinieren neben der Schönheit und Fülle der Darstellung insbesondere die Genauigkeit der Portolane (Abb. 1).
Portolankarte des Petrus Roselli (1449). Das Hauptliniennetz und die durch Nadelstiche definierten Punkte wurden rot gekennzeichnet. (Kartengrundlage: Faksimiledruck
2 Grundlagen der Genauigkeitsanalysen
Erste Hinweise auf die exakte Darstellung alter Karten liefert zunächst einmal der Augenschein. So fällt zum Beispiel bei der Betrachtung von Portolankarten auf, dass sie offensichtlich alle den uns bekannten (modernen) Darstellungen des Mittelmeerraumes in vielen Bereichen sehr ähnlich sehen und uns somit vertraut erscheinen. Wir vergleichen sie also mit modernen Abbildungen der Erdoberfläche und vermuten somit, dass sie – wie diese – wissenschaftlich exakt konstruiert wurden und die dargestellten Regionen lagertreu wiedergegeben werden. Aus der Vermutung wird Gewissheit, wenn es gelingt, auf grafischem oder aber kartometrischem bzw. numerischem Wege den Nachweis für die Richtigkeit der Darstellung in der alten Karte zu erbringen.
2.1 Grafische Analyse – bisherige Ergebnisse
Die erstaunliche Ähnlichkeit der Küstendarstellung in Portolankarten legt die Vermutung nahe, dass sie möglicherweise einen gemeinsamen geodätischen Ursprung besitzen, d. h. dass sie nach einer gemeinsamen Abbildungsvorschrift und unter Verwendung gleicher Daten und Informationen konstruiert wurden. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden im Jahre 1988 für eine repräsentative Auswahl von Portolankarten alle Küstenlinien und auch die Grundstrukturen der individuellen Rumbensysteme jeweils auf eine transparente Folie hochgezeichnet, anschließend auf fotografischem Wege auf einen einheitlichen Maßstab gebracht und zusammen kopiert (Mesenburg 1990a). Das Ergebnis ist aus Abb. 2 ersichtlich: Die Zusammenkopie von insgesamt 15 Portolankarten (grau), die den Zeitraum von 1310–1662 abdecken, führt zu einem schmalen Küstenband im Mittelmeerbereich und im Bereich des Schwarzen Meeres, sodass eine geometrische Verwandtschaft dieser Karten ohne Zweifel als nachgewiesen gelten kann. Zwar gibt es individuelle Abweichungen bei der Wiedergabe des detaillierten Küstenverlaufes, in der Summe geben jedoch alle Portolane das Ausdehnungsverhältnis des Mittelmeerraumes und auch die Lage des Schwarzen Meeres richtig wieder.
Die Darstellungen West- und insbesondere Nordeuropas weisen kaum noch Übereinstimmungen auf, wie aus dem Liniengewirr im nordwestlichen Teil der Abbildung ersichtlich ist. Zusätzlich zu den Küstenlinien der Portolane wurde in schwarzer Farbe auch noch die heutige, aktuelle Küstenlinie dargestellt. Sie wurde aus der optimierten Abbildung der Karte des Iehuda Ben Zara (1497) abgeleitet (siehe 2.2. Numerische Analyse - bisherige Ergebnisse). Betrachtet man die individuellen Rumbensysteme, so fällt auf, dass diese alle unterschiedlich gelagert sind und somit nicht als einheitliche Konstruktionsbasis infrage kommen können – dies gilt zumindest für die bislang untersuchten Karten.
2.2 Numerische Analyse – bisherige Ergebnisse
Ein erster möglicher Schritt zur kartometrischen Untersuchung einer Portolankarte wäre das Ausmessen der Entfernung zwischen zwei dargestellten und bekannten Städten in der Karte (s´). Der Vergleich mit der realen Entfernung (Orthodrome) zwischen diesen Städten (S) führt dann zu einem ersten Maßstab der alten Karte (m = S/s´). Wird dieser Vorgang in vielen Bereichen der Karte wiederholt, so resultiert eine entsprechende Anzahl von Maßstabszahlen, die sich im günstigsten Falle zu einem arithmetischen Mittel zusammenfassen lassen und anschließend auch die Ableitung von gemittelten Streckendifferenzen und erste Aussagen zur Genauigkeit der alten Karte erlauben. Bei Betrachtungen dieser Art bleibt naturgemäß die Abbildungseigenschaft der alten Karte, die durchaus auch zu erheblichen Streckenverzerrungen beitragen kann, außer Betracht.
Zur Vermeidung der Nichtberücksichtigung abbildungstypischer Streckenverzerrungen bei der Genauigkeitsuntersuchung alter Karten wurde im Fachbereich Vermessungswesen der Universität Duisburg-Essen bereits im Jahre 1984 ein Programmsystem entwickelt, das es erlaubt, die Genauigkeit von Portolankarten flächendeckend und weitgehend hypothesenfrei zu bestimmen.
Ausgangspunkt des Verfahrens ist die Definition von „identischen Punkten“, die nach Möglichkeit alle Bereiche der alten Karte erfassen sollten. Es sind dies Punkte, die in der Portolankarte dargestellt sind und bezüglich ihrer Lage auch in modernen Karten eindeutig identifiziert werden können. Für die „identischen Punkte“ werden zunächst geografischen Koordinaten ermittelt. Nach Vorgabe einer Abbildungsfläche, der Lage der Abbildungsfläche und der Abbildungseigenschaft werden sie dann in die Ebene abgebildet. Im weiteren Verlauf des Verfahrens werden die verebneten Bildkoordinaten der „identischen Punkte“ mit den digitalisierten Punkten der Portolankarte über eine ausgleichende Koordinatentransformation verknüpft. Im Ergebnis erhält man Restklaffungen, die als objektives mathematisches Kriterium zur Beurteilung der gewählten kartografischen Abbildung angesehen werden können, da sie in gewissem Sinne Auskunft geben über die geometrische Übereinstimmung beider Punkthaufen. Durch systematische und schrittweise Änderung der ursprünglichen Abbildungsparameter ergeben sich weitere Restklaffungen. Diejenigen Abbildungsparameter, bei denen nach einer ausgleichenden Koordinatentransformation die kleinsten Restklaffungen verbleiben, können als optimal angesehen werden. Aus diesen Abbildungsparametern resultieren die Standardabweichung der alten Karte sowie die Abbildungsfläche, die Lage der Abbildungsfläche und auch die Eigenschaft der optimierten Referenzabbildung.
Die Daten der Referenzabbildung ermöglichen anschließend die grafische Ausgabe der aktuellen Küstenlinie des Mittelmeeres in optimierter Form und auch deren visuelle Vereinigung mit der Portolankarte (Abb. 3). Sie vermag das numerische Ergebnis der Untersuchung beeindruckend zu verdeutlichen.
Portolankarte des Petrus Roselli (1449) mit optimierter Küstenlinie (Kartengrundlage: Faksimiledruck
Zur Interpretation des eigentlichen Herstellungsprozesses der Portolane sind die Daten der optimierten Referenzabbildung nur bedingt geeignet, da die Berechnung der Abbildungskoordinaten eine Vielzahl von Stützpunkten voraussetzen würde, deren geografische Koordinaten mit entsprechender Genauigkeit bekannt gewesen sein müssten. Darüber hinaus wäre wohl auch die Berechnung schiefachsiger kartografischer Abbildungen (als Ergebnis bisheriger Optimierungen) zum Zeitpunkt der Entstehung der Portolane noch nicht möglich gewesen.
Erste konkrete Zahlenangaben zur Genauigkeit von Portolankarten wurden im Jahre 1986 im Rahmen des 3. Kartographiehistorischen Kolloquiums in Wien vorgetragen und 1987 veröffentlicht (Mesenburg 1987). Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die Karte des Iehuda Ben Zara (1497). Auf der Basis von 129 identischen Punkten wurde als Standardabweichung für das Zentrum des Liniennetzes der Karte ein Wert von ± 40 km ermittelt.
Eine weitere Untersuchung (Mesenburg 1990b), die im Rahmen des 4. Kartographiehistorischen Kolloquiums vorgetragen wurde, führte auf der Basis von 346 Punkten für die Karte des Petrus Roselli (1449) zu einer Standardabweichung von ± 48 km. Aus beiden Untersuchungen konnten relativ sicher auch die Eigenschaften der beiden Karten als jeweils winkeltreue Abbildung ermittelt werden. Über die Abbildungsfläche und somit auch über die Kernfrage, wie denn die Portolankarten konkret konstruiert wurden, konnte bislang – auch im Rahmen weiterer Untersuchungen – keine sichere Aussage getroffen werden.
Fasst man die bisherigen Ergebnisse der Essener Untersuchungen zusammen, so bleiben folgende Erkenntnisse festzuhalten, die offensichtlich für alle Portolane gelten:
-
Die Rumbensysteme der Portolankarten sind kreisbasiert (Nadelstiche). Sie erlauben u. a. die Bestimmung des Pergamentverzuges.
-
Alle untersuchten Portolane sind geometrisch verwandt. Die Ausgestaltung der Küstenlinien deutet auf eine gemeinsame Datenbasis und auf einheitliche Abbildungsgegebenheiten hin.
-
Die Genauigkeit der Küstendarstellung liegt bei etwa ± 40–50 km. Durch Vergleich der Portolandarstellung mit der aktuellen Küstenlinie wird dieses Ergebnis auch grafisch eindrucksvoll bestätigt (Abb. 3).
-
Den Portolanen liegen offensichtlich Abbildungen zugrunde, die näherungsweise winkeltreu sind, wobei die Ermittlung der jeweils optimierten Abbildungsflächen und deren Hauptpunktlage in den verschiedenen Karten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und keine Rückschlüsse auf konkrete Kartierungsmodalitäten zulassen.
Nicht geklärt sind also bislang die Fragen.
-
der Abbildung und Konstruktion der Portolane,
-
der Bedeutung der Orientierungsabweichung und
-
der vollständigen Einsatzmöglichkeiten des Rumbensystems.
3 Datenquellen des 13. Jahrhunderts
Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass Portolankarten offensichtlich keine kartografischen Abbildungen im herkömmlichen Sinne sind, dass sie aber dennoch einen gemeinsamen geodätischen Ursprung besitzen, d. h., dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einer gemeinsamen Abbildungsvorschrift und unter Verwendung gleicher Daten und Informationen konstruiert wurden. Es stellt sich also die Frage, welche Datenquellen der realen Konstruktion von Portolankarten zugrunde liegen könnten.
In erster Linie kommen hierfür wohl die „Portolani“ oder „Periploi“ in Betracht. Dies sind Segelhandbücher, die seit Beginn des 13. Jahrhunderts überliefert sind. Sie beschreiben die gesamte Küste des Mittelmeeres und enthalten dabei u. a. auch die Entfernungen und Richtungen zwischen benachbarten Häfen. Zusätzlich zu den Küstenstrecken werden zudem Hochseekurse über weite Entfernungen aufgeführt, sodass aufgrund der Beschreibung auch großräumige geografische Verhältnisse deutlich werden. Die heute bekannten ältesten Schiffshandbücher sind die Veröffentlichung des „Compasso de Navegare“ von B. R. Motzo aus dem Jahre 1947 (Motzo 1947), das von P.G. Dalché ins Französische übersetzte Buch „Le Liber de Existencia Riveriarum et Forma Maris Nostri Mediterranei“ (Dalché 1995) und das von Chr. Weitemeyer ins Deutsche übertragene Buch „Compasso de Navegare“ (Weitemeyer 1996). Vom „Compasso de Navegare “ ist im Jahr 2011 auch eine italienische Fassung erschienen (Debanne 2011).
Auf der Grundlage der Strecken- und Richtungsangaben im „Compasso“ hat Lanman (1985) bereits 1985 versucht, die Küstenlinie des Mittelmeeres zu rekonstruieren, wobei er benachbarte Häfen als Stützpunkte eines Bussolenzuges betrachtete. Erstaunlicherweise kam er dabei zu einer geschlossenen Darstellung des Mittelmeeres, die einerseits der Portolankartendarstellung relativ nahe kommt (Abb. 4), die andererseits aber theoretisch und praktisch aufgrund einer solchen Konstruktion nicht möglich ist, da die einfache Verebnung der auf der Erdoberfläche gemessenen Strecken und Winkel ohne Berücksichtigung der Erdkrümmung nicht zu einer geschlossenen Darstellung des Mittelmeeres führen kann (Abb. 5).

aus den Angaben des „Compasso de Navigare“ (Lanman 1985)
Karte des Mittelmeeres

aus Bussolenzugkoordinaten (Rohen, 2002, S. 69). Die Abweichung in Ost-West-Richtung beträgt 307 km
Unmittelbare Verebnung der näherungsweise erfassten Küstenlinien des Mittelmeeres
Anhand fiktiver Daten zur groben Beschreibung des Küstenverlaufs des Mittelmeeres soll dies in der Abb. 5 (Rohen 2002) verdeutlicht werden: Berechnet und direkt verebnet dargestellt wurden die Koordinaten zweier Bussolenzüge, von denen einer – ausgehend von Gibraltar – näherungsweise die nördliche Küstenlinie des Mittelmeeres beschreibt, der zweite – ebenfalls ausgehend von Gibraltar – beschreibt den südlichen Verlauf. Für beide Züge wurden exakte Entfernungen und Richtungen vorgegeben. Im Ergebnis wird deutlich, dass die direkte Verebnung nicht zu einer geschlossenen Darstellung führt. Während die Lageabweichung der beiden Endpunkte in Nord-Süd-Richtungen nur 7 km beträgt, liegt die Differenz in Ost-West-Richtung bei beträchtlichen 307 km.
Der Grund für die somit fehlerhafte Darstellung Lanmans ist wahrscheinlich darin zu sehen, dass er von den vorgegebenen 426 Richtungen und Entfernungen des „Compasso de Navegare“ zur Beschreibung der geschlossenen Küstenlinie 14 offensichtlich falsche Angaben nicht verwertet hat und diese auf Basis anderer Angaben im „Compasso“ korrigiert hat. Aufgrund der überlieferten Datenlage liegt es zwar nahe, den Küstenverlauf des Mittelmeeres unter Verwendung von Strecken und Richtungen direkt zu kartieren, ein solches Vorgehen kann allerdings – wie gezeigt wurde – bei der großflächigen kartografischen Verebnung der Erdoberfläche nicht zum Erfolg führen. Anders verhält es sich bei der Kartierung kleinerer Gebiete. Hier kann die direkte Kartierung der gemessenen Werte durchaus zu plausiblen Ergebnissen führen.
Der „Compasso de Navegare“ enthält insgesamt etwa 1300 Kurse, die durch Angabe der Distanz in Meilen (1 Meile = 1,23 km) und durch die zugehörige Richtung (wahrscheinlich von magnetisch Nord aus im Uhrzeigersinn gemessen) definiert werden. Von diesen beschreiben ca. 1000 Kurse den Küstenverlauf des Mittelmeeres und der Mittelmeerinseln, ca. 300 Kurse verlaufen über offenes Meer, wobei die Entfernungen der Hochseekurse häufig mehrere 100 Meilen betragen. Insbesondere die im „Compasso“ enthaltenen Hochseekurse (Abb. 6) verdeutlichen die Lage der einzelnen Orte über große Entfernungen im Raum und bieten somit die Möglichkeit, diese ggf. auch über Dreiecksstrukturen zu erfassen und auf einfache Weise abzubilden.
Nachfolgend soll also erstmals in diesem Zusammenhang ein Verfahren vorgestellt werden, das es ermöglicht, Karten des Mittelmeeres mit einfachen Hilfsmitteln zu konstruieren. Zur Anwendung kommt dabei ein Verebnungsverfahren, für das es keine Abbildungsgleichungen gibt, sondern allenfalls eine Abbildungsbeschreibung. Als Grundlage für die Kartierung kommen dabei ausschließlich Strecken in Ansatz, aus denen zunächst Dreiecke konstruiert werden. Ohne Abbildungsreduktion repräsentieren diese Dreiecke dann den durch sie begrenzten Teil der (gekrümmten) Erdoberfläche in der Kartenebene (Abb. 7).
Kreisschnittmethode (Imhof 1964, S. 132)
4 Kartierung mittels Zirkelschlag
4.1 Ansatz
Grundlage der nachfolgenden Betrachtungen ist die spätestens seit Euklid (um 300 v. Chr.) überlieferte Erkenntnis, dass ein Dreieck durch drei Seiten eindeutig bestimmt wird. Die hieraus entwickelte Methode zur Herstellung von Karten gilt nach Imhof (Imhof 1964) als ältestes Kartierverfahren und wurde – nach heutigem Kenntnisstand – wohl erstmals von Sebastian Schmid im Jahre 1566 (Schmid 121566, 1996) auch praktisch beschrieben. Dabei werden die Zentren A und B zweier Städte, deren Entfernung bekannt ist, in einem vorgegebenen Maßstab auf ein Blatt Papier gezeichnet. Dann wird die Entfernung von A nach einer dritten Stadt C in den Zirkel genommen und um A ein Kreis geschlagen. Das gleiche geschieht von B aus mit der Entfernung BC. Einer der beiden Kreisschnittpunkte ergibt die Lage von C. Zur eindeutigen Wahl des Schnittpunktes ist zudem noch die (ggf. auch grobe) Richtung mindestens einer der beiden Strecken AC oder BC notwendig.
In gleicher Weise lassen sich weitere Punkte, deren jeweilige Entfernungen von A und von B bekannt sind, von der Basis AB kartieren. Im weiteren Verlauf der Kartierung können auch die konstruierten Dreieckseiten (z. B. BC oder AC) als Basisstrecken zur Bestimmung weiter entfernt liegender Punkte verwendet werden, sodass auf der Grundlage der „Kreisschnittmethode“ letztlich ausgewählte Städte auch eines größeren Gebietes geometrisch exakt dargestellt werden können. Diese mögen dann als Stützpunkte für eine detaillierte Kartierung z. B. der Wege und Gewässer bzw. bei Portolankarten der Küstenlinien und Inseln dienen.
Eine analoge Anwendung dieses Verfahrens auf die Darstellung des gesamten Mittelmeeres ist zwar vorstellbar, allerdings ist bei einer Abbildungsfläche von ca. 1800 km × 3700 km nicht absehbar, ob eine grafische Konstruktion dieser Art tatsächlich auch zu einem plausiblen Ergebnis führen kann. Zwar wird man durch die Aufteilung der Mittelmeerregion in Dreiecke das gesamte Gebiet geschlossen darstellen können, aber da in jedem einzelnen Dreieck die Krümmung der Erde vernachlässigt wird, können à priori keine Angaben über die Auswirkungen der damit verbundenen Lageverschiebungen gemacht werden und somit auch keine Angaben über die zu erwartende Genauigkeit der Darstellung und auch keine Angaben über die Eigenschaft der dabei entstehenden Karte. Nachfolgend sollen diese Fragen experimentell geklärt werden.
4.2 Kartierung des Mittelmeergebietes
Ausgangspunkt der Untersuchung sind Dreiecke, deren Eckpunkte durch bekannte Häfen im Mittelmeer definiert sind. Die Eckpunkte stellen Stützpunkte einer nachfolgenden Kartierung dar, die es später ermöglichen soll, den detaillierten Verlauf der Küstenlinien möglichst exakt (z. B. per Polarkartierung) in das Stützpunktfeld einzupassen. Folglich gilt es also zunächst einmal, solche Häfen auszusuchen, die nach Möglichkeit die gesamte Mittelmeerregion repräsentieren und über die seit alters her regelmäßiger Warenaustausch gepflegt wurde, mit der Folge, dass die Entfernungen zwischen den Häfen insofern als bekannt vorausgesetzt werden können. Verbindet man die Häfen miteinander, so entsteht ein Dreiecksnetz, das sich bei bekannten Seitenlängen in einem vorgegebenen Maßstab auch ohne weiteres als ebenes Netz kartieren lässt (Abb. 8).
Zur Ermittlung der Kartiermaße wurden zunächst die fehlerfreien Distanzen zwischen den ausgewählten Häfen (Orthodrome als Längen der Dreieckseiten) über Google Earth ermittelt, in ausgewählten Bereichen durch gesonderte Berechnungen kontrolliert und in den Maßstab der vorgesehenen Kartierung (1:14 Mio. bzw. 1:6,5 Mio.) umgerechnet. Anschließend erfolgte die manuelle Kartierung der Dreieckspunkte mit Zirkel, Lineal und Transversalmaßstab auf weißem Karton. Da zur Konstruktion der Dreiecke quasi fehlerfreie Distanzen eingeführt wurden, ist die so entstandene Karte ausschließlich mit Kartierfehlern und den Fehlern der Abbildungsmethode belastet und erlaubt somit Rückschlüsse bezüglich der Genauigkeit der Darstellung und ggf. auch bezüglich der Eigenschaft der gewählten Konstruktion.
Zur Kontrolle des Verfahrens und auch zur Untersuchung der Orientierungsabweichung wurde das Dreiecksnetz insgesamt dreimal manuell kartiert, wobei bei wechselndem Maßstab jeweils eine andere Dreieckseite als Ausgangsbasis (parallel zum unteren Blattrand) angenommen wurde.
Ausgangsbasis der ersten Kartierung war die Strecke zwischen den Häfen Algier und Tunis (640 km – in Abb. 8grüne Darstellung). Im Maßstab 1:14 Mio. wurde zunächst der nördlich der Basis liegende Hafen von Cagliari kartiert, wobei die Entfernungen zwischen Algier-Cagliari (600 km) und Tunis-Cagliari (286 km) als bekannt vorausgesetzt wurden. Die Dreieckseiten Algier-Cagliari und Tunis-Cagliari bildeten dann Basen für weitere Punktbestimmungen, sodass auf diese Weise letztlich die Lage von 41 Mittelmeerhäfen kartiert werden konnten. Die so entstandene Stützpunktkarte wurde anschließend gescannt und als „alte Karte“ in das Programm MapAnalyst eingelesen und analysiert.
In gleicher Weise wurden zwei weitere Kartierungen gefertigt und analysiert, wobei als Ausgangsbasis einmal die Strecke zwischen Tripolis und Apollonia (820 km – in Abb. 8rote Darstellung) angenommen, parallel zum unteren Blattrand gelagert und im Maßstab 1:14 Mio. kartiert wurde. Nachfolgend erfolgte noch eine dritte Kartierung – diesmal im Maßstab 1:6,5 Mio. – wobei die Strecke zwischen Cagliari und Messina (600 km – in Abb. 8blaue Darstellung) als Basis definiert wurde. Die Ergebnisse der einzelnen Genauigkeitsanalysen sind in der Tab. 1 zusammengestellt.
5 Genauigkeitsanalyse mit MapAnalyst
Die Genauigkeit von Karten und manuellen Kartierungen lässt sich dann ermitteln, wenn von dem dargestellten Gebiet aktuelle Karten gleichen Inhalts existieren, die in Relation zu der zu untersuchenden Darstellung als fehlerfrei angesehen werden können. Im konkreten Falle kann die Genauigkeit der manuellen Kartierung über einen geometrischen Vergleich der Lage der Dreieckspunkte mit entsprechenden Punkten einer aktuellen Karte (identische Punkte) bestimmt werden.
Als Programm zur Durchführung der Genauigkeitsanalyse wurde das seit vielen Jahren als OpenSource-Software von Jenny und Weber entwickelte Programm MapAnalystFootnote 2 in der Version 1.3.34 eingesetzt, das in den vergangenen Jahren von Bernhard Jenny weiterentwickelt wurde und bislang vorwiegend bei der Untersuchung kleinmaßstäbiger Karten zur Anwendung kam.
Eine Kartenanalyse mit „MapAnalyst“ beginnt mit dem Einlesen der gescannten Kartierung. Als Referenzkarte wird die OpenStreetMap (OSM), eine frei nutzbare Weltkarte, automatisch angezeigt. Der Benutzer der Software bestimmt sodann korrespondierende Orte (Häfen) in den beiden auf dem Bildschirm angezeigten Karten und platziert dort Punktpaare (Abb. 9).
Im Folgenden werden die Transformationsparameter für die geplante Genauigkeitsuntersuchung (hier: 4-Parameter-Transformation, robuste Schätzung nach Huber) gewählt. Die anschließende ausgleichende Koordinatentransformation ermöglicht die Ableitung des Maßstabes der Kartierung, der Standardabweichung der Dreieckspunkte, des Drehwinkels zwischen den verglichenen Koordinatensystemen und auch die Visualisierung der einzelnen Fehlervektoren (Abb. 10).
Darüber hinaus sind auch die Berechnung von Verzerrungsgittern und die Ableitung von Linien gleicher Verzerrung (Isodeformaten) möglich. Alle Berechnungen und Visualisierungen benötigen normalerweise nur wenige Sekunden, sodass durch das Programm MapAnalyst auch eine iterative Analyse ermöglicht wird.
Die detaillierten Ergebnisse der durchgeführten Genauigkeitsanalysen sind in der Tab. 1 dargestellt. Die Lage der jeweils gewählten Ausgangsbasis geht aus Abb. 8 hervor. Überraschenderweise führt die zur Darstellung des Mittelmeeres gewählte Abbildungsmethode der Kartierung mittels Zirkelschlag („Kreisschnittmethode“) zu überaus bemerkenswerten Ergebnissen: Die Standardabweichung der manuell konstruierten Häfen liegt zwischen ± 5 km und ± 12 km. Vergleicht man sie mit der Standardabweichung der Portolankarten, für die etwa ± 40 km bis ± 50 km ermittelt wurden, dann wird deutlich, dass dieses älteste Kartierungsverfahren durchaus auch Konstruktionsgrundlage der Portolane sein könnte.
Dafür spricht, dass es eine sehr einfache Methode zur Herstellung einer Karte ist, die gewiss auch zum Zeitpunkt der Entstehung der Portolankarten beherrscht wurde. Und auch die im „Compasso de Navegare“ überlieferten Daten und dabei insbesondere die darin enthaltenen Hochseekurse über weite Entfernungen sollten eine entsprechende Konstruktion ermöglichen. Naturgemäß sind diese Angaben mit Fehlern behaftet, die dementsprechend auch zu einer höheren Standardabweichung der gesamten Karte beitragen würden. Durch erste praktische Untersuchungen mit Compassodaten konnte die als Vermutung formulierte Vorgehensweise der Kartierung mittels Zirkelschlag bereits vorläufig bestätigt werden.
Deutlich wird auch, dass die Orientierung der manuell konstruierten Stützpunktkarte von der Lage der Ausgangsbasis zu Beginn der Kartierung abhängt. Je nach Wahl der Lage der ersten Dreieckseite ändert sich auch die Orientierung der Karte. Legt man die Basis „Cagliari – Messina“ parallel zum unteren Blattrand, so resultiert ein Wert von −13°. Dies bedeutet, dass eine eventuelle Missweisung der Kompassrichtung, die schon häufig Gegenstand fachlicher Erörterungen war (Kretschmer 1909), auf die Orientierung der Portolane keinen Einfluss hat.
Zur Bestimmung der Genauigkeit der manuell kartierten Stützpunktkarte wurden die Koordinaten dieser Karte mit entsprechenden Koordinaten der OpenStreetMap, einer modifizierten Mercatorabbildung, verglichen. Die Daten der Vergleichskarte liegen also in konformer transversaler Zylinderabbildung (UTM-Koordinaten) vor. Folglich lassen die ermittelten, relativ geringen Standardabweichungen den Schluss zu, dass die Stützpunktkarte auch ähnliche Eigenschaften hat wie die Vergleichskarte, also näherungsweise winkeltreu ist. Dies schließt nicht aus, dass die untersuchte Karte auch näherungsweise flächentreu ist, da nach dem Satz von Legendre sphärische Dreiecke mit kleinen Seiten nahezu gleiche Flächeninhalte haben wie ebene Dreiecke mit gleichen Seitenlängen.
6 Zusammenfassung
Die beeindruckende und bislang noch unerklärliche Genauigkeit der Portolankarten war schon häufig Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen (Minow 1998). Auf der Grundlage bisheriger Untersuchungen wird erstmals ein Abbildungsverfahren vorgestellt, das es ggf. ermöglicht, die noch offenen Fragen zur Abbildungsmethode, zur Eigenschaft und zur Orientierung der Portolankarten zu klären. Am Beispiel einer manuellen Kartierung per Zirkelschlag von ausgewählten Häfen (Küstenstützpunkte) des Mittelmeeres wird nachgewiesen, dass Portolankarten durchaus auf der Grundlage des ältesten Kartierverfahrens, der von Imhof so bezeichneten „Kreisschnittmethode“, konstruiert werden konnten. Für diese Methode spricht, dass auch die im „Compasso de Navegare“ überlieferten Daten und dabei insbesondere die darin enthaltenen Hochseekurse über weite Entfernungen eine entsprechende Konstruktion ermöglichen.
Die Genauigkeitsanalyse der manuellen Stützpunktkartierung erfolgte mit MapAnalyst. Die dabei erzielte, bemerkenswert geringe Standardabweichung bezieht sich auf eine Abbildungsfläche von ca. 1800 km × 3700 km. Sie liegt zwischen ± 5 km und ± 12 km und bestätigt damit den möglichen Einsatz bei der Konstruktion einer Karte, deren Standardabweichung real mit ± 40 km bis ± 50 km bestimmt wurde.
Deutlich wird auch, dass die Orientierung der manuell konstruierten Stützpunktkarte von der Lage der Ausgangsbasis zu Beginn der Kartierung abhängt. Dies würde im konkreten Falle bedeuten, dass eine eventuelle Missweisung der Kompassrichtung auf die Orientierung der Portolane keinen Einfluss hat.
Die ermittelte Standardabweichung der Stützpunktkarte lässt darüber hinaus den Schluss zu, dass diese auch ähnliche Eigenschaften wie die Vergleichskarte hat. Dementsprechend läge den Portolanen keine winkeltreue Zylinderabbildung zugrunde, aber immerhin eine Abbildung, die näherungsweise winkeltreu ist.
Zur manuellen Kartierung einer Stützpunktkarte des Mittelmeeres per Zirkelschlag ist das in allen Portolankarten integrierte Rumbensystem nicht erforderlich. Insofern bleibt auch nach dieser Untersuchung die Frage nach dem eigentlichen Sinn dieses Liniensystems, das mit Zirkel und Lineal per (nachgewiesener) Kartierung aufwendig konstruiert wurde, weiterhin nicht vollständig geklärt. Einerseits hat das Rumbensystem (als in die Karte integrierter Winkeltransporteur) die Kursbestimmung auf See sicherlich wesentlich erleichtert. Andererseits kann man davon ausgehen, dass Portolankarten für den praktischen Gebrauch auf See nicht als Unikate gefertigt worden sind, sondern in zahlreichen Exemplaren gebraucht wurden – nach Weitemeyer (1996, S. 20) wurde es im Jahre 1354 den Kapitänen in Spanien verboten, ohne mindestens zwei Karten an Bord auszufahren. Somit bleibt die Frage, wie die Portolane möglicherweise vervielfältigt wurden. Aufgrund seiner geometrischen Struktur wäre das Rumbensystem als Gerüst für eine manuelle Kopie der Karten wahrlich gut geeignet. Allerdings hätte dies zur Voraussetzung, dass die Liniennetze in allen Kartenkopien gleich gelagert wären (Abb. 2). Karten mit gleich gelagerten, identischen Rumbensystemen sind dem Autor aber bislang nicht bekannt – was nicht ausschließt, dass es sie dennoch gibt bzw. gegeben haben könnte, da der größte Teil der gefertigten Karten sicherlich durch Gebrauch auf See verschlissen wurde und daher nicht mehr erhalten ist.
7 Ausblick
Auf der Grundlage der im „Compasso de Navigare“ überlieferten Daten käme nach aktuellen Erkenntnissen als Kartierverfahren zur Herstellung der Portolane eine großräumige Stützpunktkartierung nach Dreiecksvermaschung per Zirkelschlag infrage, wobei der detaillierte Küstenverlauf durch Polarkartierung der Küstendaten (Lanman 1985) auf der Grundlage der vorweg kartierten Stützpunkte eingepasst werden könnte.
Nachdem das Grundprinzip des sehr einfachen Kartierverfahrens per Zirkelschlag sich als tragfähig erwiesen hat und auch in ersten Analysen mit Daten aus dem „Compasso de navigare“ bereits bestätigt werden konnte, sollten die bislang erzielten Resultate zusätzlich durch konkrete Fehleranalysen der dort enthaltenen Messungsergebnisse bestätigt werden. Darüber hinaus bleibt generell zu erwägen, ob das Verfahren der Kartierung per Zirkelschlag nicht bereits wesentlich häufiger als bislang angenommen zur Konstruktion alter Karten Anwendung fand, z. B. dann, wenn als Datengrundlage zur Konstruktion der Karten vorwiegend Wegebeschreibungen (Itinerarien) zur Verfügung standen.
Notes
Für die Liniennetze der Portolankarten ist in der einschlägigen Literatur auch der Begriff Rumbe bzw. Rumbensystem gebräuchlich. Obwohl mit dem englischen Begriff „rhumb line“ eigentlich eine Loxodrome bezeichnet wird, wurde er auch als Bezeichnung für das Liniensystem der Portolane beibehalten.
Literaturverzeichnis
Campbell T (1987) Charts from the late thirteenth century to 1500. In: Harley JB, Woodward D (eds) The history of cartography, (vol 1). The University of Chicago Press, pp 371–463
Campbell T (2021) Mediterranean portolan charts, their origin in the mental maps of medieval sailors, their function and their early development, WWW-virtual Library: map history/history of cartography: the gateway to the subject. https://www.maphistory.info/PortolanOriginsTEXT.html. Accessed 22 May 2021
Dalché PG (1995) Carte Marine et Portulan au XIIe Siècle. Le Liber de Existencia Riveriarum et Forma Maris Nostri Mediterranei (Pise, circa 1200). Ecole Franϛaise de Rome
Debanne A (2011) Lo Compasso de navegare – Edizione del codice Hamilton 396 con commento linguistico e glossario. P.I.E. Peter Lang, Bruxelles
Imhof E (1964) Beiträge zur Geschichte der Kartografie. In: Imhof E (ed) Internationales Jahrbuch für Kartografie, 1964. Bertelsmann Verlag, Gütersloh, pp 129–150
Kretschmer K (1909) Die italienischen Portulane des Mittelalters. Springer, Berlin
Lanman JT (1985) On the origin of Portolan charts. In: Paper at the 11th international conference on the history of cartography, Ottawa
Mesenburg P (1987) Rechnergestützte Analyse zum kartographischen und geodätischen Informationsgehalt von Portolankarten. In: Scharfe W, Kretschmar I (eds) Kartographiehistorisches Colloquium Wien 1986. Reimer Verlag, Berlin, pp 57–67
Mesenburg P (1990a) Numerische und graphische Analysen zur geometrischen Struktur von Portolankarten. In: Meine KH (ed) Internationales Jahrbuch für Kartographie 1988. Reimer Verlag, Berlin, pp 73–82
Mesenburg P (1990b) Untersuchungen zur geometrischen Struktur und zur Genese der Portolankarte des Petrus Roselli aus dem Jahre 1449. In: Kartographiehistorisches Colloquium Karlsruhe 1988, H. Musall, J. Neumann und W. Scharfe (Eds.), Reimer Verlag, Berlin, S.31–38
Minow H (1998) Rätsel der mittelalterlichen Seekarten. Deutsches Schiffahrtsarchiv 21:411–428
Motzo BR (1947) Compasso da Navigare, opera Italiana della metà del secolo XIII. Universita Cagliari
Portolankarte des Petrus Roselli aus dem Jahre 1449. In: Musall H, Neumann J, Scharfe W (Hrsg) Kartographiehistorisches Colloquium Karlsruhe 1988, Reimer Verlag, Berlin, S 31–38
Rohen A (2002) Untersuchungen zur Genauigkeit und zur Genese von Portolankarten. Diplomarbeit im FB Vermessungswesen der Universität Duisburg-Essen, Unveröff
Schmid S (1996) Chorographia et Topographia, 1566. In: Faksimile A, Dürst A (eds) Verlag Cartographica Helvetica. Murten
Weitemeyer C (1996) Compasso de navegare – Erstes Seehandbuch Mittelmeer aus dem 13: Jahrhundert/aus der altitalienischen in die deutsche Sprache übertragen und mit einer Einführung versehen. Betzel Verlag, Nienburg
Acknowledgements
Inhalt und Ergebnisse des vorliegenden Beitrags wurden erstmals im Rahmen des Kartographiehistorischen Colloquiums in Gotha am 11.10.2018 vorgestellt. Besonderer Dank gilt dem Leiter der Kommission „Geschichte der Kartographie“ der Deutschen Gesellschaft für Kartographie, Herrn Dr. Markus Heinz für seine freundliche Unterstützung der Veröffentlichung in den KN.
Funding
Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Ethics declarations
Erklärungen
Der Autor erklärt, dass es keine Interessenkonflikte gibt.
Rights and permissions
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
About this article
Cite this article
Mesenburg, P. Portolankarten – Aufnahme und Abbildung. KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 195–206 (2021). https://doi.org/10.1007/s42489-021-00081-4
Received:
Accepted:
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s42489-021-00081-4
Keywords
- Portolan charts
- Surveying
- Cartographic projection
- Accuracy analysis
- Compasso de navegare
- Mapping using a compass