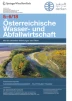Zusammenfassung
Kosten-Nutzen-Analysen im Hochwassermanagement verwenden zur Beurteilung von Schutzkonzepten meist den physischen Schaden als Hauptkriterium. Dies kann zu einer ungleichen räumlichen Entwicklung führen, da in strukturschwachen Gemeinden meist weit geringere monetäre Werte gefährdet sind als in verdichteten Siedlungszentren. Der folgende Beitrag zeigt den Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und Kosten-Nutzen-Analyse und schlägt vor, wie strukturschwache Gemeinden besser in einem neuen Konzept der Kosten-Nutzen-Analyse abgebildet werden könnten, indem im Entscheidungsprozess soziale und psychologische Merkmale der Betroffenen mitberücksichtigt werden. Diese Erweiterung führt dazu, dass insbesondere Gemeinden in strukturschwachen Gebieten die Möglichkeit haben, einen Hochwasserschutz rascher umzusetzen. Mit diesem Beitrag möchten wir nicht nur die Bedeutung der sozialen und psychologischen Indikatoren im Hochwassermanagement aufzeigen, sondern auch, wie der Entscheidungsprozess in Zukunft gerechter gestaltet werden kann.
Abstract
Decision-making processes in flood risk management highly rely on cost-benefit assessment. Cost-benefit analyses usually use the physical damage as the main proxy for evaluating the implementation of structural and non-structural flood protection schemes. Consequently, this approach might increase the social inequality within a country as structurally weak municipalities usually show lower physical damages in comparison to urban municipalities. The following paper shows the connection between social justice and cost-benefit analyses and presents a possible approach of how structurally weak municipalities could be better represented in the decision-making process in flood risk management by taking into account social and psychological parameters. This extension leads to the result that especially municipalities in structurally weak areas can implement flood alleviation schemes as these municipalities suffer more from flood events in comparison to high-income municipalities and households. With this contribution, we are not only showing the importance of social and psychological aspects in flood risk management but also how the decision-making process can provide a more equity decision.
Avoid common mistakes on your manuscript.
1 Einleitung
In den letzten Jahrzehnten haben Hochwasserereignisse erhebliche wirtschaftliche und soziale Schäden in und außerhalb von Österreich verursacht. Die Auswirkungen von Hochwasserereignissen hängen von der Häufigkeit und der Größe der Ereignisse, der Exposition von Gebäuden, landwirtschaftlichen Flächen und Infrastrukturen, aber auch von der Verwundbarkeit der Bevölkerung ab (Cutter et al. 2003; Kuhlicke et al. 2011; Babcicky et al. 2021). Die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf materielle Schäden an physischen Vermögenswerten, sondern umfassen auch immaterielle Schäden wie psychologische Auswirkungen (Babcicky und Seebauer 2021). Diese Herausforderungen werden aufgrund des Klimawandels in Zukunft steigen, da mit einer Zunahme von Hochwasserereignissen (IPCC 2018; Blöschl et al. 2019, 2020) und somit auch mit einer potenziellen Zunahme der damit verbundenen Schäden zu rechnen ist (Dottori et al. 2018). Die zukünftigen Risiken sind aber nicht gleich zwischen allen Menschen und Regionen verteilt (Collins et al. 2018; Thaler et al. 2018). Die zukünftige Zunahme der Schäden aufgrund von Hochwasserereignissen wird durch gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. dem sozio-demografischen Wandel, und Veränderungen in anderen Bereichen, wie z. B. der Landnutzung, verschärft werden (Jongman et al. 2015; Rogger et al. 2017; Jestl und List 2020; Clar et al. 2021).
Daher spielt das Hochwassermanagement eine zentrale Rolle, um die Schäden – materieller sowie immaterieller Natur – so gering wie möglich zu halten, wobei ein absoluter Schutz niemals gewährleistet werden kann, wie vergangene Ereignisse zeigten (Jongman et al. 2015; Juepner 2018). Die Fragen, welche Maßnahmen (natürlicher Rückhalt, technischer Hochwasserschutz, bauliche Vorsorge oder Risikovorsorge), wo (urbaner bzw. ländlicher Raum), wann (Frage der Priorisierung) und von wem (öffentliche Hand, Unternehmen, privater Haushalt, Public-Private-Partnership) umgesetzt werden, sind neben der Gegenfrage, wo keine Maßnahmen gesetzt werden, wesentliche Konfliktpunkte in Entscheidungsprozessen im Hochwassermanagement (Thaler und Hartmann 2016; Kuhlicke et al. 2020; Rufat et al. 2020).
Diese Entscheidungsprozesse beruhen auf quantitativen und qualitativen Abwägungen (Penning-Rowsell et al. 2013; Emrich et al. 2020; Babcicky et al. 2021). Das allgemeine Ziel dabei ist, dass die Entscheidungen im Hochwassermanagement auf eine gerechte, realistische und innovative Lösung für die betroffenen Gemeinden abzielen (Hübl und Kraus 2004; BMLFUW 2006, 2016). Die öffentliche Hand priorisiert jene Gebiete, die am meisten gefährdet sind bzw. die durch ein hohes Schadenspotenzial am verwundbarsten sind (BMLFUW 2006, 2016). Welche Gemeinde welchen Hochwasserschutz bekommt, wird maßgeblich anhand der Kosten-Nutzen-Analyse bewertet und ermittelt (Hanley und Spash 1994). Der Schwerpunkt in der Kosten-Nutzen-Analyse liegt dabei auf den direkten Schäden, d. h. auf der Ermittlung der physischen Verwundbarkeit von Gebäuden, Fabrikhallen sowie linearen Infrastrukturen, wie z. B. Straßen, Eisenbahnlinien oder Wasserleitungen (Penning-Rowsell 2015, 2021; Emrich et al. 2020).
Das tatsächliche Ausmaß der Schäden eines Hochwasserereignisses hängt aber auch von den Eigenschaften der betroffenen Personen und somit auch von sozialen und psychologischen Indikatoren ab (Cutter et al. 2003). Es stellt sich somit die Frage, ob die zurzeit vorrangige Betrachtung physischer Schäden zu einer ungleichen Behandlung der betroffenen Personen und Gemeinden führt bzw. führen kann (Penning-Rowsell 2015, 2021). Dieser Beitrag veranschaulicht die Relevanz von sozialer und psychologischer Verwundbarkeit und macht Vorschläge, wie soziale und psychologische Indikatoren erfasst und in die Kosten-Nutzen-Analyse mit einbezogen werden könnten.
2 Die Kosten-Nutzen-Analyse im Hochwassermanagement
Der Zweck der Kosten-Nutzen-Analyse ist der Vergleich der Kosten von Hochwasserschutzmaßnahmen mit der Höhe des abgewendeten Schadens (was gleichbedeutend mit dem Nutzen ist) (Hanley und Spash 1994). Auf diese Weise sollen die Mittel der öffentlichen Hand möglichst effizient verteilt und eingesetzt werden (Jonkman et al. 2004; Meyer et al. 2013; Hudson und Botzen 2019).
Prinzipiell wird in der Kosten-Nutzen-Analyse zwischen direkten und indirekten sowie monetären und nicht-monetären Schäden unterschieden (siehe Tab. 1). Direkte Schäden sind unmittelbare Auswirkungen des Ereignisses, wie z. B. das Eindringen von Wasser oder Sediment in Gebäude; je nach Wasserstand, Fließgeschwindigkeit und Geschiebemenge erhöht sich dabei der ökonomische Schaden (Penning-Rowsell et al. 2013). Der direkte Schaden wird monetär bewertet. Indirekte Auswirkungen betreffen u. a. die Nichterreichbarkeit von Orten und die Unterbrechung der Zulieferketten von Unternehmen (Meyer et al. 2013; Hallegatte 2014; Kreibich et al. 2014; Koks et al. 2019). Indirekte Schäden führen zu weit höheren volkswirtschaftlichen Verlusten als direkte Schäden (Thaler und Jongman 2018), da sie länger andauern und zusätzlich Unternehmen und Personen außerhalb des unmittelbaren Überflutungsgebiets betreffen (Meyer et al. 2013; Pfurtscheller 2014). Nicht-monetäre (bzw. intangible) Schäden beziehen sich auf Schäden an Personen (gesundheitliche und mentale Beeinträchtigung), Ökosystemleistungen sowie Kulturdenkmälern (Meyer et al. 2013). Nicht-monetäre Schäden werden meist qualitativ bewertet.
In der Praxis ist die Kosten-Nutzen-Analyse meist auf ökonomische Bewertungen des direkten Schadens beschränkt (Emrich et al. 2020). Gründe dafür sind erprobte und etablierte Bewertungsmethoden für monetäre Schäden, eine unzureichende Datengrundlage oder aufwendige Bewertungsmethoden für indirekte oder nicht-monetäre Schäden, bis hin zu ethischen Bedenken hinsichtlich der Bewertbarkeit nicht-monetärer Schäden. Die eingeschränkte Sichtweise auf direkte monetäre Schäden hat den Nachteil, dass Gebäude mit einer geringeren Ausstattung oder mit geringerer Qualität meist niedriger bewertet werden, da geringere Schadenssummen zu erwarten sind (Thaler et al. 2018; Emrich et al. 2020). Dabei wird nicht berücksichtigt, dass diese Gebäude häufiger von armutsgefährdeten Haushalten bewohnt werden (Fothergill und Peek 2004; Muñoz und Tate 2016; Emrich et al. 2020; Slavikova et al. 2021). In Folge schneiden einkommensstärkere Gemeinden oft besser in der Kosten-Nutzen-Analyse ab als einkommensschwache Gemeinden (Thaler et al. 2018). Für Entscheidungen im Hochwassermanagement bedeuten solche eingeschränkten Kosten-Nutzen-Analysen, dass in einkommensstärkeren Gemeinden Hochwasserschutzmaßnahmen wie z. B. Dämme eher umgesetzt werden, während in einkommensschwächeren Gemeinden Schutzmaßnahmen nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt errichtet werden oder es sogar zu Umsiedlungs- anstelle von baulichen Schutzmaßnahmen kommen kann (Thaler und Priest 2014; Siders 2019). Die derzeit übliche Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse im Hochwasserrisikomanagement führt also unter Umständen dazu, dass soziale Ungleichheiten zwischen Gemeinden verstärkt werden. Dies betrifft nicht nur Österreich, sondern ist aufgrund der teils deutlichen Strukturunterschiede auch auf gesamteuropäischer Ebene relevant.
3 Einbeziehen von sozialen und psychologischen Indikatoren
Um ein umfassendes Bild der Verwundbarkeit eines Privathaushalts gegenüber Hochwasser zu erhalten, sollten neben den üblichen physischen Indikatoren auch soziale und psychologische Indikatoren mitberücksichtigt werden (Babcicky und Seebauer 2021; Babcicky et al. 2021). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, gefährdete Gruppen besser zu identifizieren. Typische soziale Indikatoren sind sozio-demografische Merkmale, wie z. B. Alter, Gender, Einkommen, Wohnungseigentum und Bildungsstand (Cutter et al. 2003). Dabei ist es wichtig, sich nicht auf stereotype Gruppen wie Personen mit Migrationshintergrund, einkommensschwache oder ältere Menschen zu beschränken, da nicht alle Personen einer Bevölkerungsgruppe oder -schicht mit den gleichen Risiken und Herausforderungen von Hochwasserereignissen konfrontiert sind. Stattdessen sollten die tatsächlichen Lebensumstände der in den betroffenen Regionen lebenden Personen erfasst werden, um zu einer differenzierten Sichtweise der sozialen Verwundbarkeit zu gelangen.
Eine große Herausforderung ergibt sich aus der Frage, aus welchen Daten und in welcher räumlichen Auflösung soziale Indikatoren abgeleitet werden können. Angewandte Ansätze zur Erfassung der sozialen Verwundbarkeit fassen beispielsweise geografische Regionen (z. B. sämtliche Haushalte in einem Bundesland, einem Bezirk oder einer Gemeinde) als Analyseeinheit zusammen (Tonmoy und El-Zein 2018), da es auf der Ebene von politischen Verwaltungsbezirken leicht verfügbare Sekundärdaten aus Volkszählungen und Melderegistern gibt (Solín et al. 2018). Eine zu starke räumliche Aggregation kann aber zu einer unangemessenen Vereinfachung führen, wenn individuelle Unterschiede nivelliert werden (Seebauer et al. 2020).
Zu den psychologischen Indikatoren zählen z. B. emotionale Belastung, Beeinträchtigung der Lebenssituation, Anstieg von Krankenständen und Bedarf nach langfristiger psychologischer Unterstützung (Tapsell et al. 2002; Tunstall et al. 2006; Tapsell und Tunstall 2008). Angst, Selbstwirksamkeit (subjektive Überzeugungen, neue oder schwierige Anforderungen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können) oder Sozialkapital können massiv beeinflussen, wie Betroffene mit Hochwasserereignissen umgehen (Bubeck et al. 2012; Babcicky und Seebauer 2017; van Valkengoed und Steg 2019). Haushalte mit einem schwachen sozialen Netzwerk haben meist größere Schwierigkeiten, den Wiederaufbau zu bewerkstelligen (Deeming et al. 2011; Peacock et al. 2014; Medd et al. 2015).
4 Methodik
Im Zuge des vom österreichischen Klima- und Energiefonds geförderten Forschungsprojekts JustFair (Balancing dimensions of vulnerability, coping ability and adaptive capacity for realising social justice in climate change adaptation policy, 2018–2021) wurden in den Klimawandelanpassungs-Modellregionen (KLAR!-Regionen) Ennstal (Steiermark) und Freistadt (Oberösterreich) von Dezember 2019 bis Februar 2020 Haushaltsbefragungen durchgeführt. Standardisierte Fragebögen wurden als Beilage zu Gemeindezeitungen, per Postwurfsendung und digital an alle Bewohner*innen von Hochwasserrisikogebieten in zwölf Gemeinden in diesen Regionen verteilt. Bei einer Rücklaufquote von 7,3 % stehen Daten einer Stichprobe von 1127 Haushalten zur Verfügung. Die soziodemografische Zusammensetzung der Stichprobe spiegelt weitgehend repräsentativ die Population wieder, allerdings sind Männer, wie tendenziell auch in anderen Befragungen zu Naturgefahren, überrepräsentiert (67 %). Die soziale und physische Verwundbarkeit eines Haushalts gegenüber Hochwasserereignissen wurde auf Haushaltsebene umfassend erhoben: Sieben materielle und immaterielle Auswirkungen bilden die erwarteten Schäden und Beeinträchtigungen nach einem Hochwasserereignis ab. Gesamt 13 physische, 11 soziale und 19 psychologische Indikatoren bilden Merkmale ab, welche die Höhe dieser Auswirkungen beeinflussen (Tab. 2).
Mittels hierarchischer Regressionsmodelle wurde der Einfluss der einzelnen Indikatoren auf die verschiedenen erwarteten Auswirkungen eines Hochwasserereignisses analysiert. Diese Analysemethode testet einerseits für jeden einzelnen Indikator, ob er einen eigenständigen Erklärungswert für die Höhe der Auswirkungen hat (als statistisch signifikante Regressionskoeffizienten). Andererseits zeigt diese Methode, welchen Anteil der Auswirkungen eines Hochwasserereignisses die drei Indikatorengruppen (physisch, sozial, psychologisch) jeweils erklären können (als erklärte Varianz R2). Detaillierte Ergebnisse sind in Babcicky et al. (2021) und Babcicky und Seebauer (2021) dargestellt.
5 Ergebnisse
5.1 Die Kosten-Nutzen-Analyse im österreichischen Hochwassermanagement
Die Kosten-Nutzen-Analyse ist auf EU-Ebene in der Hochwassermanagementrichtlinie verankert (EU 2007) und national in der Richtlinie „Kosten-Nutzen-Untersuchungen im Schutzwasserbau“ durch den Forstwirtschaftlichen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung und im Rahmen der Schutzwasserwirtschaft umgesetzt (BMLFUW 2006, 2016). In Österreich steht bei der praktischen Umsetzung der Kosten-Nutzen-Analyse im Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung sowie bei der Bundeswasserbauverwaltung die monetäre Bewertung der direkten Auswirkungen des Hochwasserereignisses im Vordergrund, und damit die Berechnung des vermiedenen physischen Schadens (Nutzen) an z. B. Wohngebäuden, Betriebsstätten und Infrastrukturanlagen. Als Entscheidungskriterium dient der positive Nettonutzen, der als Nettobar‑/Kapitalwert (Nutzen abzüglich Kosten) oder als Nutzen-Kosten-Verhältnis angegeben werden kann (BMLFUW 2016). Die Höhe des Nettonutzens hängt von der Anzahl der Gebäude und Unternehmen ab, die durch die geplante Maßnahme geschützt werden.
Immaterielle Schäden und Auswirkungen, wie z. B. das individuelle Wohlbefinden, das Todesfallrisiko einer Person, ökologische Auswirkungen, der Schutz von Kulturgütern etc., werden zum Beispiel im Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung anhand des Faktors „G“ („Gesellschaft“) berücksichtigt, mit dem die ermittelten monetären Schäden multipliziert werden. Die Einschätzung des Faktors G erfolgt auf Basis qualitativer Angaben und hat meist nur eine geringe Bedeutung (Hübl und Kraus 2004). Somit erzielen strukturschwache Gemeinden bei gleichen Kosten für eine Schutzmaßnahme einen geringeren Nettonutzen als wohlhabendere Gemeinden, was zur Folge haben kann, dass diese Gemeinden schlechter gegen zukünftige Hochwasserereignisse geschützt werden.
Eine Berücksichtigung der sozialen und psychologischen Kriterien der Verwundbarkeit (z. B. Bildungsstand, Gender oder Alter) könnte zu einer besseren Einschätzung der tatsächlichen Verwundbarkeit eines Haushalts bzw. einer Gemeinde beitragen und somit auch soziale Ungleichheit abfedern, weil der höhere Nutzen einer Schutzmaßnahme in strukturschwachen Regionen abgebildet wird (Elliott und Pais 2006; Deeming et al. 2011; Peacock et al. 2014; Medd et al. 2015; Emrich et al. 2020; Slavikova et al. 2021). Der österreichische Katastrophenfonds bezieht soziale Merkmale bereits in die Schadensbewertung mit ein. Der Katastrophenfonds erstattet monetäre Schäden, die aufgrund eines Hochwasserereignisses aufgetreten sind; die Höhe der Auszahlungsquote richtet sich nach den Familienstrukturen und Einkommensverhältnissen, wobei einkommensschwache Familien in der Regel von der öffentlichen Hand einen höheren Schadensersatz erhalten (Thaler und Fuchs 2020).
5.2 Soziale und psychologische Verwundbarkeit in den Fallstudienregionen
Die verschiedenen physischen, sozialen und psychologischen Indikatoren weisen unterschiedliche Effekte auf die erwarteten materiellen und immateriellen Auswirkungen von Hochwasserereignissen auf (siehe Tab. 2). Über die physischen Indikatoren hinausgehend werden signifikante Einflussstärken für soziale und psychologische Indikatoren bestätigt. Manche Indikatoren sind durchgehend für alle Auswirkungen relevant (z. B. zentrale Lage, Risikowahrnehmung, Angst), während andere Indikatoren nur mit spezifischen Auswirkungen zusammenhängen (z. B. schützt ein höheres Einkommen nur vor finanzieller, gesundheitlicher und psychischer Belastung sowie bei Schwierigkeit bei der Rückkehr zu einem normalen Leben).
Die Regressionsmodelle können den zusätzlichen Erklärungswert sozialer und psychologischer Indikatoren über die physischen Indikatoren hinaus bestimmen (siehe Abb. 1). Physische Indikatoren können nur 3–9 % der erwarteten Gesamtauswirkungen (materiell und immateriell) eines Hochwasserereignisses erklären (graue Balken) und haben die größte Erklärungskraft bei Schäden am Gebäude und am Gebäudeinhalt. Soziale Indikatoren (blaue Balken, 6–10 %) und psychologische Indikatoren (grüne Balken, 4–13 %) weisen einen wesentlichen eigenständigen Erklärungswert für die individuelle Verwundbarkeit eines Privathaushalts bezüglich materieller und immaterieller Auswirkungen auf, über physische Indikatoren hinausgehend. Der gesamte Erklärungswert wird durch die Berücksichtigung sozialer und psychologischer Indikatoren sogar mehr als verdoppelt. Somit sind alle drei Indikatorengruppen und vor allem deren gemeinsame Betrachtung für die Erfassung der Auswirkungen einer Hochwasserkatastrophe relevant.
Die Ergebnisse zeigen, dass zur Erklärung der materiellen und immateriellen Auswirkungen eines Hochwassers und somit für ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement neben physischen, auch soziale und psychologische Indikatoren berücksichtigt werden sollten. Auf diese Weise können gefährdete Gruppen besser erfasst werden. Diese Perspektive auf spezifische Gruppen sollte sich nicht nur auf sozio-demografische Merkmale beschränken, sondern auch psychologische Fähigkeiten und Kapazitäten der betroffenen Haushalte mit einbeziehen.
6 Fazit und Relevanz für die Kosten-Nutzen-Analyse
Bei der derzeitigen Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse steht die Ermittlung des direkten physischen Schadens im Vordergrund der Wirtschaftlichkeitsbewertung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Ergebnisse der Untersuchung hinsichtlich der Verwundbarkeit von Privathaushalten gegenüber Hochwasserereignissen zeigen allerdings, dass soziale und psychologische Indikatoren die individuelle Verwundbarkeit der einzelnen Haushalte wesentlich beeinflussen. Daher sollten diese Informationen im Entscheidungsprozess zusätzlich zur Ermittlung der physischen Schäden verwendet werden, um die Personen bzw. Gemeinden, die am stärksten verwundbar sind, zu identifizieren und im Hochwasserschutz zu priorisieren.
Eine solche breitere Nutzenbetrachtung benötigt aber eine entsprechende Datenbasis. Soziale Indikatoren können aus vorhandenen Bevölkerungsstatistiken abgeleitet werden. Für psychologische Indikatoren stehen üblicherweise keine lokalen Daten zur Verfügung. Zu deren Erfassung sollten daher bei der Planung von Schutzmaßnahmen Haushaltsbefragungen im Risikogebiet durchgeführt werden, um die individuellen Unterschiede zwischen Privathaushalten zu erfassen. Dies sollte durch eine Expert*innenbewertung vor Ort ergänzt werden, da z. B. Selbstauskünfte zur Risikozone oder zum Gebäudezustand zu ungenau sein können (Seebauer et al. 2020). Im Gegensatz zur monetären Kosten-Nutzen-Analyse können und sollen die vielfältigen sozialen und psychologischen Indikatoren nicht auf eine einzige übergreifende Maßzahl (wie der ökonomische Nutzen in Euro) reduziert werden. Nachdem die verschiedenen sozialen und psychologischen Indikatoren unterschiedliche Einflüsse auf die einzelnen Auswirkungen haben, würde ein summativer Index nur ein grob vereinfachtes Bild zeichnen. Präziser wäre es, verschiedene verwundbare Gruppen und ihre zugrundeliegenden Merkmale in einem partizipativen Entscheidungsprozess gegeneinander abzuwägen und zu gewichten (Babcicky und Seebauer 2021).
Im Hochwasserrisikomanagement sollte berücksichtigt werden, dass psychologische Indikatoren leichter verändert werden können als physische und soziale Aspekte (Seebauer et al. 2020). Die öffentliche Verwaltung könnte daher vermehrt auf Bewusstseinsbildung, Trainings von Einzelpersonen und Nachbarschaftsgruppen zur Verringerung der individuellen Verwundbarkeit setzen, um die Risikowahrnehmung und die Bereitschaft zur Eigenvorsorge zu stärken. Informations‑, Beratungs- und Trainingsmaßnahmen sind im Regelfall mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand verbunden als das gängige Repertoire von Schutzbauten und Kompensationszahlungen. Die Ergebnisse zum Erklärungswert verschiedener Indikatoren (Abb. 1) lassen erwarten, dass Maßnahmen zur Stärkung sozialer und psychologischer Kapazitäten ähnlich wirksam sind wie Maßnahmen, die bei physischen Indikatoren ansetzen.
Bei limitierten öffentlichen Budgets und der zu erwartenden Zunahme von Hochwasserereignissen infolge des Klimawandels könnte in Zukunft eine Priorisierung von Schutzmaßnahmen auf Bundes- bzw. auf Landesebene notwendig werden. Der Entscheidungsprozess sollte in diesem Fall nicht nur auf Basis der Bewertung des physischen Schadens der Gemeinde erfolgen. Durch Berücksichtigung einkommensschwacher Haushalte bzw. strukturschwacher Gemeinden kann die Treffsicherheit einer solchen Priorisierung durch die zusätzliche Verwendung sozialer und psychologischer Indikatoren verbessert werden, wie dies in anderen Regionen wie England und Wales bereits erfolgt (Johnson und Penning-Rowsell 2010; Penning-Rowsell und Johnson 2015). Im Entscheidungsprozess kann neben der Kosten-Nutzen-Analyse ein Gewichtungsfaktor verankert werden, sodass strukturschwache Gebiete bzw. einkommensschwache Haushalte höher gewichtet werden, z. B. bis zu einer Zusatzgewichtung von max. 1,5 Punkten im Kosten-Nutzen Verhältnis. Dabei könnte folgende Abstufung angewandt werden:
-
Gemeinden mit einem Anteil einkommensschwacher Haushalte von bis zu 20 % werden mit einem Faktor von 0,5 schwächer gewichtet,
-
Gemeinden mit einem Anteil einkommensschwacher Haushalte von 21–40 % werden mit dem Faktor 1 unverändert gewichtet und
-
Gemeinden mit einem Anteil einkommensschwacher Haushalte von mehr als 40 % werden mit einem Faktor von 1,5 stärker gewichtet, um deren überproportionale sozio-ökonomische Ungleichheit abzubilden.
Von dieser Gewichtung im Entscheidungsprozess würden vor allem ländliche, strukturschwache Gemeinden stark profitieren. Diese geänderten Rahmenbedingungen würden aber auch dazu führen, dass der Entscheidungsprozess verstärkt eine multikriterielle Sichtweise anwendet, um die konventionelle, auf direkte monetäre Schäden beschränkte Kosten-Nutzen-Analyse zu erweitern und letztlich treffsicherere, effizientere und gerechtere Entscheidungen im Hochwassermanagement zu treffen.
Literatur
Babcicky, P., Seebauer, S. (2017): The two faces of social capital in private flood mitigation: Opposing effects on risk perception, self-efficacy and coping capacity. Journal of Risk Research, 20(8), 1017–1037.
Babcicky, P., Seebauer, S. (2021): People, not just places: Expanding physical and social vulnerability indices by psychological indicators. Proceedings 4th European Conference on Flood Risk Management.
Babcicky, P., Seebauer, S., Thaler, T. (2021): Make it personal: Introducing intangible outcomes and psychological sources to flood vulnerability and policy. International Journal of Disaster Risk Reduction, 58, 102169.
Blöschl, G., Hall, J., Viglione, A., Perdigao, R. A. P., Parajka, J., Merz, B., Lun, D., Arheimer, B., Aronica, G. T., Bilibashi, A., Bohac, M., Bonacci, O., Borga, M., Canjevac, I., Castellarin, A., Chirico, G. B., Claps, P., Frolova, N., Ganora, D., Gorbachova, L., Gül, A., Hannaford, J., Harrigan, S., Kireeva, M., Kiss, A., Kjeldsen, T. R., Kohnova, S., Koskela, J. J., Ledvinka, O., Macdonald, N., Mavrova-Guirguinova, M., Mediero, L., Merz, R., Molnar, P., Montanari, A., Murphy, C., Osuch, M., Ovcharuk, V., Radevski, I., Salinas, J. L., Sauquet, E., Sraj, M., Szolgay, J., Volpi, E., Wilson, D., Zaimi, K., Zivkovic, N. (2019): Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature, 573, 108–111.
Blöschl, G., Kiss, A., Viglione, A., Barriendos, M., Böhm, O., Brázdil, R., Coeur, D., Demarée, G., Llasat, M.C., Macdonald, N., Retsö, D., Roald, L., Schmocker-Fackel, P., Amorim, I. Belinova, M., Benito, G., Bertolin, C., Camuffo, D., Cornel, D., Doktor, R., Elleder, L., Enzi, S., Garcia, J.C., Glaser, R., Hall, J., Haslinger, K., Hofstätter, M., Komma, J., Limanowka, D., Lun, D., Panin, A., Parajka, J., Petric, H., Rodrigo, F.S., Rohr, C., Schönbein, J., Schulte, L., Silva, L.P., Toonen, W.H.J., Valent, P., Waser, J., Wetter, O. (2020): Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years. Nature, 583, 560–566.
Bubeck, P., Botzen, W.J.W., Aerts, J.C.J.H. (2012): A review of risk perceptions and other factors that influence flood mitigation behavior. Risk Analysis, 32(9), 1481–1495.
Clar, C., Löschner, L., Nordbeck, R., Fischer, T., Thaler, T. (2021): Population dynamics and natural hazard risk management: conceptual and practical linkages for the case of Austrian policy making. Natural Hazards, 105, 1765–1796.
Collins, T.W., Grineski, S.E., Chakraborty, J. (2018): Environmental injustice and flood risk: A conceptual model and case comparison of metropolitan Miami and Houston, USA. Regional Environmental Change, 18, 311–323.
Cutter, S.L., Boruff, B.J., Shirley, W.L. (2003): Social vulnerability to environmental hazards. Social Science Quarterly, 84(2), 242–261.
Deeming, H., Whittle, R., Medd, W. (2011): Recommendations for changes in UKNational Recovery Guidance (NRG) and associated guidance, from the perspective of Lancaster University’s Hull Flood Studies. Lancaster: Lancaster University.
Dottori, F., Szewczyk, W., Ciscar, J.-C., Zhao, F., Alfieri, L., Hirabayashi, Y., Bianchi, A., Mongelli, I., Frieler, K., Betts, R.A., Feyen, L. (2018): Increased human and economic losses from river flooding with anthropogenic warming. Nature Climate Change, 8, 781–786.
Dworak, T., Rogger, M., Thaler, T., Seebauer, S., Winkler, C. (2021): Was können wir aus den Maßnahmen während der Covid-19 Krise für die Unterstützung von Unternehmen aus dem österreichischen Katastrophenfonds lernen? Policy Brief. Graz: Joanneum Research.
Elliott, J. R., Pais, J. (2006): Race, class, and Hurricane Katrina: Social differences in human responses to disaster. Social Science Research, 35(2), 295–321.
Emrich, C.T., Tate, E., Larson, S.E., Zhou, Y. (2020): Measuring social equity in flood recovery funding. Environmental Hazards, 19(3), 228–250.
EU (2007): Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken. Brüssel: Amtsblatt der Europäischen Union.
Fothergill, A., Peek, L. (2004): Poverty and disasters in the United States: A review of recent sociological findings. Natural Hazards, 32, 89–110.
Hallegatte, S. (2014): Modeling the role of inventories and heterogeneity in the assessment of the economic costs of natural disasters. Risk Analysis, 34(1), 152–167.
Hanley, N., Spash, C.L. (1994): Cost-benefit analysis and the environment. Northampton: Edward Elgar Publishing.
Hübl, J., Kraus, D. (2004): Wirtschaftlichkeit und Priorisierung von Schutzmaßnahmen vor Wildbächen, Lawinen und Erosion, IAN Report 94/Subprojekt: Erweiterungsvorschläge zur Kosten-Nutzen-Untersuchung der Wildbach- und Lawinenverbauung. Ergebnisse der Teilprojekte I und II. Vienna: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Hudson, P., Botzen, W.J.W. (2019): Cost–benefit analysis of flood-zoning policies: A review of current practice. WIREs Water, 6(6), e1387.
IPCC (2018): Global warming of 1.5 °C. The intergovernmental panel for climate change. https://www.ipcc.ch/sr15/download/. Zugegriffen: 13. April 2021.
Jestl, S., List, E., (2020): Distributioanl national accounts (DINA) for Austria, 2004–2016. https://wid.world/news-article/distributional-national-accounts-dina-for-austria-2004-2016/. Zugegriffen: 13. April 2021.
Johnson, C.L., Penning-Rowsell, E.C. (2010): What really determines policy? An evaluation of outcome measures for prioritising flood and coastal risk management investment in England. Journal of Flood Risk Management, 3(1), 25–32.
Jongman, B., Winsemius, H.C., Aerts, J.C.J.H., Coughlan de Perez, E., van Aalst, M.K., Kron, W., Ward, P.J. (2015): Declining vulnerability to river floods and the global benefits of adaptation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(18), E2271–E228.
Jonkman, S.N., Brinkhuis-Jak, M., Kok, M. (2004): Cost benefit analysis and flood damage mitigation in the Netherlands. Heron, 49(1), 95–111.
Juepner, R. (2018): Coping with extremes—experiences from event management during the recent Elbe flood disaster in 2013. Journal of Flood Risk Management, 11(1), 15–21.
Koks, E.E., Rozenberg, J., Zorn, C., Tariverdi, M., Vousdoukas, M:, Fraser, S.A., Hall, J.W., Hallegatte, S. (2019): A global multi-hazard risk analysis of road and railway infrastructure assets. Nature Communication, 10, 2677.
Kreibich, H., van den Bergh, J.C.J.M., Bouwer, L., Bubeck, P., Ciavola, P. Green, C., Hallegatte, S., Logar, I., Meyer, V., Schwarze, R., Thieken, A.H. (2014): Costing natural hazards. Nature Climate Change, 4, 303–306.
Kuhlicke, C., Scolobig, A., Tapsell, S., Steinführer, A., De Marchi, B. (2011): Contextualizing social vulnerability: findings from case studies across Europe. Natural Hazards, 58, 789–810.
Kuhlicke, C., Seebauer, S., Hudson, P., Begg, C., Bubeck, P., Dittmer, C., Grothmann, T., Heidenreich, A., Kreibich, H., Lorenz, D. F., Masson, T., Reiter, J., Thaler, T., Thieken, A.H., Bamberg, S. (2020): The behavioral turn in flood risk management, its assumptions and potential implications. WIREs Water, 7(3), e1418.
Medd, W., Deeming, H., Walker, G., Whittle, R., Mort, M., Twigger-Ross, C., Walker, M., Watson, N., Kashefi, E. (2015): The flood recovery gap: A real-time study of local recovery following the floods of June 2007in Hull, North East England. Journal of Flood Risk Management, 8(4), 315–328.
Meyer, V., Becker, N., Markantonis, V., Schwarze, R., van den Bergh, J. C. J. M., Bouwer, L. M., Bubeck, P., Ciavola, P., Genovese, E., Green, C., Hallegatte, S., Kreibich, H., Lequeux, Q., Logar, I., Papyrakis, E., Pfurtscheller, C., Poussin, J., Przyluski, V., Thieken, A. H., Viavattene, C. (2013): Review article: Assessing the costs of natural hazards—state of the art and knowledge gaps. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 1351–1373.
Ministerium für ein lebenswertes Österreich (BMLFUW) (2006): Richtlinien für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Priorisierung von Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung gemäß § 3 Abs. 2 Z 3 Wasserbautenförderungsgesetz 1985.
Ministerium für ein lebenswertes Österreich (BMLFUW) (2016): Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung RIWA‑T. Gemäss §3 Abs 2 WBFG Fassung 2016. GZ: UW. 3.3.3/0028-IV/6/2015.
Muñoz, C.E., Tate, E. (2016): Unequal Recovery? Federal Resource Distribution after a Midwest Flood Disaster. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 13(5), 507.
Peacock, W. G., van Zandt, S., Zhang, Y., Highfield, W.E. (2014): Inequities in long-term housing recovery after disasters. Journal of the American Planning Association, 80(4), 356–371.
Penning-Rowsell, E.C. (2015): A realistic assessment of fluvial and coastal flood risk in England and Wales. Transcations of the Institute of British Geographers, 40(1), 44–61.
Penning-Rowsell, E.C. (2021): Comparing the scale of modelled and recorded current flood risk: Results from England. Journal of Flood Risk Management, 14(1), e12685.
Penning-Rowsell, E.C., Johnson, C.L. (2015): The ebb and flow of power: British flood risk management and the politics of scale. Geoforum, 62, 131–142.
Penning-Rowsell, E.C., Priest, S.J., Parker, D.J., Morris, J., Tunstall, S.M., Viavattene, C., Chatterton, J., Owen, D. (2013): Flood and coastal erosion risk management: a manual for economic appraisal. London: Routledge, Taylor & Francis.
Pfurtscheller, C. (2014): Regional economic impacts of natural hazards—the case of the 2005 Alpine flood event in Tyrol (Austria). Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 359–378.
Rogger, M., Agnoletti, M., Alaoui, A., Bathurst, J.C., Bodner, G., Borga, M., Chaplot, V., Gallart, F., Glatzel, G., Hall, J., Holden, J., Holko, L., Horn, R., Kiss, A., Konova, S., Leitinger, G., Lennartz, B., Parajka, J., Perdigao, R., Peth, S., Plavcova, L., Quinton, J.N., Robinson, M., Salinas, J.L., Santoro, A., Szolgay, J., Tron, S., van den Akker, J.J.H., Viglione, A., Blöschl, G. (2017): Land use change impacts on floods at the catchment scale: Challenges and opportunities for future research. Water Resource Research, 53(7), 5209–5219.
Rufat, S., Fekete, A., Armas, I., Hartmann, T., Kuhlicke, C., Prior, T., Thaler, T., Wisner, B. (2020): Swimming alone? Why linking flood risk perception and behavior requires more than “it’s the individual, stupid”. WIREs Water, 7(5), e1492.
Seebauer, S., Babcicky, P., Thaler, T. (2020): Erweiterung von Vulnerabilitätsanalysen um soziale und psychologische Faktoren. In: DCNA (eds.): Proceedings Disaster Research Days 2020. https://www.dcna.at/files/tao/img/veranstaltungen/drd20/DRD20_Book_of_Abstracts_v1.pdf. Zugegriffen: 1. Juni 2021.
Siders, A.R. (2019): Social justice implications of US managed retreat buyout programs. Climatic Change, 151, 239–257.
Slavikova, L., Hartmann, T., Thaler, T. (2021): Paradoxes of financial schemes for resilient flood recovery of households. WIREs Water, 8(2), e1497
Solín, Ľ., Madajová, M. S., Michaleje, L. (2018): Vulnerability assessment of households and its possible reflection in flood risk management: The case of the upper Myjava basin, Slovakia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 640–652.
Tapsell, S.M., Tunstall, S.M. (2008): “I wish I’d never heard of Banbury”: the relationship between ‘place’ and the health impacts from flooding. Health & Place, 14(2), 133–154.
Tapsell, S.M., Penning-Rowsell, E.C., Tunstall, S.M., Wilson, T.L. (2002): Vulnerability to flooding: health and social dimensions. Philosophical Transactions: The Royal Society A—Mathematical, physical & engineering sciences, 360, 1511–1525.
Thaler, T., Fuchs, S. (2020): Financial recovery schemes in Austria: How planned relocation is used as an answer to future flood events. Environmental Hazards, 19(3), 268–284.
Thaler, T., Hartmann, T. (2016): Justice and flood risk management: reflecting on different approaches to distribute and allocate flood risk management in Europe. Natural Hazards, 83, 129–147.
Thaler, T., Jongman, B. (2018): Economic vulnerability. In: Fuchs, S., Thaler, T. (eds.): Vulnerability and resilience to natural hazards. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 82–97.
Thaler, T., Priest, S. (2014): Partnership funding in flood risk management: new localism debate and policy in England. Area, 46, 418–425.
Thaler, T., Zischg, A., Keiler, M., Fuchs S. (2018): Allocation of risk and benefits—distributional justices in mountain hazard management. Regional Environmental Change, 18, 353–365.
Tonmoy, F. N., El-Zein, A. (2018): Vulnerability to sea level rise: A novel local-scale indicator-based assessment methodology and application to eight beaches in Shoalhaven, Australia. Ecological Indicators, 85, 295–307.
Tunstall, S.M., Tapsell, S.M., Green, C., Floyd, P., George, C. (2006): The health effects of flooding: Social research results from England and Wales. Journal of Water and Health, 4(3), 365–380.
van Valkengoed, A.M., Steg, L. (2019): Meta-analysis of factors motivating climate change adaptation behaviour. Nature Climate Change, 9(2), 158–163.
Förderung
Dieser Beitrag wurde vom Österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Research Programme (Projekt JustFair B769942; https://justfair.joanneum.at) gefördert.
Funding
Open access funding provided by University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU).
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Additional information
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Rights and permissions
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
About this article
Cite this article
Thaler, T., Seebauer, S., Rogger, M. et al. Erweiterung von Kosten-Nutzen-Analysen im Hochwassermanagement durch Berücksichtigung sozialer und psychologischer Verwundbarkeit. Österr Wasser- und Abfallw 73, 344–350 (2021). https://doi.org/10.1007/s00506-021-00780-2
Accepted:
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s00506-021-00780-2