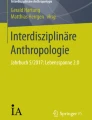Zusammenfassung
Das ‚Bonbonmodell‘ stellt sich als universell einsetzbares, neutrales Schema schulischen Philosophieunterrichts dar. Der Beitrag will dagegen u. a. zeigen, dass es einem lediglich begrenzten Verständnis von Philosophie Raum gibt. Demnach liege die einzige Relevanz der Philosophie darin, die angeblich ‚lebensweltlichen‘ Probleme der Schüler zu lösen, welche selbst nicht zu hinterfragen sind. Diesem verkürzten Philosophieverständnis korrespondiert die irrige didaktische
Vorstellung, beim Lernen handele es sich natürlicherweise um einen linearen Prozess, dessen einzelne Sequenzen einer festgefügten Reihenfolge unterliegen und der über den gesamten Klassenverband hinweg synchron ablaufe. Es fragt sich, ob das Erfolgsgeheimnis des ‚Bonbonmodell‘ weniger darin liegt, dass es das Lernen erleichtert, sondern dass es selbst leicht auswendig zu lernen und in der Ausbildung der Lehrkräfte leicht unterrichtet werden kann.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Eine Ausnahme bildet freilich Christian Thein, der es sich indes vornimmt, das Modell weniger zu kritisieren als vielmehr auszudifferenzieren und zu konkretisieren (Thein 2016a, S. 97).
- 2.
Theins Kritik ist diesbezüglich ambivalent. Es wird eingestanden, dass etwa die Problementwicklung nicht mit der Einstiegsphase abgegolten ist, sondern sich im Verlauf des gesamten Unterrichts „spiralförmig“ (Thein 2016b, S. 92) immer wieder auf die Ausgangsfrage zurückbeziehe, es wird auch gesehen, dass der „hermeneutische Zirkel“ sich im „permanenten Rückbezug auf die Leitfrage und der wechselseitigen Auseinandersetzungen mit den Präkonzepten […] und der Aufarbeitung von Philosophemen vollziehe“ (Thein 2016a, S. 99), doch reicht die Erwähnung von Spiralen und Zirkeln offenbar nicht aus, sich von der Vorstellung eines linearen, sich in Phasen gliedernden Unterrichtsverlaufs loszusagen (vgl. Thein 2016a, S. 100).
Literatur
Avanessian, A. und A. Hennig: Metanoia. Berlin: Merve 2014.
Fichte, J.G.: Über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit [1806]. Hrsg. v. A. Denker, C. Kinlaw, H. Zaborowski. München/Freiburg: Karl Alber 2020.
Foucault, M.: Der Gebrauch der Lüste. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986.
Gruschka, A.: Verstehen lehren. Ein Plädoyer für guten Unterricht. Ditzingen: Reclam 2011.
Deleuze, G.: ‚P comme Professeur‘. In: Ders./Claire Parnet: L’ABÉCÉDAIRE, 1996.
Derrida, J.: Geschlecht III. Wien: Turia + Kant 2021.
Engels, H.: „Vorschlag, den Problembegriff einzugrenzen“. In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik 3/1990, S. 126 ff.
Hattie, J.: Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Stuttgart: VERLAG 2014.
Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986.
Martens, E.: Methodik des Philosophie- und Ethikunterrichts. Philosophieren als elementare Kulturtechnik, VERLAG: Hannover 2009.
Sistermann, R.: „Der experimentelle Empirismus John Deweys und die Problemorientierung nach dem Bonbonmodell“. In: Ekkehard Martens (Hrsg.): Empirie und Erfahrung im Philosophie- und Ethikunterricht. Hannover: Siebert 2017, S. 114–133.
Thein, C.: Verstehen und Urteilen im Philosophieunterricht. Budrich: Opladen 2016a.
Thein, C.: „Problemreflexion und Urteilsbildung im Philosophie- und Ethikunterricht“. In: Peters, Jörg (Hrsg.): Fachverband Philosophie – Mitteilungen 2016b, S. 85–93.
Tiedemann, M.: „Problemorientierung“. In: Julian Nida-Rümelin, Irina Spiegel, Markus Tiedemann (Hrsg.): Handbuch Philosophie und Ethik. Band I: Didaktik und Methodik. Paderborn. Ferdinand Schöningh 2015, 70–78.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Paret, C. (2023). Hier ist das Problem, her mit der Lösung! Das ‚Bonbonmodell‘ und die Austreibung der Philosophie aus den Schulen. In: Bussmann, B. (eds) Philosophiedidaktik und Bildungsphilosophie. Philosophische Bildung in Schule und Hochschule. J.B. Metzler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67429-1_14
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-67429-1_14
Published:
Publisher Name: J.B. Metzler, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-67428-4
Online ISBN: 978-3-662-67429-1
eBook Packages: J.B. Metzler Humanities (German Language)