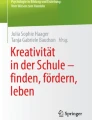Zusammenfassung
Im Bevölkerungsschutz spielen Erfahrungswerte und Wissen eine große Rolle. Diese bilden u. a. die Basis für Entscheidungen in zukünftigen Einsätzen, gelingende Konzepte sowie Lösungsstrategien. Dieses Kapitel widmet sich dem Umgang mit Wissen im Rahmen von Krisen und Einsätzen und nimmt dabei eine besonders praxisnahe Perspektive ein, durch die sowohl organisationsspezifische als auch -übergreifende Erfahrungen wiedergegeben sowie Handlungsimpulse aufgezeigt werden.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
4.1 Einleitung
Im Bevölkerungsschutz spielen Erfahrungswerte und Wissen eine große Rolle. Diese bilden u. a. die Basis für Entscheidungen in zukünftigen Einsätzen, gelingende Konzepte sowie Lösungsstrategien. Erfahrungswerte und Wissen fließen aber auch in Fort- und Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften ein. Dies zeigt, dass in den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und weitere Beteiligten bereits vielfältige Formen und Aspekte von Wissensmanagement praktiziert werden, allerdings häufig nicht so benannt oder strukturiert sind. Ein Blick auf die Strukturen und Prozesse, mit denen Erfahrungswerte und Wissen dokumentiert, abgeleitet und weiterentwickelt werden, ist für Akteure des Bevölkerungsschutzes lohnend, um vorhandenes Wissen zu bewahren und die eigene fachliche und organisatorische Expertise zu erweitern. Dies ist notwendig, um im Krisen- oder Katastrophenfall schnell agieren zu können und auch in komplexen und herausfordernden Einsätzen handlungsfähig zu bleiben. Der effiziente Umgang mit Wissen wird für BOS und weitere Beteiligte auch in Zukunft wichtig bleiben oder sogar noch an Bedeutung gewinnen. Denn auch im Bevölkerungsschutz werden Änderungen in der Informationsbeschaffung oder Kommunikationstechnik spürbar. So wirken sich technische oder digitale Errungenschaften auch auf die Möglichkeiten aus, mit denen Wissen und Erfahrungswerte festgehalten und geteilt werden.
Auch der Flüchtlingseinsatz 2015/16 machte deutlich, wie elementar nicht nur der Informations- und Wissensaustausch während einer Lage, sondern auch das Festhalten, Aufbereiten und Weitergeben von Erfahrungswerten und Wissen nach einem Einsatz sind. Mancherorts mussten konkrete Informationen zum Einsatzgeschehen erst mühsam eingeholt werden, was die Bedeutung von Wissensaustausch, insbesondere organisationsübergreifendem, aufzeigt. Teilweise waren auch Hilfsmaterialien, wie Handlungsempfehlungen oder Leitfäden, veraltet, sodass sie nicht genutzt werden konnten oder nicht verfügbar waren und erst erstellt werden mussten. Wenn wichtige Informationen und Wissen im Einsatzfall nicht unmittelbar vorhanden oder zugänglich sind, kann dies wertvolle Zeit kosten oder sich auf die Effizienz und Qualität einer Einsatzbewältigung auswirken.
Wie in Kap. 3 dieses Handbuchs aufgezeigt wurde, ist eine gelingende Zusammenarbeit der am Einsatz beteiligten Akteure elementar, sie ist jedoch auch mit verschiedenen Herausforderungen verknüpft. Zu diesen Herausforderungen gehören auch das Festhalten, Aufbereiten und Weitergeben von Wissen als Bestandteil für gelingende Kooperationen und gegenseitige Hilfeleistungen. Daran wird deutlich, dass das Thema Wissensmanagement nicht nur für die eigene Organisation oder Behörde relevant ist, sondern im Idealfall auch organisationsübergreifend gedacht werden sollte. Dieses Kapitel widmet sich dem Umgang mit Wissen im Rahmen von Krisen und Einsätzen und nimmt dabei eine besonders praxisnahe Perspektive ein, durch die sowohl organisationsspezifische als auch -übergreifende Erfahrungen wiedergegeben sowie Handlungsimpulse aufgezeigt werden.
Ziel dieses Kapitels ist es, für das Thema Wissensmanagement zu sensibilisieren und anhand von praktischen Beispielen aus dem Flüchtlingseinsatz aufzuzeigen, wie dieses gelingen kann, aber auch wo Herausforderungen in der Planung und Umsetzung liegen können. Zudem werden Hinweise und Vorgehensweisen aufgezeigt, wie verschiedene Aspekte von Wissensmanagement in der Praxis umgesetzt werden können und was es dabei zu beachten gilt. Allerdings sind damit keine allgemeinen oder ultimativen Lösungswege gemeint, welche immer eins zu eins umgesetzt werden können oder sollen. Es geht vielmehr darum Mitarbeitende von BOS und anderen Beteiligten zu befähigen eine eigene Bestandsaufnahme ihres Wissensmanagements durchzuführen, in dem Hintergrundwissen aufbereitet und mit Praxiswissen angereichert wird. Dabei werden Definitionen, Konzepte und Theorien des Wissensmanagements dargestellt, welche insbesondere für den Bevölkerungsschutz relevant sind, sowie praktische Erfahrungen, Vorgehensweisen und Ideen aus diversen Standorten und einer Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren aufgezeigt.
Zu Beginn erfolgt in Unterkapitel 4.2 eine Einführung in das Wissensmanagement, um den Begriff und die Bedeutung, insbesondere für den Bevölkerungsschutz, zu erläutern sowie einige Methoden vorzustellen. Die darauffolgenden drei Unterkapitel widmen sich verschiedenen Bereichen des Wissensmanagements: Dem Rückgriff auf Erfahrungswerte, dem Wissensaustausch im Einsatz sowie der Nutzbarmachung von Wissen auch über den Einsatz hinaus. Dafür beginnen diese jeweils mit einem Rückblick, in denen zusammenfassend verschiedene Erfahrungen aus der Flüchtlingshilfe wiedergegeben werden, welche durch detailliertere Beispiele aus der Praxis ergänzt und veranschaulicht werden. Diese stammen jeweils aus den in den vier Untersuchungsstandorten des Projektes SiKoMi – Bad Fallingbostel, Berlin, Bramsche-Hesepe, Trier – geführten Interviews mit dem am Flüchtlingseinsatz beteiligten Akteuren (siehe Unterkapitel 1.3.3). Zudem werden ausgewählte Ergebnisse einer DRK-internen Umfrage im Projekt WAKE vorgestellt, die einen Eindruck vom Umgang mit Hilfsmitteln und Erfahrungswerten einer Hilfsorganisation geben (siehe Unterkapitel 4.3.2). Als praktisches Beispiel, wie aus identifizierten Wissenslücken Hilfsmaterial für den Einsatz erstellt wird, dient ein Beitrag über das Handbuch Interkultureller Bevölkerungsschutz (siehe Unterkapitel 4.4.2). Zudem wird eine erste Anleitung zur Etablierung von Wissensmanagementaspekten innerhalb einer Behörde oder Organisation gegeben (siehe Unterkapitel 4.5.2). Das Kapitel schließt mit einem zusammenfassenden Fazit, in welchem sowohl bewährte Praktiken als auch bestehende Lücken innerhalb des Wissensmanagements der beteiligten Akteure wiedergegeben werden.
Die folgende Tabelle enthält die wesentlichen Fragen, welche in Kap. 4 betrachtet und diskutiert werden sollen (Tab. 4.1):
4.2 Einführung in das Wissensmanagement
Was bedeutet Wissensmanagement eigentlich?
Der Begriff Wissensmanagement stammt aus dem Bereich der Wirtschaft und beschreibt (üblicherweise) den Umgang mit Wissen innerhalb und außerhalb eines Unternehmens. Dabei ist ein gut funktionierendes Wissensmanagement essentiell für das Erreichen von Unternehmens- bzw. Organisationszielen und die Bedeutung eines solchen gut funktionierenden Managementsystems ist daher allgemein anerkannt [11, 15]. Gerade in Wirtschaftsunternehmen wird Wissensmanagement zunehmend fokussiert, da mit Hilfe von Wissensmanagementmethoden sowohl die Leistungsfähigkeit gesteigert als auch Unternehmensziele effizienter erreicht werden können, woraus ein Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Unternehmen erzielt wird [7, 12, 15]. Die Wichtigkeit wird außerdem durch den fortgeschrittenen Wandel zu einer Wissensgesellschaft und den zunehmenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik deutlich. Wissen wird einerseits mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand beschafft, andererseits veraltet das bestehende Wissen zunehmend schneller [15].
Trotz der Relevanz von Wissensmanagement – und damit auch von Wissen im Speziellen –, gibt es keine allgemeingültige Definition des Begriffs, weder in der Alltagssprache noch in der wissenschaftlichen Literatur [4]. Darüber hinaus ist die Trennung der Begriffe Daten, Informationen und Wissen in der Alltagssprache fließend, sodass auch diese Definitionen und Ansichten nicht eindeutig voneinander abzugrenzen sind [7]. Es können zusätzlich noch weitere Begriffe identifiziert (z. B. Fakten und Handeln) und in die Diskussion integriert werden [5]. Da an dieser Stelle ein möglichst praxis- und anwendungsnaher Umgang mit Wissensmanagement ermöglicht werden soll, werden die Begriffe in Anlehnung an ein Glossar zum Wissensmanagement im Bevölkerungsschutz [14] verwendet, welches als Teilvorhaben des Forschungsprojektes WAKE durch die Technische Hochschule Köln (TH Köln) erarbeitet wurde. Dieses zugrunde gelegte Verständnis geht von einer stufenweisen Anordnung von Daten, Informationen und Wissen aus [14, 16, 65] (Abb. 4.1):
Wissensmanagement beschäftigt sich darauf aufbauend mit der Frage, wie dieses aus Daten und Informationen entstandene Wissen bestmöglich strukturiert und operationalisiert werden kann und wie damit die Fähigkeiten einer Organisation auf allen Hierarchieebenen verbessert werden können. Auch hierzu gibt es mehrere variierende Herangehensweisen und Modelle, die unterschiedliche Aspekte des Wissensmanagements in den Vordergrund stellen [15]. Ein Modell zur Beschreibung des Wissensmanagements ist der Wissenskreislauf nach Probst et al. (2012) [16]. Dieser beschreibt sechs Kernprozesse des organisationalen Wissensmanagements und zeigt deren Verbindungen und Abhängigkeiten untereinander auf (siehe Abb. 4.2). Die Komponenten Wissensziele und Wissen bewerten vervollständigen diesen Kreislauf und bilden einen strategischen Rahmen [2, 16].
Wissenskreislauf nach Probst et al. (2012) [16].
In der Abbildung wird deutlich, dass ein umfassendes Wissensmanagement nicht nur etabliert, sondern auch aufrechterhalten werden muss, es also ein fortlaufender Prozess ist. Dafür ist es notwendig, die einzelnen Schritte regelmäßig zu wiederholen, da sich Wissen schnell verändern oder veralten kann. Nur eine dauerhafte Auseinandersetzung führt zu einer Erleichterung in der täglichen Arbeit. Welcher Teil dabei priorisiert wird, hängt von den Zielen der jeweiligen Organisation ab, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Optimierung einer einzelnen Fähigkeit keinen großen Vorteil bringt, sondern alle Kernprozesse zusammen gefördert werden sollten [16].
Und was bedeutet Wissensmanagement im Bevölkerungsschutz?
Ein gutes Wissensmanagement ist nicht nur für Wirtschaftsunternehmen wichtig, sondern für jede Art von Organisation. Auch bei den Akteuren des Bevölkerungsschutzes (BevS-Akteure) sollte Wissensmanagement thematisiert und gefördert werden. Angelehnt an die Komponenten und Kernprozesse des Kreislaufs nach Probst (2012) (siehe Abb. 4.2) können für das Wissensmanagement im Bevölkerungsschutz die folgenden Punkte formuliert werden:
-
BevS-Akteure erkennen generell, wie wichtig Wissen (und ein gutes Managementsystem) ist, um ihre Ziele zu erreichen.
-
Sie definieren genau, welches Wissen benötigt wird, um ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen, aber auch, welches Wissen nicht gebraucht wird.
-
Sie analysieren den Ist-Zustand des Wissensmanagements innerhalb ihrer Organisation oder Behörde und identifizieren das bereits vorhandene, aber auch das fehlende sowie das nicht mehr benötigte Wissen (z. B. Checklisten, Handlungsleitfäden oder Lehrbücher).
-
Ebenso identifizieren BevS-Akteure bereits bestehende Instrumente (z. B. Lessons Learned, Fortbildungsangebote und persönliche Netzwerke der Mitarbeitenden, etc.) sowie technische Hilfsmittel (z. B. Datenbanken oder E-Learning-Plattformen).
-
Sie generieren neues Wissen aus gemeinsamen organisationalen Erfahrungen und dem impliziten (also dem personenbezogenen Erfahrungs-) Wissen der Mitarbeitenden (z. B. durch regelmäßige Evaluationen) und ergänzen die vorhandenen Bestände, falls nötig, durch Wissen von außen (z. B. mit Hilfe von Fachleuten, Fortbildungsangeboten, etc.).
-
Sie streben eine Aufbereitung des Wissens für die Nutzung im Alltag an, indem es geordnet und in eine leicht verständliche Form gebracht wird (z. B. Organigramme, Yellow Pages, klar und einfach strukturierte Datenbanken, klare Kommunikationswege, Verschriftlichung des generierten Wissens in Handlungsleitfäden oder Checklisten, etc.).
-
Die BevS-Akteure machen das aufbereitete Wissen so für die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen verfügbar, dass diese ihre Aufgaben innerhalb der Organisation sinnvoll und erfolgreich wahrnehmen können. Durch Schulungen, Handlungsleitfäden, etc. wird das generierte Wissen danach wieder in die Organisation zurückgeführt.
-
Da es sich bei Wissensmanagement um kein einmalig zu erreichendes Ziel, sondern um einen fortlaufenden Prozess handelt, müssen sich BevS-Akteure immer wieder aufs Neue mit den gerade beschriebenen Schritten auseinandersetzen. Die Wissensbestände müssen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Zudem wird keine Organisation oder Behörde bei der Einführung eines Wissensmanagements von Grund auf neu anfangen, sondern immer auf bereits bestehenden Teillösungen aufbauen und weitere ergänzen.
Welche Methoden des Wissensmanagements spielen im Bevölkerungsschutz eine Rolle?
Im Wissensmanagement gibt es verschiedene Methoden, um Wissen aufzubereiten, zu speichern und wieder zu verteilen bzw. zu verwenden. Im Bevölkerungsschutz spielen unter anderem Lessons Learned, Best Practices, Datenbanken und kollegiale Netzwerke eine wichtige Rolle.
Lessons Learned meinen die systematische Dokumentation und Aufbereitung von Erfahrungen in einer Organisation oder Behörde, durch welche sie aus Erfolgen und Misserfolgen lernen und ihre Prozesse optimieren kann [12, 13]. Beispielsweise können Erfolge und Misserfolge in der Einsatznachbereitung strukturiert festgehalten und Lehren daraus gezogen werden. Diese Erkenntnisse können anschließend in zukünftige Einsatzabläufe integriert werden [14].
Bei der Erstellung einer Best Practice werden verschiedene Lösungen zu einer Problemstellung verglichen und die am besten geeignete übernommen. Dadurch stellt die gewählte Best Practice die für ein bestimmtes Problem bestmögliche Lösung dar [12, 13]. Beispielweise vergleicht eine Organisation oder Behörde ihre Herangehensweise zur Einsatzbewältigung mit der eines anderen BevS-Akteurs. Sie stellt fest, dass die andere Lösung für die Problematik besser geeignet ist und ersetzt ihre alte Vorgehensweise.
In Datenbanken können verschiedene Daten und Informationen verwaltet, archiviert und nachgeschlagen werden [12, 13, 18]. Die BevS-Akteure können alle Informationen, welche sie zur Erfüllung von Einsatzzielen benötigen in einer Datenbank speichern. Mögliche Inhalte sind z. B. Einsatzpläne, Best Practices und Handlungsleitfäden, etc. [16]. Sinnvoll ist es, wenn alle Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen ihr Wissen in einer Datenbank ablegen und auch auf das Wissen von anderen zugreifen können.
Netzwerke, in welchen sich Fachleute der eigenen Organisation oder Behörde sowie andere Akteure über gemeinsame fachliche Themen und Erfahrungen austauschen, werden kollegiale Netzwerke genannt [1, 7]. Beispielsweise treffen sich Mitarbeitende unterschiedlicher BevS-Akteure, um Einsatztaktiken und -strategien zu besprechen. Dieser Austausch führt im Bevölkerungsschutz dazu, dass die Verantwortlichen sich kennen und im Einsatzfall auf diese Kontakte zurückgreifen können (In Krisen Köpfe kennen – siehe auch 3.4.1 „Stakeholder-Management“).
4.3 Vorhandenes Wissen
Nachdem das vorherige Kapitel eine erste Einführung in das Thema und den Begriff Wissensmanagement gegeben hat und dabei auch die Bedeutung für Akteure des Bevölkerungsschutz hervorgehoben hat, widmet sich dieses Unterkapitel dem Rückgriff auf Erfahrungswerte und Hilfsmaterialien am Beispiel der Flüchtlingshilfe. Dafür werden zuerst exemplarisch Eindrücke aus den vier untersuchten Fallregionen im Projekt SiKoMi – Bad Fallingbostel, Berlin, Bramsche-Hesepe und Trier – wiedergegeben (siehe dazu auch Unterkapitel 1.3), die aufzeigen, welch vielfältiges Wissen bei den Akteuren bereits bestand, jedoch auch mit welchen Herausforderungen und Wissenslücken sie zu kämpfen hatten. Der Rückblick schließt mit einer kleinen Übung, in der sich die Lesenden anhand von Reflexionsfragen einen ersten Eindruck davon verschaffen können, inwieweit sie (im Falle einer akuten Lage) auf Hilfsmittel zurückgreifen können und wo ggf. Anpassungsbedarf besteht. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden ausgewählte Ergebnisse einer DRK-internen Befragung vorgestellt, welche im Rahmen des Forschungsprojektes WAKE durchgeführt wurde und die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Flüchtlingshilfe fokussierte. Anhand dieser wird exemplarisch der Umgang mit Hilfsmitteln und Erfahrungswissen einer Hilfsorganisation während und nach einem Einsatz aufgezeigt.
4.3.1 Rückblick: Erfahrungswerte und Hilfsmittel
Ob und wie auf Erfahrungswerte aus vergangenen Einsatzlagen oder Wissen aus anderen Bereichen für die Bewältigung des Flüchtlingseinsatzes zurückgegriffen werden konnte, wurde in den einzelnen untersuchten Standorten unterschiedlich bewertet. Vor allem Mitarbeitende des Bezirksamtes Lichtenberg (BAL) in Berlin berichteten, dass sie auf Erfahrungen explizit aus früheren Flüchtlingsbewegungen zurückgegriffen haben [57–59]. Ebenfalls in Berlin als hilfreich identifiziert, aber thematisch weniger verwandt, sei das Fachwissen zu Crowd Management oder Personenlenkung gewesen, das die private Sicherheit aus ihrer Tätigkeit bei Großveranstaltungen auf die Situation bei der Registrierung von Geflüchteten (bspw. am LAGeSo Berlin) übertragen konnte [47]. Aus Bad Fallingbostel berichteten Organisationsvertreter*innen aus Bundeswehr und einer Hilfsorganisation, dass sie teilweise auf vorhandene Erfahrungen aus früheren (Auslands-)Einsätzen zurückgreifen konnten [20, 21], aber nicht jedes Wissen aus anderen Situationen auf die Lagebewältigung 2015/16 übertragbar war [21, 38]. Zudem konnte auf Konzepte zur Registrierung und Unterbringung von einer großen Personenzahl sowie zur Identifizierung von Kranken und Verletzen zurückgegriffen werden, da diese bereits aus Einsätzen zur Evakuierung aufgrund von Bombenfunden bekannt waren [33].
Einige Gesprächspartner*innen des LAGeSo merkten zudem an, dass Wissen aus vorherigen Flüchtlingsbewegungen lediglich vereinzelt und eher unbewusst in die Lagebewältigung 2015/16 einfließen konnte, da ihre Dokumentation höchst defizitär gewesen sei und auch unweigerlich zu einer Wiederholung von Fehlern geführt hätte [53, 56]. Aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA Trier) wurde berichtet, dass das wertvollste Wissen aus eigenen Erfahrungen vorheriger Flüchtlingslagen stammt. Träger dieses Wissens seien daher in der Lage 2015/16 im Dauereinsatz gewesen, um im gesamten Bundesland Rheinland-Pfalz das Personal der in großer Zahl entstehenden AfA-Zweigstellen zu schulen [49, 50].
Auch wenn nicht überall Erfahrungswerte vorhanden waren, auf die zurückgegriffen werden konnte, so konnten einige der beteiligten Akteure bereits existierende Hilfsmittel nutzen. Verschiedene Organisationsvertreter*innen aus Bad Fallingbostel berichteten, dass vielfach Handlungsempfehlungen, Leitfäden und Checklisten existiert hatten [22, 31]. Nicht immer sei jedoch ausreichend Zeit geblieben, um diese Verschriftlichungen in der akuten Lage zu analysieren und anwenden zu können [21]. Insgesamt betrachtet konnte an allen Standorten bereits vorhandenes Material aus früheren Flüchtlingseinsätzen oder anderen Einsatzfeldern nur schwer die Komplexität und Dynamik der Situation 2015/16 abdecken [24, 30, 45].
Nur teilweise konnte auf bereits gemachte Erfahrungen und vereinzelt auch auf Hilfsmittel zurückgegriffen werden, da sich der Flüchtlingseinsatz in seiner Komplexität, Größe und Dynamik von früheren Lagen unterschied.
Reflexionsfragen
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie Sie oder Ihr Team bereits auf Hilfsmittel zurückgreifen können und wo ggf. Anpassungsbedarf besteht, gehen Sie folgende Fragen durch.
-
Wenn Sie ad-hoc Unterstützung in Form von niedergeschriebenen Hilfsmaterialien benötigen, auf welche können Sie bereits zurückgreifen?
-
Gibt es eine zentrale Struktur, zum Beispiel eine Datenbank, die all diese Materialien sammelt und gebündelt zur Verfügung stellt, sodass Sie im Zweifel schnell und einfach auffindbar sind?
-
Kennen und nutzen auch andere Personen diese Hilfsmittel oder ist das Wissen über ihre Existenz nicht weit verbreitet?
-
Inwieweit werden bestehende Materialien aktuell gehalten und ggf. an neue Bedarfe angepasst?
4.3.2 Ergebnisse einer DRK-internen Befragung
Im Rahmen des Forschungsprojektes WAKE führte das DRK im Frühjahr 2020 eine bundesweite DRK-interne Befragung zur Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren im DRK-Flüchtlingseinsatz 2015/16 in Deutschland durch. Insgesamt wurden 305 Fragebögen ausgewertet. Dabei wurden auch Daten zum Thema Hilfsmittel im Einsatz und Umgang mit Erfahrungswissen erhoben, welche an dieser Stelle kurz vorgestellt werden sollen. Die ausführlichen Ergebnisse finden sich in der Schriftenreihe Schriften der Forschung, Band 9 – Zivilgesellschaftliche Akteure in der DRK-Flüchtlingshilfe 2015/16 wieder [6].
Hilfsmittel im Einsatz
Um im Einsatzgeschehen schnell an wichtige und nützliche Informationen zu kommen, sind Hilfsmittel von hoher Bedeutung. Solche Hilfsmittel sind divers und können sowohl niedergeschriebene Formate als auch bestimmte Methoden oder Strategien umfassen. Gerade für Mitarbeitende von BOS und weitere Beteiligte spielen sie, neben ihren eigenen Erfahrungswerten, oft eine relevante Rolle, sodass sie auch im Flüchtlingseinsatz genutzt wurden, wie die folgenden Ergebnisse der Befragung zeigen.
Denn zwei Drittel der Befragten gaben an, auf mindestens eines der zur Auswahl stehenden Hilfsmittel, nämlich Handlungsempfehlungen, Checklisten, Leitfäden und/oder Handbücher, zurückgegriffen zu haben. Dabei wurden Handlungsempfehlungen und Checklisten am häufigsten genannt. Verglichen mit Leitfäden und Handbüchern weisen diese einen geringeren Umfang auf und sind daher in ihrer Erschließung weniger zeitintensiv, was ein Grund für die verbreitete Verwendung sein könnte. Lediglich 3 % der Befragten gaben an, dass zwar Hilfsmittel zur Verfügung gestanden hatten, sie diese aber u. a. aufgrund von Unübersichtlichkeit, fehlender Übertragbarkeit auf die aktuelle Lage oder fehlender Relevanz nicht nutzen konnten. Im Gegensatz dazu gab etwa ein Viertel der Befragten an, dass keine Hilfsmittel zur Verfügung gestanden hatten. Ein Grund hierfür kann in der mangelnden Zugänglichkeit bzw. Bekanntheit von bestehenden Hilfsmitteln liegen.
Des Weiteren ging aus der Befragung hervor, dass neben den zur Auswahl stehenden Hilfsmitteln einige Teilnehmende auch weitere Konzepte und Materialien verwendet hatten. Dazu zählten zum Beispiel spezifische Dienstvorschriften und Übersetzungshilfen. Neben niedergeschriebenen Hilfsmitteln wurden auch regelmäßige Treffen und Absprachen, beispielsweise in Form von Runden Tischen oder Briefings als nützlich erachtet. Einige Befragte gaben zudem an, eigenständig Hilfsmittel entwickelt zu haben.
Umgang mit Erfahrungswissen
Wie bereits oben genannt, wird in Krisen- und Katastrophenlagen oft auf Erfahrungswerte vorheriger Einsätze zurückgegriffen. U. a. daher ist es notwendig, diese zu erfassen, um bewährte Praktiken zu identifizieren und Konzepte und Strategien ggf. an neue Bedarfe anzupassen. Inwieweit die gemachten Erfahrungen und das generierte Wissen aus dem Flüchtlingseinsatz bereits aufbereitet und eventuell sogar weitergegeben wurde, war deshalb ebenfalls Bestandteil der Befragung (Abb. 4.3).
Die Auswertung dieser Frage zeigt, dass ein Großteil der befragten Personen ihre Erfahrungen aus dem Flüchtlingseinsatz in unterschiedlicher Form festgehalten und nutzbar gemacht hat. Bei den zur Auswahl stehenden Möglichkeiten (Mehrfachnennungen möglich) gaben 30 % an, dass sie ihr Wissen festgehalten, und/oder weiterverarbeitet haben, allerdings nicht strukturiert. Ebenfalls 30 % der Befragten gaben an, dass (Hilfs-)Materialien für zukünftige Lagen erstellt wurden. Etwas weniger, 22 %, berichteten, dass eine Dokumentensammlung erstellt wurde und wiederum 14 %, dass Veranstaltungen zur Einsatzaufbereitung angeboten wurden. Lediglich 16 % der Befragten gaben an, ihr Erfahrungswissen nicht festgehalten und/oder aufbereitet zu haben. Die Gründe hierfür konnten nicht abschließend erfasst werden.
Darüber hinaus berichteten einige Teilnehmende über weitere, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und Methoden, wie sie ihre Erfahrungswerte nutzbar gemacht bzw. weitergegeben hatten. Dazu zählten u. a. die Dokumentation von Einsätzen in Form von Einsatztagebüchern, Webinare, informelle Treffen und die Überarbeitung eines Dolmetscher*innenpools.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass auch im Rahmen des Flüchtlingseinsatzes verschiedene Aspekte von Wissensmanagement innerhalb des DRK bereits Anwendung fanden, auch wenn diese nicht zwangsläufig so benannt wurden. Gleichzeitig wurden jedoch auch Lücken und vorhandenes Potenzial identifiziert. Denn z. B. schon existierende Hilfsmaterialien könnten durch eine breitere Streuung und mehr Bekanntheit von einem größeren Personenkreis genutzt werden, was auch Ressourcen und Kapazitäten bei Neuentwicklungen sparen würde. Da viel Wissen zudem unstrukturiert festgehalten und/oder weiterverarbeitet wurde, könnte an dieser Stelle mehr geplantes Vorgehen zu einem effizienteren Wissensmanagement führen, welches die Nutzbarkeit von gesammeltem und aufbereitetem Wissen erhöht.
4.4 Wissensaustausch im Einsatz
Nachdem bereits aufgezeigt wurde, inwieweit auf Erfahrungswerte sowie Hilfs- und Informationsmittel zur Orientierung und Unterstützung zurückgegriffen werden konnte, wirft dieses Unterkapitel einen Blick auf die verschiedenen Wege, über die Wissen und Erfahrungen während des Einsatzes in der Flüchtlingshilfe geteilt wurden. Dabei sollen sowohl Beispiele aus der Praxis dargestellt werden, die informelle und meistens spontane Wege beschreiben, als auch solche, die stärker strukturiert und koordiniert sind. Je nach Einsatzlage und beteiligten Akteuren eignen sich unterschiedliche Formate, welche jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen. Daher werden neben Beispielen, die sich in der Praxis bewährt haben, auch Aspekte beschrieben, anhand denen Hürden und Herausforderungen für Wissensaustausch deutlich werden.
Dabei wird deutlich, dass ein gelingender Wissensaustausch nicht nur dazu führen kann, dass die erhaltenen Informationen direkt in konkrete Handlungen im Einsatz umgewandelt werden, sondern darüber hinaus auch für die Anwendung in Fortbildungen, Seminare und Workshops aufbereitet werden. Im zweiten Teil des Kapitels wird deshalb exemplarisch beschrieben, wie mit identifizierten Bedarfen aus der Flüchtlingshilfe 2015/2026 umgegangen werden kann, indem diese in die Erarbeitung und Konzeptionierung von neuen Informations- und Bildungsmaterialien einfließen.
4.4.1 Rückblick: Wege des Wissensaustauschs
Um Informationslücken auszugleichen und (individuelles) Erfahrungswissen weiterzugeben, verlagerten viele der Organisationsvertreter*innen den Informationsaustausch auf informelle Wege, beispielsweise auf bestehende persönliche Kontakte [19, 63]. Dieser informelle Austausch nahm bspw. für die Kommunalverwaltung in Bad Fallingbostel eine wichtige Rolle ein, da sie zunächst nicht in die offiziellen Lagebesprechungen einbezogen worden sei [63]. Auch in Berlin, Bramsche-Hesepe und Trier hat es informelle Gesprächsrunden oder teilweise sogar gegenseitige Besuche an den Unterkünften gegeben [29, 30, 47, 55,56,57,58,59]. So haben bspw. Mitarbeitende aus umliegenden Unterkünften die Kinderbetreuung – ‚Spielstube‘ – in der AfA Trier regelmäßig besucht und von der dortigen langjährigen Erfahrung profitiert [27, 28]. An den Standorten sind sich die beteiligten Organisationen auch bereits aufgrund früherer Einsatzsituationen oder der regelmäßigen Zusammenarbeit vor Ort bekannt gewesen, was einen informellen Austausch erleichterte [26].
Erfahrungen und Wissen können auch über informelle Wege, wie persönliche Kontakte oder gegenseitige Besuche, geteilt werden, wie folgendes Beispiel verdeutlicht.
Beispiel: Informeller Wissensaustausch innerhalb des DRK
Während der Flüchtlingssituation 2015/16 übernahmen der DRK Kreisverband (KV) Trier-Saarburg e. V., weitere Kreisverbände und der Landesverband (LV) Rheinland-Pfalz e. V. viele Aufgaben in der Flüchtlingshilfe – sowohl in Trier als auch in ganz Rheinland-Pfalz. Im Rahmen eines Interviews berichteten Vertreter*innen des DRK, dass der LV einen ständigen Austausch und Kontakt zwischen den involvierten KV koordiniert und gefördert hat, um den Wissenstransfer sicherzustellen [27]. Dies habe ermöglicht, bereits bestehende Erfahrungen und gelungene Konzepte mit Blick auf die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten DRK-intern auszutauschen. Die vom LV seit Juli 2015 betriebene Unterkunft in Ingelheim hat dabei eine besondere Rolle gespielt, denn die dort gewonnenen Erkenntnisse und bewährten Vorgehensweisen seien somit schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Flüchtlingshilfe vorhanden gewesen [25]. Innerhalb von regelmäßigen Austausch-Treffen mit dem LV in Mainz wurde das Wissen aus den verschiedenen Unterkünften diskutiert, gesammelt und aufbereitet. Teilweise wurden schriftliche Dokumentationen von u. a. Ablaufplänen aus einzelnen Unterkünften auch an die Landesstelle in Mainz weitergeleitet, welche das Wissen sukzessive an die einzelnen KV streuen konnte. Der LV publizierte in der Nachbetrachtung der Flüchtlingshilfe zudem die Broschüre „Überall Zuhause. Respekt für Vielfalt. Flüchtlingshilfe des Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz“, welche Informationen zu den Aufgaben des DRK-Flüchtlingseinsatzes sowie Steckbriefe zu 23 DRK-Unterkünften in Rheinland-Pfalz enthält. Eine sehr wichtige Rolle haben auch die gegenseitigen Besuche von verschiedenen DRK-Mitarbeiter*innen in den Unterkünften gespielt. Beispielsweise kam es oft dazu, dass Akteure aus umliegenden Aufnahmeeinrichtungen die AfA Trier besuchten, da der KV Trier-Saarburg seit 1997 die dortige Spielstube betreibt. Die langjährigen Erfahrungen rund um die Betreuung der Kinder konnte somit vor Ort und innerhalb persönlicher Gespräche vermittelt werden. Diese Form der Wissensvermittlung wurde gegenüber einer schriftlichen Informationsweitergabe als gewinnbringender beschrieben [28]. Auch die Unterkunft in Hermeskeil wurde oft aufgesucht, um die dortigen, bereits früh dokumentierten und noch während der Lage verbesserten Arbeitsabläufe kennenzulernen. Der von dem LV koordinierte enge Kontakt und rege Austausch zwischen den KV, die in der Flüchtlingshilfe involviert waren, ermöglichte einen stetigen Wissenstransfer zwischen den Unterkünften.
Neben diesen informellen Treffen haben aber auch formellere Treffen stattgefunden, in denen die beteiligten Akteure ihr Wissen teilen und sich vernetzen konnten. Innerhalb dieser regelmäßigen oder nach Bedarf angeordneten (Lage-)Besprechungen oder ‚Runden Tischen’ konnten zudem der aktuelle Informationsstand kommuniziert und Organisationsstrukturen und -zuständigkeiten zeitnah geklärt werden [19, 32, 34, 35, 47, 61]. Aus Gesprächen mit Akteuren in Berlin wurde jedoch auch deutlich, dass der organisationsübergreifende Austausch von hierarchischen Strukturen, Vertraulichkeitsregeln und Zuständigkeitsfragen geprägt gewesen war, wodurch eine transparente Wissens- und Informationsweitergabe sowie deren praxisnahe Anwendung gehemmt wurden [47, 53]. In Bramsche-Hesepe wurde außerdem seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass die Besetzung der Gremien grundsätzlich lageangepasst erfolgen sollte, denn nicht immer hätten die im Stab aktiven Akteure das notwendige Situationswissen gehabt [61].
Innerhalb von regelmäßigen Lagebesprechungen und ‚Runden Tischen’ kann situationsspezifisches Wissen organisationsübergreifend besprochen und gestreut werden. Der Umgang sollte jedoch möglichst klar geregelt, transparent und zielgerichtet sein.
Die Bedeutung von Kommunikation und Transparenz wird insbesondere hinsichtlich des folgenden Beispiels aus Perspektive der privaten Sicherheit deutlich. Darin zeigt sich, warum eine Teilhabe sowohl an informellen als auch formellen Austauschformaten so wichtig ist, um im Einsatz gut vernetzt und informiert zu sein.
Beispiel: Eindrücke der privaten Sicherheit zum Wissensaustausch
In mehreren Fallstudien des Forschungsprojekts SiKoMi berichteten die in Aufnahmeeinrichtungen eingesetzten privaten Sicherheitsunternehmen von teils erheblichen Problemen im Informationsaustausch mit anderen Akteuren. Organisationsübergreifende Besprechungen hätten stets ohne ihre Beteiligung stattgefunden.
Als Grund für den von ihnen wahrgenommenen Ausschluss aus dem Austausch vermuten die Interviewpersonen Vorbehalte ihnen gegenüber, insbesondere seitens der Sicherheitsbehörden, welche die Vertraulichkeitsregeln gegenüber Dritten teils sehr strikt ausgelegt hätten, obwohl auch bspw. die Polizei zur transparenten Zusammenarbeit mit privaten Sicherheitsdienstleistern angehalten ist [64, S. 25–26]. Zugleich war allerdings in Interviews mit Vertreter*innen der Branche zu vernehmen, dass diese künftig auch ein aktiveres Einfordern der Partizipation in Kreisen der Sicherheitskooperationen als hilfreich erachte.
Die Abwesenheit in den Runden des interorganisationalen (Wissens-)Austausches erschwerte es den privaten Sicherheitsdiensten zudem, sich den anderen Beteiligten auf persönlicher Ebene bekannt zu machen, sowie ihre praktischen Erfahrungen und fachliche Expertise herauszustellen. Private Sicherheitsakteure sind häufig 24/7 in den Einrichtungen vor Ort und damit deutlich intensiver als die meisten anderen Akteure. Neben ihren vertraglich vereinbarten Pflichten übernehmen sie im Laufe der Zeit häufig unter der Hand auch andere Dienstleistungen wie kleinere Übersetzungstätigkeiten, psychosoziale Betreuung und anderes. Hierbei erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können für die gesamte Akteursgemeinschaft von Interesse sein und zugleich dabei helfen, Kenntnisse (bspw. hinsichtlich Befugnissen und Kompetenzen) über privaten Sicherheitsdienstleister zu gewinnen und Vorbehalte abzubauen.
Aus der Perspektive interorganisationalen Wissensmanagements wird auf diese Weise eine Gelegenheit verpasst, Informationen auszutauschen und Kenntnisse weiterzugeben, um eine gemeinsame Basis in einem organisationsübergreifend geteilten mentalen Modell – also ein gemeinsames Verständnis bzgl. der Herausforderung, der Zielsetzung und der Handlungswege – zu erreichen [3].
Informationen aus diesen Runden sind stattdessen häufig informell mündlich an die private Sicherheit weitergegeben worden – zumeist in Gesprächen mit dem Betreiber der Aufnahmeeinrichtung. Diese bilaterale Beziehung wird von beiden Partnern als vertrauensvoll und belastbar beschrieben. Die Aufnahmeeinrichtungen nennen die private Sicherheit mehrheitlich als ihren wichtigsten Partner in der Bearbeitung der Flüchtlingssituation 2015/2016. Die guten Beziehungen zwischen Aufnahmeeinrichtungen und privater Sicherheit beruhen häufig auf einer bereits vor der Lage gewachsenen Zusammenarbeit.
Die berichteten Erfahrungen der privaten Sicherheit zeigen, dass nicht alle Akteure einen gleichwertigen Zugang zu Austauschformaten und dem darin geteilten Wissen hatten. Zudem zeigt sich, wie eng Wege der Vernetzung und des Wissensaustausches verknüpft sind. Der Wissensaustausch auf interorganisationaler Ebene war teilweise durch Hierarchien, Vorurteile und ungeklärte Zuständigkeiten geprägt. Dadurch wurden Gelegenheiten verpasst, um wichtige Erfahrungswerte und Wissensstände zwischen den beteiligten Akteuren zu teilen und von der Expertise anderer zu profitieren.
Im Kontrast dazu wurde im Rahmen der Interviews jedoch auch berichtet, dass vielfach versucht wurde das dokumentierte und/oder erinnerte Wissen an andere Akteure oder Personen der eigenen Organisation weiterzugeben. In Berlin wechselten amtliche Zuständigkeiten noch während des Flüchtlingseinsatzes, weshalb Projekterkenntnisse und Konzepte 2016 an die Nachfolgeorganisation des LAGeSo weitergegeben wurden [53, 56]. Polizeiliche Akteure aus Trier berichteten, dass bestimmtes Wissen für Fortbildungen oder organisationsübergreifende Workshops aufbereitet wurde und Seminare zu interkultureller Kompetenz mit neuen Erkenntnissen angereichert werden konnten [34]. Aber auch direkt in der akuten Lage habe erworbenes Wissen in konkrete Handlungen umgewandelt werden können. So gaben die Vertreter*innen der privaten Sicherheit in Trier an, dass Informationen nach ihrem Erhalt sehr schnell in konkrete Handlungen umgewandelt werden konnten. Oftmals habe dabei ein telefonischer Kontakt bestanden und die Improvisation und der persönliche Kontakt seien zu einer bewährten Taktik geworden [46]. Am Fallstandort Berlin wurde ebenso darauf hingewiesen, dass in der Flüchtlingssituation gewonnenes Wissen teilweise direkt in neue Konzepte, Aufgaben und Entscheidungen umgewandelt werden konnte [47].
In der Lage erworbenes Wissen kann noch in derselben Lage praktisch angewendet sowie durch Adaption in Konzepten oder Seminaren weitergegeben werden.
Reflexionsfragen:
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wo der Wissensaustausch ggf. noch angepasst werden kann, denken Sie an Ihren Einsatz im Rahmen der Flüchtlingshilfe 2015/16 oder an einen anderen Einsatz der letzten Monate oder Jahren, der für Sie prägend war (bspw. COVID-19-Pandemie, Hochwasserkatastrophe) und gehen Sie folgende Fragen durch:
-
Welche Formen des Austausches nutzten Sie und welche Vor- bzw. Nachteile können Sie für sich daraus mitnehmen?
-
Wurden bei den organisationsübergreifenden Treffen primär Informationen ausgetauscht oder konnten Sie dadurch auch neue Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln, die für zukünftige Einsätze nutzbar sind?
Konnten gemachte Erfahrungen bereits in Seminare, Fort- und Weiterbildungen oder Hilfsmaterialien einfließen, um Wissenslücken zu schließen?
Ein Beispiel für unmittelbar aus dem Flüchtlingseinsatz 2015/16 abgeleitetes und aufbereitetes Wissen ist ein Handbuch zu Interkulturellem Bevölkerungsschutz, welches durch die Johanniter-Unfall-Hilfe entwickelt wurde. Daher soll im folgenden Kapitel exemplarisch aufgezeigt werden, wie durch die Entwicklung des Handbuchs auf die im Einsatz identifizierte Bedarfe reagiert wurde, um einen Mehrwert für zukünftige ähnliche Situationen zu generieren.
4.4.2 Handbuch Interkultureller Bevölkerungsschutz
Hintergrund Flüchtlingssituation
Die humanitäre Leistung während der Flüchtlingssituation 2015/16 brachte den inländischen Bevölkerungsschutz sowie Städte und Gemeinden an die Belastungsgrenzen.
Einsatzkräfte ohne vorherige Berührungspunkte mit Menschen mit Fluchterfahrung standen vor der Herausforderung, eine entsprechende Einsatzlage zu bewältigen. Die Einsatzart entspricht dabei einer Betreuungslage, dem Standardrepertoire einer jeden Katastrophenschutzeinheit. In diesem Fall jedoch handelte es sich um eine Einsatzlage, welche sich über einen deutlich längeren Zeitraum erstreckte und durch interkulturelle Faktoren für alle Beteiligten eine Herausforderung war.
Um Fehler zu vermeiden, Unsicherheiten abzubauen und Hürden zu überwinden wendet die Luftfahrtbranche das sogenannte Crew Ressource Management (CRM) an. Sukzessive hält dieses auch in der Notfallmedizin Einzug und gewinnt im Bevölkerungsschutz zunehmend an Bedeutung. Rall et al. definierten 15 CRM-Leitsätze, wovon einer lautet: „Verwende Merkhilfen und schlage nach.“ [17] Im Rahmen des Forschungsprojektes WAKE entwickelte die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), vertreten durch die Johanniter-Akademie Mitteldeutschland deshalb ein Handbuch für den interkulturellen Bevölkerungsschutz, um Einsatzkräften eine Hilfestellung für derartige Einsatzlagen an die Hand zu geben.
Entwicklung des Handbuchs
Dieses Handbuch basiert auf den Bedarfen, die in der Projektzeit identifiziert wurden. Diese Bedarfe ergaben sich erstens aus Interviews mit JUH-Einsatzkräften, die während der Flüchtlingssituation 2015/16 in der Ad-hoc-Lage eingesetzt waren. Zweitens ergaben sie sich aus der Sichtung der Leitfäden der Katastrophenschutzausbildung innerhalb der JUH, in der bis dato keine spezifischen Inhalte zu Interkulturalität verankert sind. Drittens fand im Februar 2020 an der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland ein interorganisationaler WAKE-Workshop zur Ausbildung im Bevölkerungsschutz statt. Die Teilnehmenden der deutschen und österreichischen Hilfsorganisationen haben hierbei unisono auf die Wichtigkeit interkultureller Kompetenzen für die Ausbildung und den Einsatz im Bevölkerungsschutz hingewiesen. Die erfassten Kompetenzen aus Interviews, Workshop und Literaturrecherche finden sich im interkulturellen Handbuch wieder und sollen im Sinne eines nachhaltigen Wissensmanagements den Akteuren im Bevölkerungsschutz zugänglich gemacht werden. Das Handbuch bietet somit einen gemeinsamen Wissensspeicher und soll einen Beitrag zur interkulturellen Ausbildung in den Organisationen leisten.
Das Handbuch soll aus den Erkenntnissen aus 2015/2016 einen Beitrag für die Zukunft des Bevölkerungsschutzes leisten, der sich höchstwahrscheinlich in der nahen Zukunft mit gleichartigen Problematiken betraut sieht. Es dient vorwiegend der Stärkung des gegenseitigen Verständnisses in interkulturellen Situationen, der Konfliktprävention, dem Einschätzen fremder und eigener Bedürfnisse, der Professionalisierung der Einsatzkräfte und der Stärkung des Rollenverständnisses.
Themenspektrum des Handbuchs
Im Handbuch wird ein breites Spektrum an Themen rund um die Flüchtlingshilfe abgebildet. Der Fokus liegt dabei auf Aspekten der Interkulturalität im Bevölkerungsschutz. Themen wie Selbst- und Fremdreflexion, Umgang mit Flüchtlingen mit Gewalterfahrungen, Interkulturelle Kommunikation sowie Distanzzonen und Körpersprache in der Kommunikation liegen im Fokus. Das Erkennen und die Stärkung der eigenen Rolle in der Lage ist wichtig, um die Resilienz der Einsatzkräfte zu stärken. Kurzum soll das neu geschaffene Handbuch, zumindest im Kleinen, kulturelle Barrieren in der Einsatzlage abbauen und bestenfalls überwinden. Für Spontanhelfende bietet das Handbuch zu Beginn eine kurze Einführung in das System des deutschen Bevölkerungsschutzes, um den freiwillig Helfenden eine Orientierungshilfe zu bieten.
Um den Einsatzkräften in der Lage schnelle Handlungsanweisungen zu vermitteln, ist es nach dem Schema „Vorgang – Hintergrund – Handlungsempfehlung“ aufgebaut. Sollten Hilfeempfangende bspw. Gewalterfahrungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit äußern, lässt sich der Hintergrund zu Gewalt im ethnischen Kontext nachschlagen und eine Handlungsempfehlung, wie Separation nach Gruppen für die Ad-hoc-Situation ableiten.
Das Handbuch kann aufgrund der Bandbreite der Themen in der Flüchtlingshilfe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Verbindlichkeit erheben. Je dynamischer das Weltgeschehen ist, desto dynamischer und vielfältiger entwickeln sich auch die (inter-)kulturellen Facetten. Nichtsdestotrotz kann es Einsatzkräften eine Orientierung in verschiedenen Einsatzsituationen bieten und den Rahmen der Handlungssicherheit erweitern.
4.5 Wissen nutzbar machen
Die beteiligten Akteure der Flüchtlingshilfe 2015/16 konnten im Einsatz vereinzelt auf bereits vorhandene Hilfs- und Informationsmittel zurückgreifen, welche aus vorherigen Einsätzen und Erfahrungen hervorgegangen sind. Zudem nutzen sie verschiedene Formate des Wissensaustauschs, um auch während des Einsatzes an neue Informationen zu gelangen, Wissensstände miteinander zu teilen und sich zu vernetzen. Die damalige Situation wurde vielfach als herausfordernd und anspruchsvoll wahrgenommen. Im Zuge der Bewältigung des Einsatzes konnten daher neue Erkenntnisse gewonnen, bewährte Methoden abgeleitet und offene Bedarfe identifiziert werden. Dieses Unterkapitel setzt sich mit der Frage auseinander, wie Wissen und Erfahrungen aus der Flüchtlingshilfe 2015/2016 nutzbar gemacht und weitergegeben wurden.
Dafür wird zunächst ein Rückblick auf den Einsatz aus Perspektive der beteiligten Akteure gegeben und darin praktizierte Formate des Wissensmanagements zusammengefasst. Zudem sollen auch die Hindernisse aufgezeigt werden, welche sich bei der Nutzbarmachung von Wissen ergeben haben. Dabei wird deutlich, dass weiterhin ein Wunsch zum Ausbau und der Weiterentwicklung von Wissensmanagement innerhalb der beteiligten Akteure des Bevölkerungsschutzes besteht. Diesem Wunsch entsprechend, schließt dieses Unterkapitel mit einer praktischen Übung ab, in der eine schrittweise Anleitung vorgeschlagen wird, wie eine Evaluation des Wissensmanagements für Akteure des Bevölkerungsschutzes erfolgen könnte.
4.5.1 Rückblick: Weitergabe von Wissen
Für die Weitergabe von Wissen wurden Formate und Strategien, wie niedergeschriebene Hilfsmittel, genutzt, insbesondere um Wissen nachhaltig aufzubereiten und somit für zukünftige Lagen nutzbar zu machen. An allen Standorten lassen sich, zusätzlich zu Checklisten und Handlungsempfehlungen, noch weitere Arten des praktizierten Wissensmanagements feststellen, die bereits während der Lage angefertigt wurden: u. a. Lageberichte, Protokolle, persönliche Notizen und E-Mails, Rundbriefe, Newsletter, Regionalkarten, interne Datenbanken [53, 54, 57,58,59]. Die Polizei in Bad Fallingbostel hielt einsatzrelevantes Wissen bspw. im polizeilichen Einsatzdokumentationssystem fest [44], die dortige JUH dokumentierte ihre Arbeit in Form von Einsatzprotokollen und erstellte Dokumentationen, welche Meldungen im Stab ankamen und herausgegeben wurden [33]. Der Führungsstab Flüchtlinge des Landes Rheinland-Pfalz (FFRLP) brachte ein tägliches Datenblatt mit aktuellem Faktenwissen heraus, das primär an alle an der Flüchtlingslage beteiligten staatlichen Organisationen, etwa an die Landesregierung und Sicherheitsbehörden, weitergeleitet wurde. Das Datenblatt verzeichnete unter anderem die erwarteten Neuankünfte, wobei weniger die absolute Exaktheit der Zahl sondern eine gemeinsame Außendarstellung der beteiligten staatlichen Akteure der Zweck des Datenblattes war [51]. Während der Einsatzsituation gewonnenes Wissen wurde in Trier auch organisationsübergreifend festgehalten: Das in der Fallregion Trier zuständige rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration (MFFJIV) führte bspw. gemeinsam mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) einen auch über die akute Lage hinaus bestehenden Cloud-Dienst, wobei kritisiert wurde, dass Informationen nicht immer aktualisiert wurden [52]. Innerhalb der Organisationen wurde das Wissen demnach unterschiedlich intensiv und auf verschiedene Art und Weise dokumentiert. Aus Berlin kam bspw. der Hinweis, dass eine zeitnahe Dokumentation der Lage durchaus als sinnvoll erachtet wurde, aufgrund der Dynamik der Lage, personeller Engpässe und fehlender Expertise sei dies jedoch nicht immer möglich gewesen [23, 40, 53, 56].
Eine zeitnahe Dokumentation der gewonnenen Erfahrungswerte kann sehr verschiedene Formen annehmen und ist sehr wertvoll, kann in einer akuten Lage jedoch herausfordernd sein.
Eine unmittelbare Dokumentation ist besonders während noch andauernden Lagen eine Herausforderung. Mit fortschreitenden digitalen Entwicklungen, entstehen jedoch auch für das Wissensmanagement weitere technische Möglichkeiten, die für eine zeitnahe Speicherung, Dokumentation und Streuung von Wissen nutzbar gemacht werden können. Daher sollen im folgenden Beispiel die Erfahrungen und die Vorgehensweise des MFFJIV bezüglich der Einrichtung einer Internetanwendung zum Austausch von Daten detaillierter beschrieben werden.
Beispiel: Digitaler Wissensaustausch zwischen Ministerium und Verwaltung
Eine niedrigschwellige Möglichkeit des interorganisationalen Wissensmanagements besteht in der Nutzung geeigneter Internetanwendungen (Cloud-Management-Systeme) zum Austausch von Dateien. Ein für die Bearbeitung der Flüchtlingssituation zuständiges Landesministerium hat zunächst innerhalb des eigenen Hauses gute Erfahrungen damit gemacht, Dokumente über Referats- und Abteilungsgrenzen in einem solchen System bereitzustellen. Ausgewählte Stellen im Haus erhielten die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff und die Verwaltung der Dateien.
Infolge der guten Erfahrungen wurde schließlich eine Öffnung der Dateiverwaltung über das Ministerium hinaus ermöglicht. Auch externe Stellen bekamen die erforderlichen Rechte, um auf die Daten zugreifen zu können. So konnte die zuständige Behörde für die Verwaltung der Aufnahmeeinrichtungen im Bundesland dann ebenfalls Dokumente einsehen, teilen und aktualisieren. Im konkreten Fall wurden vor allem Musterverträge, zentrale Daten und Kontakte bereitgestellt. Die interorganisationale Öffnung bedurfte einiger Vorbereitungszeit im Ministerium. Im Verlauf der Lage wanderte die Verwaltung des Wissensmanagements in der Cloud vom Ministerium zu der genannten Behörde [52].
In diesem konkreten Fall wurde berichtet, dass die Pflege der bereitgestellten Daten eine Herausforderung gewesen sei. Daten und Wissen auf einem aktuellen Stand zu halten, sei schwieriger als gedacht, erst recht, wenn keine dezidierte Stelle hierfür zuständig sei. Hieraus kann eine allgemeine Empfehlung abgeleitet werden. Neben dem Einpflegen neuer Dokumente ist dabei auch auf die Löschung von veralteten Dokumenten zu achten. Ältere Versionen von Vorlagen, Verträgen, Organigrammen und ähnlichem sollten nicht neben den aktuellen bestehen bleiben, um Verwechslungen zu vermeiden. Regelmäßige Back-Ups sind notwendig. Außerdem sind die Bearbeitungsrechte mit Bedacht zu vergeben. Nicht jede beteiligte Stelle oder Person muss zu allem berechtigt sein.
Digitale und technische Hilfsmittel, wie z. B. Datenbanken, können Prozesse des Wissensmanagements unterstützen und vereinfachen sowie den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren erleichtern. Die Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz zeigen jedoch, dass auch die Verwaltung und Nutzung von derartigen Hilfsmitteln arbeitsintensiv ist. Diese können nur im vollen Umfang genutzt werden, wenn ein regelgeleitetes Vorgehen etabliert sowie entsprechende Zuständigkeiten und Berechtigungen klar verteilt sind.
Technische Instrumente könnten auch dabei helfen auf ein gängiges Problem zu reagieren, welches vielfach beschrieben wurde. Und zwar, dass Wissen häufig personengebunden ist und damit in Gefahr steht, verloren zu gehen, wenn keine ausreichenden Dokumentationen existiert [35, 41]. In einigen Fallregionen wurde Wissen in persönlichen Notizen gesammelt und Präsentationen angefertigt [62, 70]. Eine strukturierte Nachbereitung des gewonnenen Wissens habe es, laut der Mehrheit der Interviewpersonen, kaum gegeben [33, 62, 63].
Wissen kann stark personengebunden sein. Ein (Arbeits-)Wechsel der beteiligten Akteure bedeutet dann einen Verlust von Expertise.
Wie dem Verlust von Wissen und Expertise beim Wechsel von Zuständigkeiten oder Mitarbeitenden entgegengewirkt werden kann, zeigt ein Beispiel der Polizei in Berlin. Dort wurde ein Registrierungsvorgehen eingerichtet, um in der zum Teil unübersichtlichen Lage handlungsfähig zu bleiben und ein strukturiertes Vorgehen sicherzustellen.
Beispiel: Anwendung von Erfahrungen und Expertise der Polizei
Um die bestehenden Registrierungsstellen des LAGeSo und der Polizeidienststellen in Berlin zu entlasten, wurde im September 2015 eine weitere Registrierungsstelle in einer polizeilichen Liegenschaft eröffnet. Infolge der nur langsam vorangehenden Registrierung von Geflüchteten vor allem zu Beginn der Flüchtlingssituation kam es teilweise zu dramatischen Szenen und Tumulten vor den Registrierungsstellen. Um diesen Umständen entgegenzuwirken, unterstützte die Polizei das Registrierungsverfahren sowohl fachlich als auch personell, da sich u.a. das bis dahin angewandte Registrierungsvorgehen für die Vielzahl der zu registrierenden Personen in der dynamischen Lage nicht eignete. Eine Anpassung der Abläufe fand mithilfe der Beratung seitens einer Polizeieinheit statt, die auf polizeilichen, technikgestützten Konzepten basierte [36, 38,39,40,41].
Hierfür brachte die Polizei in Berlin ihr Fachwissen in Bezug auf sogenannte Bearbeitungsstraßen ein und teilte dieses gleichzeitig mit dem LAGeSo und der Bundeswehr. Gemeinsam mit LAGeSo-Mitarbeiter*innen wurde das Vorgehen zur Registrierung von Asylsuchenden so angepasst, dass eine schnellere Registrierung und somit auch Unterbringung möglich waren. Die erfolgreiche Integration des polizeilichen Wissens habe trotz anfänglicher Vorbehalte zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Polizei geführt, so eine Interviewperson. Die Erfahrungen und daraus resultierenden Aufgaben und Anforderungen wurden u.a. im Rahmen von Tätigkeitsprofilen festgehalten, sodass dieses Wissen von neuen Mitarbeiter*innen nachvollzogen werden konnte. Des Weiteren wurden neu hinzukommende Hilfskräfte der Registrierungsstellen durch Einführungskurse auf ihre Tätigkeit vorbereitet [36,37,38, 40]. Im Jahr 2016 nahm das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) seine Arbeit auf und etablierte auf Grundlage des beschriebenen Registrierungsvorgehens eine zentrale Ersterfassung für Asylsuchende in Berlin [9, 10, 36, 38,39,40].
Ausgehend von dem beschriebenen Vorgehen der Polizei in Kooperation mit dem LAGeSo in Berlin zeigt sich, welche Vorteile und Entlastungen ein strukturiertes Wissensmanagement im Einsatz mit sich bringen kann. Das polizeiliche Wissen konnte erfolgreich für den Ablauf und das Verfahren des Registrierungsprozesses verarbeitet und auf diese Weise die hohe Anzahl von ankommenden Geflüchteten besser bewältigt werden. Dadurch wurden auch die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen der beteiligten Akteure gestärkt. Diese bewährten Praktiken wurden zudem auch im weiteren Verlauf und im Nachgang des Einsatzes angewandt, indem sie in die Erarbeitung von Tätigkeitsprofilen und Einführungskursen für neue Mitarbeitende und Hilfskräfte einflossen sowie für nachfolgende Akteure zugänglich gemacht wurden.
Der dargestellte Rückblick zeigt, dass akteurs- und standortunabhängig verschiedene Konzepte und Strategien angewandt wurden, aber auch diverse Lücken und Bedarfe zum Vorschein traten. Gemein ist jedoch allen befragten Akteuren der Wunsch nach mehr bzw. einem effizienteren Wissensmanagement, sei es organisationsintern oder im Austausch mit anderen.
Beispielsweise am Standort Bramsche-Hesepe wurde der Wunsch nach einem strukturierten, organisationsübergreifenden Wissensmanagementsystem laut, in dem das Erfahrungswissen interorganisational gebündelt und weitergegeben werden könnte [42, 43]. Ein Hindernis stellten aber bspw. datenschutzrechtliche Richtlinien dar: So darf die Polizei bspw. nicht ohne Weiteres taktische oder personenbezogene Informationen offenlegen [43]. Ebenfalls in Bramsche-Hesepe sprachen sich die Organisationsvertreter*innen für mehr Kreativität und Flexibilität im Umgang mit der Lage aus. Dazu gehörten u. a. auch das Aufbrechen der Verwaltungsstrukturen, um derart dynamische Lagen bewältigen zu können oder gemeinsame Übungen, damit bspw. die beteiligten Organisationen gegenseitig die jeweiligen Handlungsspielräume und Kompetenzen kennenlernen können [60, 61]. Letzteres bemängelte insbesondere die private Sicherheit, denn teilweise sei sie aufgrund fehlender oder vorurteilsgeprägter Kenntnisse über ihren konkreten Aufgabenbereich nicht in den interorganisationalen Informationsfluss miteinbezogen worden (was für die private Sicherheit offenbar ein wiederkehrendes Phänomen ist: vgl. Abschn. 4.4.1 für einen ähnlichen Bericht aus Trier) [48].
Es besteht der Wunsch nach einem strukturierten, organisationsübergreifenden Wissensmanagementsystem und gemeinsamen praktischen Übungen.
Die Erfahrungen an den verschiedenen Standorten und die unterschiedlichen Akteure zeigen, dass ein gelingendes Wissensmanagement von vielen Faktoren abhängt. Damit Wissen und Ziele definiert werden können und Erfahrungen und Expertise nicht verloren gehen, bedarf es eines für die jeweiligen Akteure im Bevölkerungsschutz angepassten Vorgehens. Ein praktiziertes Wissensmanagement ist daher immer individuell und muss von innen heraus erfolgen. Im folgenden Kapitel wird der Ausschnitt eines Leitfadens vorgestellt, der Akteuren im Krisenmanagement dabei helfen soll eine Bestandsaufnahme ihrer Wissensmanagementprozesse vorzunehmen, um diese zu bewerten und weiterzuentwickeln.
4.5.2 Anleitung zur Selbstevaluation des Wissensmanagements im Bevölkerungsschutz
Besonders im Bevölkerungsschutz mit den vielen verschiedenen Akteuren sowie unterschiedlichen strukturellen und organisationalen Voraussetzungen ist die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Wissensmanagementsystems eine Herausforderung. Um Einsätze, Großschadenslagen oder sogar Krisensituationen zu bewältigen, besitzt und benötigt jede Organisation bzw. Behörde individuelles und spezifisches Wissen. Es kann daher für die Analyse und Evaluation des organisations- und behördenspezifischen Wissensmanagements keinen allgemeingültigen Ansatz geben [8].
Um Akteuren im Bevölkerungsschutz dennoch die Möglichkeit zu geben, ihre Wissensmanagementansätze individuell zu bewerten und zu verbessern, entwickelt die TH Köln im Rahmen des Forschungsprojektes WAKE eine Anleitung zur selbstständigen Evaluation des Wissensmanagements für BevS-Akteure. Diese soll allen Behörden und Organisationen in der Praxis helfen, den aktuellen Stand der bereits etablierten Wissensmanagementmethoden zu analysieren und auf die jeweilige Organisation oder Behörde zugeschnittene Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu finden. Dazu werden den Nutzer*innen einige Leitfragen gestellt und mit Hilfe der gegebenen Antworten die individuelle Situation der Organisation bzw. Behörde erfasst. Darauf aufbauend können dann konkrete Handlungsempfehlungen identifiziert werden. Der Leitfaden wurde zudem bewusst organisations- und behördenübergreifend entwickelt, um eine praxisnahe Nutzung zu ermöglichen.
Hintergründe der Selbstevaluation
Auf Basis der wissenschaftlichen Ansätze zum WissensmanagementFootnote 2 und des Wissenskreislaufs nach Probst et al. (2012) (siehe 4.2 „Einführung in das Wissensmanagement“) wurden von der TH Köln Analyse- und Evaluationskriterien, die den Kernprozessen von Wissensmanagement zugeordnet sind, entwickelt. Aus diesen Kriterien wurden anschließend Fragen entwickelt, welche in einer Anleitung zur Selbstevaluation gesammelt wurden. Mithilfe dieser Selbstevaluation kann die bisherige Wissensverwaltung der Akteure des Bevölkerungsschutzes analysiert und evaluiert werden. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend werden dann Verbesserungs- bzw. Anpassungsmöglichkeiten für die Operationalisierung des Wissensmanagements in den Organisationen und Behörden abgeleitet. Anhand der durch die Beantwortung der Leitfragen erkannten Lücken und Optimierungsbedarfe können individuelle Handlungsempfehlungen gegeben werden, weshalb die Anleitung so gestaltet wurde, dass sie für jeden BevS-Akteur nutzbar ist. Diese Handlungsempfehlungen wurden mithilfe der in WAKE erhobenen Daten und der geführten Gespräche formuliert und an die einzelnen Bedarfe der Akteure im Bevölkerungsschutz angepasst.
Als Basis für die Anwendung der Anleitung zur Selbstevaluation sollten Organisationen und Behörden bestenfalls einige grundlegende Maßnahmen ergreifen und bereits Merkmale aufweisen, die ein gutes Wissensmanagement fördern. Zunächst wird ein erster Überblick geschaffen, um die Stärken und Schwächen bzw. Verbesserungspotenziale des Wissensmanagements einer Organisation oder Behörde zu identifizieren. Darüber hinaus kann jede Organisation bzw. Behörde entscheiden, welche Bestandteile des Wissenskreislaufs für die jeweilige Tätigkeit bzw. das jeweilige Einsatzgebiet Priorität haben. Wenn zum Beispiel für einen Akteur externes Wissen in einem Bereich keine Relevanz hat, da alle benötigten Expert*innen innerhalb der Organisation vorhanden sind, dann ist die Gewichtung in diesem Bereich als sehr gering zu wählen. Ausgehend von den im Forschungsprojekt WAKE erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann ein Wissensmanagementsystem allerdings nur erfolgreich sein, wenn alle Bestandteile zumindest Beachtung finden und sehr bewusst entschieden wird, wo Prioritäten gesetzt werden. Die Anleitung zur Selbstevaluation soll eine Hilfe dabei sein, die einzelnen Bestandteile zu identifizieren und zu priorisieren, damit im nächsten Schritt eindeutige Maßnahmen empfohlen werden können, die zur erfolgreichen Etablierung eines umfassenden Wissensmanagements nötig sind.
Natürlich unterliegt die Beantwortung dieser Leitfragen und die darauf aufbauende Einschätzung der Umsetzungsqualität der Bestandteile individuellen Schwankungen durch die Nutzer*innen, sodass innerhalb einer Organisation oder Behörde durchaus verschiedene Einschätzungen getroffen werden können. Deshalb stellt die Anleitung zunächst nur eine Orientierung für vorhandenes Verbesserungspotential dar und kann eine individuelle Beratung und Auseinandersetzung mit dieser Thematik vor Ort nicht ersetzen. Um konkrete Maßnahmen erarbeiten zu können, muss in jedem spezifischen Fall eine individuell zugeschnittene, praktische Analyse und Evaluation erfolgen. Trotzdem bietet der Leitfaden nicht nur wertvolle Anhaltspunkte dazu, wie der grundlegende Umgang mit Wissen in der jeweiligen Organisation festgestellt und bewertet werden kann, sondern auch welche organisations- und behördenspezifischen Besonderheiten zum Umgang mit Wissen zu beachten sind.
Praktische Umsetzung der Selbstevaluation
Um die Selbstevaluation möglichst praxisorientiert zu gestalten, wurden Leitfragen erarbeitet, welche Sie durch die Anleitung führen. Zur Beantwortung der Fragen werden keinerlei Kenntnisse über Wissensmanagement benötigt. Lediglich die Strukturen und das Vorgehen bzw. die Prozesse innerhalb der eigenen Organisation oder Behörde werden abgefragt. Um diese Herangehensweise und den genauen Ablauf zu verdeutlichen, wird im Folgenden beispielhaft der Kernprozess „Wissen bewahren“ als Übung dargestellt. Dieser Prozess beschreibt die Sammlung, Speicherung und Aufarbeitung von gemachtem Wissen für spätere (Einsatz-)Szenarien. Da die Entwicklung und Ausarbeitung des ganzen Prozesses, vor allem aber der Handlungsempfehlungen, als Teil des Forschungsprojektes WAKE zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags noch nicht abgeschlossen ist, werden diese lediglich beispielhaft genannt und sind sehr allgemein und rudimentär dargestellt. Die fertige Anleitung soll mithilfe eines interaktiven Mediums gestaltet werden, um die Bedingung zu erleichtern und umfangreiche individuelle Empfehlungen aussprechen zu können. An dieser Stelle haben Sie vorab die Möglichkeit, durch eine exemplarische Bearbeitung des Bausteins „Wissen bewahren“ die Vorgehensweise der Selbstevaluation kennenzulernen und auf Ihre Organisation oder Behörde anzuwenden. Die Darstellung der anderen Prozesse des Wissensmanagementkreislaufes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Gerne sind Sie dazu eingeladen, bei Fertigstellung der Selbstevaluation auch die anderen Bausteine auszufüllen und weitere Schritte zu einem vollumfänglichen Wissensmanagement zu gehen.
Übung: Wissen bewahren
Zunächst wird jeder Baustein aus dem Wissenskreislauf mit einer kurzen Definition sowie einem auf den Bevölkerungsschutz angepassten Beispiel für BevS-Akteure eingeleitet. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen thematischen Einstieg.
In diesem Fall: Wissen bewahren!
Bewusste Auswahl, Speicherung und Sicherung von relevantem Wissen [12, 18].
Beispiel für BevS-Akteure:
In einer Einsatznachbesprechung stellen die Einsatzkräfte fest, welches Wissen sich für die Lagebewältigung als hilfreich erwiesen hat und daher festgehalten werden muss und welches Wissen für zukünftige Prozesse unwichtig (geworden) ist und daher nicht bewahrt werden muss [14].
Zur Einschätzung dieses Bausteins, beantworten Sie bitte die folgende Frage mit Ja oder Nein:
Wird Wissen in Ihrer Organisation gespeichert?
Wäre Ihre Antwort an dieser Stelle „Nein“, würde nach dem Grund gefragt und anschließend allgemeine Empfehlungen gegeben werden, wie Wissen bzw. Informationen gespeichert werden können. Bei der Beantwortung mit „Ja“ folgt eine Priorisierungsfrage, welche Relevanz der jeweilige Baustein in einer Organisation oder Behörde hat.
Im Folgenden können Sie nun den Pfad der Beantwortung mit „Ja“ für Ihre Organisation oder Behörde bearbeiten. Kreuzen Sie dazu bitte Ihre Antworten an. Nach jeder Frage bekommen Sie dann beispielhaft einige Handlungsempfehlungen genannt. Diese sind aus eben genannten Gründen sehr allgemein gehalten.
Warum bzw. mit welchen Zielen speichern Sie vorhandenes Wissen ?
-
Unabhängigkeit von personengebundenem (Expert*innen-)Wissen (Das Wissen steht nach der Speicherung für alle zur Verfügung)
-
Beschleunigung von Arbeitsabläufen (keine aufwendige Recherche zur Erfüllung bestimmter Aufgaben notwendig, Formulare, Vorlagen etc.)
-
Vermeidung von Fehlern (Es kann auf Erfahrungen zurückgegriffen werden)
-
Unabhängigkeit von externem Wissen
-
Ansprechpersonen/Fachleute für bestimmte Fachbereiche zu dokumentieren
-
Zugriff auf Erfahrungen aus vergangenen Einsätzen
-
Keine der Antworten
Handlungsempfehlung zu Wissenszielen
Mit Hilfe dieser Fragestellung sollen Sie dafür sensibilisiert werden, ob Ihre Organisation oder Behörde bewusst Wissen speichert und zu welchem Zweck. So ist es sinnvoll personengebundenes Wissen für alle Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, für den Fall, dass die Person, die das Wissen ursprünglich besaß, nicht erreichbar oder nicht mehr für die Organisation tätig ist. Zu beachten ist darüber hinaus auch Erfahrungswissen, welches nicht unbedingt in einem Lehrbuch zu finden ist, sondern auf den Praxiserfahrungen einer Person beruht. Auch dieses spezielle personengebundene Wissen sollte den anderen Mitgliedern zugänglich gemacht werden.
Haben Sie einige der Möglichkeiten angekreuzt, ist Ihre Organisation bzw. Behörde auf einem guten Weg. Bei wenigen Antworten besteht noch Nachholbedarf, hier können die Handlungsempfehlungen der Anstoß für gezieltes Wissensmanagement sein.
Bitte notieren Sie hier, was Sie für Ihre Organisation mitnehmen und umsetzen möchten:
Wie wird existierendes Wissen in Ihrer Organisation festgehalten/gespeichert?
-
Datenbanken
-
Persönliches Laufwerk der Mitarbeitenden
-
Wiki
-
Dokumentenmanagementsystem
-
Zugängliche Serverstruktur oder Cloudlösung
-
Aktenordner
-
Lessons Learned
-
Best Practice
-
Handlungsleitfäden
-
Ausbildungsinhalte
-
Sonstiges:
Was ist Ihnen bei der Speicherung des Wissens/der Informationen besonders wichtig?
-
Gute Auffindbarkeit des Wissens, um spätere Nutzung zu vereinfachen
-
Vollständigkeit des gespeicherten Wissens
-
Aktualität des Wissensbestands
-
Zugänglichkeit für alle Organisationsmitglieder
-
Zeitliche Ressourcen zur Wissensspeicherung
-
einfache Logik in der Bedienung
Bewerten Sie die von Ihnen als wichtig empfundenen Antworten (1=schlecht; 5=gut):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
Auffindbarkeit des Wissens, um spätere Nutzung zu vereinfachen | |||||
Vollständigkeit des gespeicherten Wissens | |||||
Aktualität des Wissensbestands | |||||
Zugänglichkeit für alle Organisationsmitglieder | |||||
Zeitliche Ressourcen zur Wissensspeicherung | |||||
Logik in der Bedienung |
Handlungsempfehlung zur Speicherung von Wissen
Hier werden die verschiedenen Speicherungsmöglichkeiten abgefragt. Lediglich eine lokale Speicherung von Daten oder Informationen ist nicht ratsam. Wissen sollte an den richtigen Stellen zugänglich gemacht werden. Empfehlenswert für die reine Speicherung ist eine Serverstruktur mit unterschiedlichen Nutzungsrechten. So können alle (ehrenamtlich) Mitarbeitenden auf die für sie individuell relevanten Informationen, wenn nötig sogar ortsunabhängig, zugreifen. Soll Wissen allerdings weitergegeben werden, empfehlen sich Handlungsleitfäden, Lessons Learned und die Integration des Wissens in die Ausbildungsinhalte. Unabhängig von der Art der Speicherung ist auf Aktualität und Nutzerfreundlichkeit (Suchfunktionen, Struktur, etc.) sowie auf die weiteren Antwortmöglichkeiten zu achten.
Bitte notieren Sie hier, was Sie in Ihrer Organisation noch verbessern können und/oder einführen möchten:
Nach Beantwortung der Fragen eines Bausteins werden Sie zum nächsten Abschnitt des Wissenskreislaufes weitergeleitet, bis alle Bausteine beantwortet wurden.
Diese beispielhafte Darstellung zeigt, wie die Selbstevaluation des Wissensmanagements innerhalb eines Akteurs im Bevölkerungsschutz grundsätzlich gestaltet werden kann. Die anschließende Ausarbeitung der individuellen Handlungsempfehlungen ist der finale Bestandteil des Vorhabens der TH Köln im Forschungsprojekt WAKE und wird bis zum Projektende (voraussichtlich März 2022) abgeschlossen sein.
4.6 Fazit
Das Kapitel hat aufgezeigt, wie vielfältig die Methoden, Strategien und Konzepte sein können, die unter dem Begriff Wissensmanagement zusammengefasst werden. Und obwohl die Erfahrung und die Anwendungen von Wissensmanagement sich abhängig vom Akteur und den verschiedenen Standorten unterscheiden, lassen sich auch Tendenzen ablesen, welche wiederholt und mehrfach berichtet wurden. Dies zeigt, dass BOS und weitere Beteiligte zwar teilweise verschiedene Ansätze und Strategien im Rahmen des internen, aber auch organisationsübergreifenden Wissensmanagements verfolgen, jedoch auch vor ähnlichen Herausforderungen und Lücken im Umgang mit Erfahrungswissen stehen. Gleichzeitig konnten in diesem Kapitel Strategien und Praktiken aufgezeigt werden, die sich an einen oder mehreren Standorten bewährt haben. Gerade diese sind auch als Handlungsanregung für diejenigen Akteure zu verstehen, die Impulse zum effizienten Umgang mit Erfahrungen und Wissen wünschen.
Insgesamt wurde deutlich, dass Wissensmanagement für Akteure des Bevölkerungsschutzes zu unterschiedlichen Zeiten einer Einsatzlage wichtig ist. So können bestehende Erfahrungswerte in die Erarbeitung von Hilfsmaterialien wie Handlungsempfehlungen und Leitlinien einfließen und so eine Unterstützung und Entlastung für Einsatzkräfte bieten. Dabei bleibt jedoch die Herausforderung, diese Hilfsmittel auch flächendeckend bekannt und leicht verfügbar zu machen, sie regelmäßig zu aktualisieren bzw. auf neue Bedarfe anzupassen.
Die gemachten Erfahrungen im Flüchtlingseinsatz, insbesondere die konkret beschriebenen positiven Beispiele, zeigen, dass vielerorts diese verschiedenen Aspekte bereits erfolgreich angewendet wurden, auch wenn sie dabei nicht immer als „Wissensmanagement“ bezeichnet wurden. Denn oftmals wird Wissen nicht nur strukturiert und gezielt aufbereitet und weitergegeben, sondern auch unstrukturiert und intuitiv im Arbeitsalltag.
Daneben zeigt sich die Relevanz von Wissensaustausch im Einsatz mit allen beteiligten Akteuren. Neben einem reinen Informations- und Wissensaustausch kann dieser auch der Vernetzung dienen. Auf diese Weise können Ansätze des Wissensaustauschs und der Vernetzung positive Impulse für die interorganisationale Zusammenarbeit setzen, welche sowohl in Nichtkrisenzeiten, während des Einsatzes sowie zur Nachbereitung genutzt werden können.
Die Sicherung und Aufbereitung von relevanten Erfahrungswerten und Wissen spielt im Wissensmanagement ebenfalls eine herausragende Rolle. Hier wurde deutlich gemacht, wie dies schon im Einsatz geschehen kann, und es wurden Anregungen für die Etablierung von Wissensmanagementaspekten in der eigenen Behörde oder Organisation gegeben. Denn obwohl es bereits vielzählige Bestrebungen gibt, wie die diversen Beispiele aus der Flüchtlingshilfe zeigen, besteht weiterhin der Wunsch aus der Praxis Wissen noch gezielter und strukturierter zu dokumentieren, um es für zukünftige Einsätze abrufen zu können. Der Beitrag zum Handbuch Interkultureller Bevölkerungsschutz und die Anleitung zur Selbstevaluation sollen hiermit erste Anregungen liefern.
Notes
- 1.
- 2.
Das Handbuch wurde 2021 als Open-Source-Quelle über die Webseiten des WAKEProjektes und der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland sowie und in gedruckter Version veröffentlicht.
- 3.
Ein Einstieg bietet ein Glossar zum Wissensmanagement im Bevölkerungsschutz von Norf et al. (2019) [14], welches auch die verschiedenen Bausteine des folgenden Wissenskreislaufs im Detail vorstellt.
Literatur
Auer T, Sturz W (2007) ABC der Wissensgesellschaft, 1st edn. Doculine-Verlag-GmbH, Reutlingen
Blank-Gorki V (2016) Grundlagen des Wissensmanagements. In: Fekete A, Hufschmidt G (eds) Atlas Verwundbarkeit und Resilienz. Pilotausgabe zu Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Schweiz. Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, pp 18–25
Busch MW, Lorenz M (2010) Shared Mental Models – ein integratives Konzept zur Erklärung von Kooperationskompetenz in Netzwerken. In: Stephan M, Kerber W, Kessler T et al. (eds) 25 Jahre ressourcen- und kompetenzorientierte Forschung. Gabler Verlag, Wiesbaden, pp 277–305
Caspers R, Kreis-Hoyer P (2004) Konzeptionelle Grundlagen der Produktion, Verbreitung und Nutzung von Wissen in Wirtschaft und Gesellschaft. In: Caspers R, Bickhoff N, Bieger T (eds) Interorganisatorische Wissensnetzwerke. Mit Kooperationen zum Erfolg. mit 13 Tabellen und 18 Übersichten. Springer, Berlin Heidelberg, pp 17–58
Davenport TH, Prusak L (2010) Working knowledge. How organizations manage what they know. Harvard Business School Press, Boston
Deutsches Rotes Kreuz e. V. (2021) Zivilgesellschaftliche Akteure in der DRK-Flüchtlingshilfe 2015/16. Teil 2: Ergebnisse einer verbandsinternen Befragung. Schriften der Forschung
Gerhards S, Trauner B (2011) Wissensmanagement. 7 Bausteine für die Umsetzung in der Praxis, 4. Aufl. Carl Hanser Fachbuchverlag, s.l.
Hufschmidt G, Blank-Gorki V (2016) Wissensmanagement im Bevölkerungsschutz. In: Fekete A, Hufschmidt G (eds) Atlas Verwundbarkeit und Resilienz. Pilotausgabe zu Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Schweiz. Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, pp 26–37
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (2020) Registrierung im LAF. https://www.berlin.de/laf/ankommen/registrierung-laf/
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (2020) Über uns. https://www.berlin.de/laf/ueber-uns/
Lehner F, Haas N (2012) Erfolgsmessung für das betriebliche Wissensmanagement. Eine verhaltenswissenschaftliche Fundierung. Diskussionsbeitrag W-36–12. In: Kleinschmidt P, Lehner F (eds) Schriftenreihe Wirtschaftsinformatik. Passauer Diskussionspapiere, Passau
Meusburger G (2018) Unternehmensführung mit Wissensmanagement. Wissensorientiertes Management aus der Praxis. Meusburger Guntram GmbH, Wolfurt
Nonaka I, Takeuchi H (1995) The knowledge creating company. How Japanese compa-nies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York
Norf C, Tiller P, Fekete A (2019) Glossar zum Wissensmanagement im Bevölkerungsschutz. In: Fehn K, Fekete A, Hetkämper C et al. (eds) Integrative Risk and Security Research, Volume 1/2019, Köln
North K (2016) Wissensorientierte Unternehmensführung. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden
Probst G, Raub SP, Romhardt K (2012) Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen, 7th edn. Gabler Verlag, Wiesbaden
Rall M, Koppenberg J, Hellmann L et al. (2013) Crew Ressource Management (CRM) und Human Factors. In: Moecke H, Marung H, Oppermann S (eds) Praxishandbuch Qualitäts- und Risikomanagement im Rettungsdienst. Planung, Umsetzung, Zertifizierung. MWV, Berlin, pp 149–157
Reinmann G, Mandl H, Erlach C (2001) Wissensmanagement lernen. Ein Leitfaden zur Gestaltung von Workshops und zum Selbstlernen. Beltz, Weinheim
SiKoMi (2021) Bundeswehr1. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Bundeswehr2. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK01. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK02. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK04. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK05. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK10. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK11. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK12. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) DRK13. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Ehrenamt2. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Gesundheitsamt4. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Gesundheitsamt5. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) JUH1. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) JUH2. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei01. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei02. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei03. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei04. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei06. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei07. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei08. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei09. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei12. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei14. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei18. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Polizei19. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Private Sicherheit1. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Private Sicherheit3. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Private Sicherheit4. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung01. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung04. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung06. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung07. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung09. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung10. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung11. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung12. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung13. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung14. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung15. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung16. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung17. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung18. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
SiKoMi (2021) Verwaltung19. In: Interviews im Zuge des Forschungsprojektes
Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (2009) Programm Innere Sicherheit. Fortschreibung 2008/2009
Weichselgartner J, Pigeon P (2015) The Role of Knowledge in Disaster Risk Reduction. International Journal of Disaster Risk Science:107–116. doi: https://doi.org/10.1007/s13753-015-0052-7
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Olfermann, E., Bhatti, S. (2022). Wissen in Krisen- und Katastrophenlagen: Umgang mit Erfahrungen aus der Praxis. In: Schütte, P.M., Schulte, Y., Schönefeld, M., Fiedrich, F. (eds) Krisenmanagement am Beispiel der Flüchtlingslage 2015/2016. Sicherheit – interdisziplinäre Perspektiven. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37141-8_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-37141-8_4
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-37140-1
Online ISBN: 978-3-658-37141-8
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)