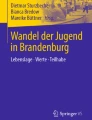Zusammenfassung
Um ausgehend von den im öffentlichen Diskurs häufig kontrovers geführten Debatten darüber, was eine „gute Schule“ ausmacht, zu einem einheitlicheren Verständnis von Schulqualität zu gelangen, sind in den Ländern im Zuge der Neuen Steuerung Konzepte zur Definition von schulischer Qualität entwickelt und etabliert worden. Die zumeist als Referenz-, Qualitäts- oder Orientierungsrahmen bezeichneten Zusammenstellungen aus Qualitätsdimensionen und -kriterien sollen dabei die Funktion entfalten, allen mit Fragen der Schulqualität betrauten Akteursgruppen für ihren jeweiligen Beitrag zur Erfassung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Schule und Unterricht eine auf Landesebene geteilte Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen, die Zielperspektiven der schulischen Arbeit aufzeigt. Bestandsaufnahmen und Evaluationen von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung sowie Neujustierungen von Entwicklungszielen erhalten damit konzertierte Bezugspunkte, die als richtungsweisendes Leitgerüst bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Anwendung gelangen sollen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
3.1 Einrichtung und Zielstellung von Referenzkonzepten
Um ausgehend von den im öffentlichen Diskurs häufig kontrovers geführten Debatten darüber, was eine „gute Schule“ ausmacht, zu einem einheitlicheren Verständnis von Schulqualität zu gelangen, sind in den Ländern im Zuge der Neuen Steuerung Konzepte zur Definition von schulischer Qualität entwickelt und etabliert worden. Die zumeist als Referenz-, Qualitäts- oder Orientierungsrahmen bezeichneten Zusammenstellungen aus Qualitätsdimensionen und -kriterien sollen dabei die Funktion entfalten, allen mit Fragen der Schulqualität betrauten Akteursgruppen für ihren jeweiligen Beitrag zur Erfassung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Schule und Unterricht eine auf Landesebene geteilte Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen, die Zielperspektiven der schulischen Arbeit aufzeigt (Thiel und Tarkian 2019). Bestandsaufnahmen und Evaluationen von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung sowie Neujustierungen von Entwicklungszielen erhalten damit konzertierte Bezugspunkte, die als richtungsweisendes Leitgerüst bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Anwendung gelangen sollen (Dobbelstein et al. 2017; Steffens und Bargel 2016).
Häufig als umfassende Gesamtschemata, zumindest aber als Übersichtsdarstellungen oder Tableaus vorliegend, können die Dokumente zur Festschreibung von Qualitätserwartungen mit Blick auf ganz verschiedene Fragestellungen herangezogen werden, bilden sie mit Elementen wie dem Schulmanagement, dem Unterricht, der Lehrkräfteprofessionalität, der Schulkultur, den schulischen Rahmenbedingungen oder den erzielten Ergebnissen und Wirkungen das breite Spektrum schulischer Arbeit ab. Das dahinterliegende Erkenntnisinteresse besteht vor allem darin, die im Sinne des Schulqualitätsansatzes einflussreichen Handlungsfelder und -konstellationen zu erfassen, die in den allgemeinbildenden Einzelschulen ganz unterschiedlich ausgestaltet sein und damit jeweils individuelle Veränderungspotentiale erkennen lassen können (vgl. Steffens 2017). Entsprechend dienen die Referenzsysteme im Regelfall – zumindest ausschnittsweise – auch als konzeptionelle Grundlage für die Ausrichtung der in den Ländern eingerichteten Verfahren externer Schulevaluation (Tarkian et al. 2019a) bzw. als Bezugsnormen für die schulinterne Evaluation (Tarkian et al. 2019b; Kasper 2018).
Ähnlich wie für andere Steuerungsinstrumente, so gilt auch für die Referenzrahmen, dass sie erfahrungs- und bedarfsbezogen angepasst werden und daher stets zeitpunktbezogene Abbildungen der landespolitischen Steuerungsvorstellungen darstellen. Während sie in manchen Ländern bereits in dritter Auflage veröffentlicht sind, liegen die Dokumente andernorts noch in der frühen Erstfassung vor. Abgesehen von dem unterschiedlichen Aktualisierungsstand unterscheiden sie sich aber vor allem hinsichtlich Systematik, Darstellungsform und Umfang der einbezogenen Dimensionen sowie des dabei verschieden stark ausgearbeiteten Detaillierungsgrads an inhaltlich aufschließenden Kriterien oder Leitfragen (Thiel und Tarkian 2019). Anhand dieser können sie über die analytische Ebene hinaus einen direkten praktischen Bezugswert für konkrete Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung bereitstellen.
Neben der Schulinspektion, der operativen Schulaufsicht oder den begleitend tätigen Unterstützungssystemen sind für die Ab- und Einleitung entsprechender Schulentwicklungsmaßnahmen auf Organisationsebene insbesondere die Schulen selbst als Akteure der Qualitätsentwicklung gefragt. Vor dem Hintergrund ihrer hierzu in den letzten Jahren erweiterten Autonomiespielräume ergibt sich gerade für schulische Leitungskräfte der Auftrag, Impulsgebungen aus dem Rahmenkonzept als Grundlage für innerschulische Entscheidungen zur Qualitätsentwicklung zu verwenden. Personalentwicklung bildet dabei eines der Handlungsfelder, das in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit als Ansatz zur Verbesserung von Schulqualität erfahren hat.
3.2 Personalentwicklung als Element von Schulqualität
Zur zielgerichteten Steuerung aller personenbezogenen Entwicklungsvorgänge und Arbeitsstrukturen in Organisationen stellt Personalentwicklung (PE) gerade in stark personengetragenen Organisationen ein bedeutsames Element der Organisationsführung dar (Meetz 2007, S. 122). Die Sicherung und planvolle Weiterentwicklung der Qualität von Arbeitsbeziehungen und -leistungen, mit der Fragen der Qualifikation, Kompetenz und Performanz der Beschäftigten in den Fokus rücken, gilt in der betriebswirtschaftlichen Denktradition aus dem Kontext der Human Ressource-Bewegung heraus schon seit mehreren Jahrzehnten als entscheidendes Handlungsfeld für die Organisationsentwicklung (Schreyögg 2003). Sie umfasst in diesem Kontext üblicherweise eine Bandbreite an bildungs- und stellenbezogenen Maßnahmen, die zur Qualifizierung und Förderung der Mitarbeitenden und Führungskräfte in sich entwickelnden Unternehmen mit dem Ziel einer Steigerung der aktuellen und zukünftigen Leistungen dienen (vgl. Becker 2013).
In Pädagogik und Bildungsforschung wurde Personalentwicklung erst etwas später als Ansatz zur Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Schule als pädagogischer Handlungseinheit (Fend 1986) akzeptiert. Die konzeptuelle Tragfähigkeit von PE war insbesondere vor dem Hintergrund der traditionellen Vorstellung von Schule als durch eine weitgehend unabhängige Expertise und damit starke Handlungsautonomie des Kollegiums gekennzeichnete Organisation von Professionals (Thiel 2008a) zunächst deutlich infrage gestellt (Oelkers 2010), gewann allerdings im Zuge des sich auch im Bildungssystem durchsetzenden New Public Management-Ansatzes an Bedeutung. Mit der Aufnahme von Personalentwicklung in Lehrbücher sowie populärwissenschaftliche Beiträge zur Schulentwicklung (vgl. Buhren und Rolff 2002; Buchen et al. 2001) verbreitete sich seit den 1990er Jahren eine veränderte Sichtweise auf Schule als einer professionellen Organisation, die zugleich einer Steuerung durch Management-Elemente unterlegt werden kann und dies vor dem Hintergrund des Modells Neuer Steuerung auch sollte (vgl. Thiel 2008b). Zudem ließen internationale Studien auch entsprechende Effekte einer personalbezogenen Steuerungsstrategie zur Weiterentwicklung von Schulqualität erkennen, sodass in den zentralen Modellen der Schulentwicklungsforschung Personalentwicklung zunehmend einen unmittelbaren Platz als dritter Bestandteil neben der Unterrichts- und Organisationsentwicklung eingenommen hat (vgl. Rolff 2013; Holtappels 2009; Holtappels und Voss 2006).
Im Kontext von Schulentwicklung kann mit Personalentwicklung der organisationsweite Ansatz verfolgt werden, pädagogische Fach- bzw. Lehrkräfte sowie ganze Lehrkräfteteams über systematische und langfristig angelegte Maßnahmen der Qualifizierung und Förderung dazu zu befähigen, ihren Bildungsauftrag mit Bezug auf aktuelle wie künftige Anforderungen im Sinne definierter Ziele flexibel zu bewältigen (vgl. Tarkian 2020). Diese bestehen im Sinne der School Effectiveness-Forschung primär in der Sicherung und Verbesserung von Schülerlernleistungen mit Blick auf die Gewährleistung erfolgreicher Übergänge innerhalb des Schulsystems sowie von diesem in den tertiären Bildungsbereich oder das Berufsbildungssystem. Gerade um neuen Herausforderungen effektiv begegnen zu können, wie sie insbesondere mit der zunehmenden Heterogenität von Schülerschaften seit einigen Jahren in mehrfacher Hinsicht bestehen, wird vor diesem Hintergrund die kontinuierliche Weiterentwicklung des pädagogischen Personals zur conditio sine qua non (Wimmer und Altrichter 2017, S. 218). Bildungspolitische Zielsetzungen wie die Stärkung bzw. kontinuierliche Kompetenzentwicklung von Schüler*innen und das Erreichen einer möglichst hohen Quote an erfolgreichen Schulübergängen und -abschlüssen auf Landes- wie Bundes- und schließlich EU-EbeneFootnote 1 dürften ohne entsprechende Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Unterrichts- wie der pädagogischen Arbeit von Lehrkräften kaum leist- bzw. erwartbar sein. Verschärft werden dürfte die Notwendigkeit einer systematischen Personalarbeit durch die zeitgleich ansteigende Beschäftigung von Quereinsteigern im Schuldienst ohne pädagogische Grundausbildung (Klemm 2019), dem teilweise hohen Anteil fachfremdem Unterrichts gerade im Kernfach Mathematik (vgl. Qualitätskommission zur Schulqualität in Berlin 2020) sowie die seit 2020 bestehenden coronabedingten Erfordernisse zum Unterrichten unter Pandemiebedingungen.
Doch wie für zahlreiche Begriffe aus dem Bereich der Organisationslehre, so gilt auch für Personalentwicklung, dass diese weder in der Betriebswirtschaftslehre selbst noch innerhalb der sozialwissenschaftlichen Disziplinen im o.g. Sinne einheitlich definiert und verstanden wäre. Entsprechend finden sich in der Literatur sowie im Verständnis der Bildungspraxis letztlich recht unterschiedliche inhaltliche Zuschnitte von Personalentwicklung. Die dahinterliegenden Konzepte reichen von einer sehr engen Auslegung im Sinne einer Gleichsetzung mit der beruflichen Fortbildung bis hin zu einer weiten Begriffsdefinition von Personalentwicklung, die neben der Bildung und Förderung von Mitarbeitenden auch Maßnahmen der Team- und Organisationsentwicklung miteinschließt. Teilweise wird unter PE auch oder sogar vordergründig die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden bzw. die Disposition benötigter Personalkapazitäten zur Abdeckung der betrieblichen Personalbedarfsplanung verstanden oder damit eine instrumentelle Grundlage für die Unterstützung berufsbiographischer Karriereplanungen verbunden. Auch mit Blick auf die einzelnen Verfahren und Maßnahmen, die für das Erreichen der Entwicklungsziele als ausschlaggebend gelten und damit zum obligatorischen PE-Instrumentarium gezählt werden, zeigen sich Unterschiede, die häufig feld- oder sogar organisationsspezifisch variieren. Für den Schulbereich können neben dem zentralen Gebiet der Lehrkräftefortbildung mitsamt der dazugehörigen Fortbildungsplanung insbesondere auch personenbezogene Instrumente wie Mitarbeiter- bzw. Entwicklungsgespräche, leitungsseitige Unterrichtsbesuche und zunehmend auch individuelle Zielvereinbarungen zwischen Schulleitung und Lehrkraft dazuzählen (vgl. Tarkian 2020; Bach et al. 2014).
Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Zuschnitte mögen auch darauf zurückzuführen sein, dass Personalentwicklung letztlich in ganz verschiedenen Forschungs(teil)traditionen wie der (Arbeits- und Organisations-) Psychologie, der Organisations-, Berufs- oder Bildungssoziologie, der Bildungsökonomie oder der pädagogischen Psychologie verortet werden kann (vgl. Falk 2007), die auf verschiedene theoretische Ansätze rekurrieren bzw. unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verfolgen. Dies zeigt sich auch an der spezifischen Blickrichtung, von der aus die Entwicklung von Personal beleuchtet wird: Während manchenteils die individuellen Zielvorstellungen und Entfaltungsinteressen der Belegschaft und damit ihre Sichtweisen als Subjekte von Veränderungsprozessen deutlich akzentuiert werden (mitarbeiterorientierter Fokus), betonen stärker führungsorientiert-ökonomische Ansätze typischerweise die Perspektive der strategischen Organisationsentwicklung und in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Anpassung von Mitarbeiterkompetenzen an die jeweils vorherrschenden (Markt)erfordernisse (unternehmensorientierter Fokus). In dieser erfahren die Interessen der Mitarbeitenden zwar im Sinne der Erhöhung ihrer Motivation und Identifikation mit dem Arbeitsumfeld ebenfalls eine wesentliche Bedeutung, sie werden im Rahmen der Einleitung und Förderung von Entwicklungsmaßnahmen aber einer jeweils unter organisationalen Gesichtspunkten erforderlichen Adaption ihrer Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten an die Erreichung der Unternehmensziele tendenziell nachgeordnet.
Entsprechend der definitorischen epistemologischen Unschärfe des Konzepts von Personalentwicklung in der Fachliteratur kann auch für den Bereich der Schulpolitik und -verwaltung davon ausgegangen werden, dass in den Ländern unterschiedliche Akzentuierungen bestehen und sich die Ausführungen zu diesem Handlungsfeld in Umfang und Zuordnung, Art und Substanz unterscheiden und damit im Weiteren auch unterschiedliche Impulse für die Entwicklungsarbeit an und in der Einzelschule ausgehen können. Tatsächlich bedarf dies allerdings einer genauen Untersuchung zu den jeweiligen Einordnungen, den dazugehörigen Merkmalen und den Ausführungen, die ausgehend von den offiziellen Konzeptionen in den 16 Ländern zum Gegenstand der PE erkennbar werden und sich so zu landesspezifischen Leitbildern schulischer Personalentwicklung verdichten lassen. Über ihre mithilfe von Qualitätsmerkmalen und dazugehörigen Indikatoren vorgenommenen Zuordnungen und Beschreibungen können die Rahmenkonzepte zur Schulqualität dazu Aufschluss geben.
3.3 Methodische Analyse
Untersucht werden zum Analysestichtag 30.09.2020 die zu diesem Zeitpunkt in den Ländern abrufbaren Referenzsysteme zur Schulqualität, die in Nordrhein-Westfalen und Hessen als Referenzrahmen, in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Saarland und Rheinland-Pfalz als Orientierungsrahmen, in Berlin als Handlungsrahmen und in Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt als Qualitätsrahmen bezeichnet werden. Für die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sowie in der aktuellen Fassung auch für Baden-Württemberg, die anstelle eines allgemeinen Referenzkonzepts zur Festlegung schulischer Qualitätsdimensionen ein Funktionsdokument erstellt haben, das insbesondere für die Qualitätsfeststellung per Evaluation vorgesehen ist, wurde dieses als Äquivalent verwendet; für Sachsen ist das entsprechende Konzeptpapier „Kriterienbeschreibung Schulqualität“ herangezogen wordenFootnote 2.
Alle verwendeten Rahmendokumente wurden über die jeweiligen Informationsportale der 16 Länder in Abstimmung mit den für das Themenfeld zuständigen Landesvertretungen identifiziert und in der zum Stichtag vorliegenden letztgültigen Fassung für eine Analyse der Qualitätsvorstellungen mit Blick auf das allgemeinbildende Schulsystem verwendet. Sofern zusätzliche Referenzdokumente bzw. Informationsmaterialien existieren, die sich speziell auf Standards bzw. Richtlinien zur Aus- und Fortbildung des schulischen Personals beziehen, sind diese im Rahmen einer formalen Darstellung bei der Ausweisung der in den Ländern vorhandenen Dokumentenbasis mitberücksichtigt, nicht aber für eine tiefer gehende inhaltliche Analyse einbezogen worden. Sie werden in den Ergebniskapiteln des vorliegenden Bands einer eigenen inhaltlichen Bewertung unterzogen.
Die Auswertung der Referenzrahmen zur Schulqualität erfolgt unter formalen wie inhaltlichen Aspekten. Formal wird für jedes Referenzdokument zur Feststellung der Aktualität der Ausführungen zunächst der Titel der letztpublizierten Auflage einschließlich des dazugehörigen Veröffentlichungsdatums genannt. Daneben wird aufgezeigt, unter welcher Begrifflichkeit der Gegenstandsbereich PE im Dokument erfasst wird und in welchem quantitativen Umfang dazu Ausführungen erfolgen. Zur genauen Nachvollziehbarkeit sind die jeweiligen Fundstellen ausgewiesen.
Ergänzend werden zwei weitere formale Kriterien herangezogen, die jenseits des Beschreibungsumfangs ebenfalls hinweisgebend sein können für die Gewichtung, die Personalentwicklung in den Ländern im Rahmen der Gesamtkonzeption zur Schulqualität erfährt: Dazu wird einerseits aufgezeigt, auf welcher Hierarchieebene des Referenzsystems Personalentwicklung als Gegenstandsbereich verortet ist. Erfolgt dies bereits auf hoher Darstellungsebene und wird damit in besonders exponierter Weise sichtbar, kann daraus ggfls. geschlossen werden, dass der Entwicklung schulischen Personals im Rahmen der Feststellung und Weiterentwicklung von Schulqualität in besonderer Weise Rechnung getragen werden sollFootnote 3. Zudem ließe sich davon ausgehen, dass auch die Entscheidung, Personalentwicklung explizit als eigenen Bestandteil eines Strukturmodells aufzuführen, in dieser Hinsicht relevant sein dürfte. Wird in einer schematischen Darstellung zu den Einflussbereichen schulischer Qualität, von der anzunehmen ist, dass diese in besonderem Maße rezipiert und zitiert wird, Personalentwicklung ausdrücklich als eigener Baustein ausgewiesen, wäre anzunehmen, dass ihrer Einrichtung und Umsetzung zum Zeitpunkt der Konzepterstellung eine besondere Priorität für die Sicherung und Verbesserung von Schulqualität eingeräumt wurde.
Für die inhaltliche Analyse ist zunächst die genaue Zu- bzw. Einordnung des Gegenstands in die übergeordnete Qualitätsdimension des Rahmenkonzepts von Bedeutung. Die dabei getroffene Subsumtions- bzw. Klassifikationslogik kann einen ersten Aufschluss darüber geben, welches Grundverständnis zum Gegenstandsbereich Personalentwicklung vorliegt.
Welches operative Konzeptverständnis in den Länderkonzeptionen daneben jeweils gezeichnet wird, bildet das Kernstück der Auswertung und dürfte gerade auch für den konkreten Einsatz in der Praxis von erheblicher Bedeutung ein. Festgestellt werden kann dies über die aufgeführten Operationalisierungen, die zumeist in Form von Merkmals- bzw. Indikatoren-Auflistungen bzw. Kriterienbeschreibungen vorliegen, teilweise auch (zusätzlich) mithilfe von aufschließenden Fragen konkretisiert und damit für Nutzungszwecke aufbereitet werden. Dazu werden vornehmlich die Ausführungen zugrunde gelegt, die sich unmittelbar in dem (Teil-)kapitel finden lassen, das durch die titelgebende Verwendung des PE-Begriffs als wesentlicher Referenzbereich identifiziert wurde oder (bei Nicht-Verwendung des PE-Begriffs) ausgehend von den behandelten Inhalten für den Gegenstandsbereich von Personalentwicklung einschlägig ist.
Da sich häufig aber auch in benachbarten bzw. zusätzlichen Kapiteln der Referenzrahmen Ausführungen finden lassen, die den Gegenstandsbereich in Teilaspekten miterfassen oder erweiterte Angaben dazu leisten, sind entsprechende Ergänzungen und Querverbindungen zur Darstellung eines vollständigen Bildes in die Analyse miteingegangen. Dazu wurde anhand einschlägiger Begriffsfestlegungen – wie dem Begriff der Personalentwicklung selbst, aber auch gängiger Bezeichnungen für zentrale PE-Instrumente wie Mitarbeiter-, Jahres- oder Entwicklungsgespräche, Fortbildungen bzw. Fortbildungskonzept oder Fortbildungsplanung, Unterrichtsbeobachtungen bzw. -besuche oder auch Hospitationen und Zielvereinbarungen – eine ergänzende Deskriptorensuche für das Gesamtdokument durchgeführt. Vorhandene Quer- bzw. Mehrfachbezüge zum Qualitätsbereich der schulischen Personalentwicklung sind, wie auch sämtliche bereits vorgenannten Analysekategorien, der Ergebnisübersicht in Abb. 3.1: Formale Kriterien der Zuordnung von Personalentwicklung in den Qualitätsrahmen der Länder zu entnehmen.
3.4 Auswertungsergebnisse: Kennzeichen schulischer Personalentwicklung in den 16 Ländern
3.4.1 Formale Rahmenbedingungen
Zunächst werden die vorgenannten formalen Kriterien betrachtet, die sich auf die grundsätzliche Erfassung von Personalentwicklung als Teil des Gesamtreferenzsystems beziehen und in diesem Zusammenhang erste Erkenntnisse zur Konzeptionierung des Gegenstandsbereichs in den 16 Ländern liefern.
Dazu zählen (jenseits der Erfassung der Dokumentenbasis) die folgenden vier Auswertungsaspekte:
-
1)
Gewählte Begriffsverwendung
-
2)
Quantitativer Umfang der Ausführungen, die zum Gegenstand enthalten sind
-
3)
Verortung von PE im Rahmen der hierarchischen Gesamtsystematik des Referenzrahmens: hier Darstellungsebene der Ausführungen
-
4)
Ausweisung von Personalentwicklung als eigener Bestandteil eines Strukturmodells
Abb. 3.2: Konzeptionelle Elemente der Leitbilder schulischer Personalentwicklung in den Qualitätsrahmen der Länder zeigt die hierzu festgestellten Ergebnisse in der Gesamtübersicht. Mit Blick auf die Dokumentenbasis fällt zunächst die vergleichsweise starke Spannbreite des Erstellungszeitpunkts der Referenzrahmen ins Auge: Während diese in Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen inzwischen bereits in mindestens dritter Auflage veröffentlicht sind (mit Erscheinungsdatum zwischen 2016 und 2020) und somit auch für Fragen der Personalentwicklung vergleichsweise aktuelle Vorstellungen beinhalten dürften, behielten in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen die frühen Versionen aus 2006 bzw. 2007 bis zum Analysezeitpunkt Gültigkeit, die entsprechend unter vergleichsweise weit zurückliegenden politischen Vorgängerregierungen veröffentlicht worden sind. Entwicklungen, die sich in den letzten 14 Jahren im Zusammenhang mit Qualifikationsmerkmalen des schulischen Personals und den daraus resultierenden Qualifizierungsbedarfen und -maßnahmen sowie generell hinsichtlich Fragen der Mitarbeiterförderung und Organisationsentwicklung im Kontext aktueller schulpolitischer Ereignisse ergeben haben, können in diesen Ländern insofern zumindest über die offiziellen Landesqualitätsrahmen nicht abgebildet werden
Ein eigener Referenzrahmen, der Fragen der Qualifizierung schulischen Personals nochmals in eigenständiger Weise beleuchtet und zu diesem Gegenstandsbereich Standards aufzeigt, ist vor Kurzem für die Länder Hamburg und Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden. Das in Hamburg zunächst 2010/2011 als Qualitätsleitbild für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst veröffentlichte Dokument, das 2019 als „Referenzrahmen Lehrkräfteausbildung und Anpassungsqualifizierung“ aktualisiert wurde, spezifiziert ausgehend von den durch die KMK festgelegten schulischen Handlungsfeldern für Lehrkräfte (KMK 2019) Kompetenzbereiche und Entwicklungsansätze für die Gesamtkette aller drei Phasen der Lehrerbildung. Ergänzt wird dies durch das 2016 veröffentlichte Rahmenkonzept Ausbildungsqualität (RAQ), in dem die Profile aller Ausbildungsbegleitungen beschrieben werden. In Nordrhein-Westfalen ist zu Jahresbeginn 2020 ein eigener Orientierungsrahmen „Lehrkräfte in der digitalisierten Welt“ für die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung veröffentlicht wordenFootnote 4. Der Rahmen, der sämtliche Kompetenzerwartungen, die in den beruflichen Handlungsfeldern von Lehrkräften speziell unter den Bedingungen der Digitalisierung von Lehr-Lern-Umgebungen und -prozessen als bedeutsam gelten, in einer handlungsfeldbezogenen Systematik ausweistFootnote 5, richtet sich gezielt an Multiplikatoren der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Der Umstand, dass Fragen der Lehrerbildung jenseits der Ausführungen aus dem eigentlichen Qualitätsrahmen (unter Bezugnahme auf aktuelle Entwicklungen) nochmals in einem eigenen Referenzdokument aufgegriffen werden, das entsprechende Bezugsnormen für die (Weiter-) Qualifizierung des Schulpersonals aufzeigt, weist darauf hin, dass in den landespolitischen Steuerungsstrategien dieser Länder die konzeptgeleitete Ausbildung und Entwicklung von Lehrkräften einen besonderen Stellenwert erfährt.
Während in dreizehn Ländern der Gegenstandsbereich der Personalentwicklung auch unter eben dieser Begrifflichkeit (→ Aspekt 1) eigenständig aufgeführt oder in begrifflicher Kombination zusammen mit der Personalförderung (BW), dem Personaleinsatz (BB), der Personalplanung (NI), Personalführung (HE) oder Lehrerprofessionalität (MV) dargestellt wird, ist in den Qualitätsrahmen dreier Länder der Begriff „Personalentwicklung“ als solcher insgesamt nicht enthalten. Im Bayerischen Qualitätstableau (einschließlich der Legende) werden Fragen der Weiterentwicklung des Schulpersonals stattdessen unter dem Qualitätsmerkmal „unterstützende Personalführung“ behandelt, während das Saarland in seinem Orientierungsrahmen ausschließlich das Teilelement „Fortbildung“ benennt. Auch in Sachsen-Anhalt finden sich keine Ausführungen zum Gesamtkonzept einer schulischen Personalentwicklung. Hier werden neben einer Bezugnahme auf die Kompetenzentwicklung bei Lehrkräften stattdessen mit dem „Fortbildungs-Plan“, „Unterrichtsbesuchen“, „Mitarbeitergesprächen“ und „individuellen Förderplänen“ verschiedene PE-Instrumente direkt aufgeführt. Für die Mehrzahl der Länder finden sich – zusätzlich zur Ausweisung des Teilbereiches Personalentwicklung – unter Verschlagwortungen wie „Professionalität“ bzw. „Professionalisierung des Schulpersonals“, „Erhalt und Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen“ oder im Kontext von „schulischen Arbeitsbedingungen“ - jeweils noch weitere Dimensionen bzw. Merkmalsfelder, die inhaltlich den Gegenstandsbereich der Entwicklung schulischen (Lehrkräfte) Personals berühren (vgl. dazu Abb. 3.2 Konzeptionelle Elemente der Leitbilder schulischer Personalentwicklung in den Qualitätsrahmen der Länder).
Mit Blick auf den quantitativen Umfang, den die Ausführungen zur Personalentwicklung jeweils einnehmen (→ Aspekt 2), zeigt sich, dass in den meisten Ländern das Themenfeld etwa eine Seite des Qualitätsrahmens ausmacht, dabei allerdings regelmäßig ergänzt wird durch eine zusätzliche Seite, die den Gegenstandsbereich im weiteren Sinne betrifft (vor allem durch die bereits angesprochenen Ausführungen zur Professionalisierung des Schulpersonals). Solche ein- bis zweiseitigen Ausführungen finden sich in BW, BB, MV, SN und – in etwas verschlankter Form – auch in HB, SH und ST.
NW behandelt hingegen in seinem neu aufgelegten, insgesamt sehr umfangreichen Referenzrahmen Fragen der Personalentwicklung und -professionalisierung besonders ausführlich: Zusammengenommen lassen sich in dem knapp 100-seitigen Dokument in drei Teilbereichen dazu elf Seiten finden; 15 weitere Seiten umfasst der eigenständige Orientierungsrahmen für die Lehreraus- und -fortbildung „Lehrkräfte in der digitalisierten Welt“. Auch in Hamburg werden über den separaten 18-seitigen Referenzrahmen der Ausbildungsabteilung des Hamburger Landesinstituts, in dem die 3. Phase der Lehrerbildung für den laufenden Kompetenzerwerb bzw. für erforderliche Anpassungsqualifizierungen im Schuldienst mit in den Blick genommen wird, differenzierte Ausführungen zur Entwicklung des Schulpersonals veröffentlicht. Der eigentliche Hamburger Orientierungsrahmen erfasst den Gegenstandsbereich aus der Perspektive der schulleitungsbezogenen Verantwortlichkeit zusätzlich auf einer halben Seite. In HE und BE sowie RP existieren mit mehr als 4 (HE) bzw. mehr als 3 Seiten (RP, BE) ebenfalls vergleichsweise umfangreiche Beschreibungen.
Weniger umfassend fällt demgegenüber die Darstellung von Personalentwicklung als Element von Schulqualität in NI und SL aus (hier bleibt es bei jeweils einer halben Seite), auch in BY wird das Einsatzfeld im Bereich der „unterstützenden Personalführung“ sehr kondensiert auf einer 1/3 Seite behandelt. In dem insgesamt äußerst knapp gehaltenen zweiseitigen Orientierungsrahmen aus TH kommt der Personalentwicklung keinerlei eigene Darstellung zu, sie wird hier nur in einem Halbsatz beispielhaft als mögliche Einflussgröße auf die Kontextqualitäten von Schule erwähnt.
Der Umfang an Ausführungen zum Gegenstandsbereich Personalentwicklung unterscheidet sich in den Referenzrahmen der Länder erkennbar: Er reicht von der bloß beispielhaften Erwähnung als potenzieller Einflussfaktor auf schulische Rahmenbedingungen bis hin zu einer Gesamtdarstellung der Aus- und Fortbildung schulischen Personals in Form der Veröffentlichung eines eigenen Referenzdokuments.
Eine weitere formale Unterscheidung lässt sich dahin gehend ausmachen, auf welcher Hierarchieebene des Referenzrahmens die Ausführungen zur PE enthalten sind (→ Aspekt 3): Während in MV das kombinierte Themenfeld „Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung“ als einer von sechs Qualitätsbereichen bereits auf der ersten Ebene konzeptualisiert ist und Hamburg sowie Nordrhein-Westfalen mit dem separaten Referenzdokument eine gesonderte Darstellungsebene einführen, wird Personalentwicklung bzw. ihr semantisches Äquivalent in der Hälfte der Länder (BE, BB, HEFootnote 6, RP, SL, SN, ST, SH) auf der zweiten Ebene der Merkmalssystematik aufgeführt. In BW, BY, HB und NI sowie in dem allgemeinen Hamburger Orientierungsrahmen sind die Ausführungen zur Personalentwicklung auf einer darunterliegenden (z. T. als Indikatoren- bzw. Aspektebene) bezeichneten, dritten Darstellungsebene zu finden. Der Thüringer Rahmen nimmt insgesamt keine konkrete Zuweisung im Sinne einer Einordnung in eine Gesamtmerkmalssystematik vor, sodass hierzu keine Aussage getroffen werden kann.
Die Sichtbarkeit von Personalentwicklung als Ansatzpunkt für die Qualitätsentwicklung von Schulen ist auch angesichts der Frage, ob diese als eigene Einflussgröße in einem grafischen Strukturmodell (→ Aspekt 4) ausgewiesen wird, unterschiedlich stark ausgeprägt: Während dies in BB, MV, NI, NW, RP ganz unmittelbar der Fall ist, führen die Länder HB, HE, SN und HH in den Modelldarstellungen ihrer Referenzrahmen nur die jeweils übergeordnete Qualitätsdimension auf. BE und SH veröffentlichen in ihren Rahmenkonzepten kein Strukturmodell im eigentlichen Sinne, präsentieren aber jeweils eine Übersichtstabelle, innerhalb der Personalentwicklung als Baustein mitaufgeführt wird. Hessen setzt diesFootnote 7 in seiner zusätzlich bestehenden Übersichtstabelle in entsprechender Weise um; für BY und SL betrifft dies anstelle des Konstrukts „Personalentwicklung“ die dort jeweils zutreffenden Begriffsverwendungen „unterstützende Personalführung“ bzw. „Fortbildung“. Die Überblicksdarstellung von BW enthält ausschließlich die übergeordnete Dimension „Professionalität sichern und weiterentwickeln“. In den Rahmendokumenten der Länder ST und TH sind weder Strukturmodelle noch Übersichtsdarstellungen enthalten, sodass sich hier anlagebedingt die Frage eines Einschlusses von PE im Rahmen grafischer Abbildungen nicht stellt.
3.4.2 Inhaltliche Zuschnitte
Im Weiteren werden die Analyseergebnisse berichtet, die ausgehend von den Darstellungen in den Landesreferenzrahmen den Gegenstand der Personalentwicklung in seinen inhaltlichen Zuschnitten als Element schulischer Qualitätsentwicklung kennzeichnen. Dazu werden folgende vier Auswertungsaspekte herangezogen (vgl. Abb. 3.2 Konzeptionelle Elemente der Leitbilder schulischer Personalentwicklung in den Qualitätsrahmen der Länder):
-
1)
Inhaltlich-klassifikatorische Einordnung in das Kategorienraster des Qualitätsrahmens
-
2)
Adressierung von Steuerungsakteuren
-
3)
Ausgewiesene Bestandteile von Personalentwicklung (Kriterien/Indikatoren im Teilkapitel)
-
4)
Im Gesamtkontext des Referenzsystems zusätzlich vorhandene Querverweise
Mit Blick auf die Einordnung in das Kategorienraster (→ erster Aspekt) ist erkennbar, dass in der klaren Mehrheit der Länder Personalentwicklung als Führungsaufgabe verstanden und insofern als Handlungsfeld dem Qualitätsbereich des Schulmanagements zugerechnet wird (BY, BE, BB, HB, HH, HE, NW, RP, SL, SN, SH). In Sachsen-Anhalt, wo mit dem Begriff der PE selbst nicht operiert wird, lässt sich der Gegenstandsbereich zumindest ausgehend von den aufgeführten InstrumentenFootnote 8 primär dem Bereich des Leitungsgeschehens und Schulmanagements zurechnen. Anforderungen, die sich gezielt auf die Fortbildung des schulischen Personals beziehen, sind in BE, BB, HE, NW, SN, ST und SH jenseits der gewählten Einordnung als Managementaufgabe zusätzlich im Qualitätsbereich der Lehrkräfte professionalität/Professionalisierung zu finden.
Demgegenüber wird Personalentwicklung in zwei Ländern ausschließlich (BW) oder zumindest sehr vordergründig (MV) dem Qualitätsbereich Professionalität/Professionalisierung zugeordnet, sodass hier im der Dimension des Schulmanagements kaum (MV) bzw. keine Ausführungen (BW) zur Entwicklung des schulischen Personals vorgenommen werdenFootnote 9. In Baden-Württemberg mag dies vor allem auf den grundsätzlichen Umstand zurückführbar sein, dass die Qualitätsdimension „Schulführung und Schulmanagement“ erkennbar zugeschnitten ist auf Anforderungen, die rein die Schul- und Unterrichtsentwicklung betreffen. Niedersachsen zählt im Rahmen seiner Einordnung Fragen der Personalentwicklung zum Themenfeld „Ziele und Strategien der Schulentwicklung“ und hier zum Teilbereich „Berufliche Kompetenzen“, ebenfalls also nicht zum Qualitätsbereich „Leitung und Organisation“. Eine eigene Dimension zur Lehrkräfte-Professionalität ist in der Struktur des Niedersächsischen Orientierungsrahmens aus 2014 nicht enthalten. Im Thüringer Referenzrahmen wird infolge der Kompaktdarstellung des Rahmens als kommentiertes Modell (vgl. Thiel und Tarkian 2019) insgesamt keine explizite Zuordnung des Gegenstandsbereichs PE zu einem Inhaltsfeld von Schulqualität vorgenommen, sodass für diesen Auswertungsaspekt keine Aussage getroffen werden kann.
Ausgehend von der gewählten Subsumptionslogik kann angenommen werden, dass für die Länder, die PE ausdrücklich als Bestandteil des Schulmanagements verstehen, sich eine Adressierung von Akteuren (→ zweiter Aspekt) auch unmittelbar auf die Person des Schulleiters bzw. - in erweiterter Ausweisung – auf die Schulleitung bezieht. Die entsprechenden Auswertungen dazu bestätigen, dass in der Tat in der Mehrzahl der Referenzrahmen der Schulleiter/die Schulleiterin oder die Schulleitung explizit als Verantwortlicher für das Aufgabenfeld der Förderung und Entwicklung des Schulpersonals einschließlich der Umsetzung von lehrkräftebezogenen PE-Maßnahmen angesprochen wird. In BY, HH, HE, RP ist dies quasi ausschließlich der Fall; in HE, NW, RP, SL und SH wird die Schulleitung dabei jenseits der damit verbundenen Aufgaben als Führungskraft zusätzlich auch hinsichtlich einer erforderlichen Weiterentwicklung ihres eigenen Kompetenzprofils adressiert. Für das Saarland ist sie explizit mit Blick auf die erwartete Erweiterung ihrer fachlichen, pädagogischen, methodischen und medienpädagogischen Kenntnisse angesprochen; in Hessen werden für die Umsetzung und eine Erfolgsbewertung beständiger Schulleitungs-Qualifizierungen auch verschiedene konkrete Anhaltspunkte und Bewertungskriterien aufgeführt. So wird z. B. erwartet, dass sich Fortbildungen für Schulleitungen am Anforderungsprofil für die Schulleitungsarbeit sowie an den Arbeitsschwerpunkten gemäß Schulprogramm orientieren, Leitungsfeedback eingeholt und professionelle externe Hilfe (Beratung, Supervision, Coaching) in Anspruch genommen wird. Positive Resonanz aus Kollegium und Schulgemeinschaft sowie durch dienstliche Vorgesetzte (bei Jahresgesprächen) soll als Erfolgsmaßstab für die Bewertung der wahrgenommenen Entwicklungsleistungen dienen.
In den Referenzrahmen der Länder BW, BE, BB, HB, NW, NIFootnote 10, SH, SL, SN und ST werden neben der Schulleitung auch die Lehrkräfte selbst ausdrücklich als zuständige Akteure angesprochen, wobei sich ihre Verantwortung erwartungsgemäß auf den Bereich der Entwicklung ihrer individuellen Professionalisierung respektive der Erweiterung ihrer Kompetenzen durch die Wahrnehmung entsprechender Qualifizierungsangebote bezieht. Dabei wird mitunter auch die Weitergabe von Lerninhalten in das Kollegium hinein als ihre Aufgabe eingeschlossen (SN, ST, MV) oder auf die erwartete Einholung (BY) bzw. Nutzung von Individualfeedback im Anschluss an Entwicklungsgespräche (BW) hingewiesen. Die Schulleitung ist demgegenüber vornehmlich in ihrer (Gesamt-) Zuständigkeit als Managerin einer systematischen Entwicklung und Förderung des Personals (BW, BE, BB, HB), bei der Erstellung von PE-Konzepten, Förderplänen oder Fortbildungskonzepten (SN, ST, NW) und teilweise auch als Verantwortliche für das Controlling, die Dokumentation und Würdigung der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen sowie die Umsetzung des Gelernten (HBFootnote 11) benannt. Zum Teil wird sie auch mit Blick auf ihre Vorbildfunktion und Fürsorgepflicht, einschließlich der Würdigung von Leistungen und Gewährung von Gratifikationen adressiert (BY, BB, SH und HHFootnote 12) oder hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte auf der Grundlage standardisierter Festlegungen erfolgt (NW, unter Verweis auf den zusätzlich existierenden Orientierungsrahmen).
In den PE betreffenden Ausführungen des Qualitätsrahmens von MV ist weder der Schulleiter noch die Schulleitung als erweiterter Führungskreis explizit adressiert. Stattdessen wird die Zuständigkeit hier primär auf die Schule als verantwortliche Handlungseinheit sowie auf die Lehrkräfte/Lehrerschaft zwecks Wahrnehmung von Maßnahmen der Qualifizierung und Kooperation sowie der Entwicklung eines Fortbildungs- und Beratungskonzepts bezogen. Auch im Niedersächsischen Orientierungsrahmen ist die Schulleitung nicht ausdrücklich als Steuerungsakteur angesprochen. Eine Adressierung erfolgt hier vordergründig mit Blick auf das pädagogische Personal im Gesamten.
Die Schule als korporativen Akteur im Zusammenhang mit PE anzusprechen, ist in einigen Ländern – dann allerdings ergänzend zu vorhandenen Direktadressierungen der Schulleitung und/oder Lehrerschaft – vor allem mit Blick auf allgemeinere Aufgaben üblich. Dazu zählen etwa die Sicherstellung von nötigen Rahmenbedingungen für PE (BB) oder die Erfassung der bestehenden Situation an der Schule mit Blick auf die im Rahmendokument aufgeführten „Merkmale als Anhaltspunkte“ (HB). Aber auch mit Bezug auf die Erstellung eines gemeinsamen Fortbildungskonzepts bzw. der schulischen Fortbildungsplanung oder bei der Umsetzung von SchiLf-Veranstaltungen wird mitunter die gesamte Schule als Handlungseinheit (mit)angesprochen (NW, RP, SL, ST).
Hinsichtlich der Frage, welche Bestandteile ausgehend von den unmittelbar im PE-Kapitel aufgeführten Kriterien/Indikatoren zum Handlungsfeld gezählt werden (→ dritter Aspekt), fällt auf, dass teilweise im Vorfeld einer Operationalisierung zunächst eine allgemeine konzeptionelle Rahmung des Gegenstandsbereichs vorgenommen wird: Hier werden einleitend Aussagen zum Zweck und Mehrwert sowie zu den gewünschten Grundsätzen und Bezugspunkten von PE getroffen, dies teilweise unter Bezugnahme auf schulrechtliche Normen oder unter Zuschnitt auf differentielle Zielgruppen (siehe hierzu insbesondere die Ausführungen im Hessischen Referenzrahmen).
Weitere Besonderheiten
In den Referenzrahmen aus Bremen und Mecklenburg-Vorpommern sind speziell Teams und Gremien/Konferenzen als zuständige Instanzen für die Abstimmung von Fortbildungsinhalten und die Reflexion des professionellen Handelns benannt. Berlin, Bremen und Hessen adressieren im Zusammenhang mit Personalentwicklungsaufgaben neben innerschulischen Verantwortlichen auch außerschulische Akteure: Während Berlin die Schulaufsicht als zuständige Ebene für die Unterstützung und Beratung der Schule bei der Personalentwicklung benennt, wird in Bremen das Landesinstitut LIS als Ansprechpartner für die Lehrkräfte-Fortbildung aufgeführt. Im Hessischen Referenzrahmen wird der Schulleitung für die Umsetzung von Personalentwicklung (ohne weitere Konkretisierung) externe Unterstützung zugesagt.
Dem Thüringischen Qualitätsrahmen lässt sich im Kontext seiner Ausführungen zu Personalentwicklung insgesamt keine Adressierung von Akteuren entnehmen.
Als konkrete Instrumente und Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Personalentwicklung erwartet werden, sind insbesondere folgende Elemente erfasst:
3.4.3 Entwicklungskonzept und Fortbildungsplanung
Ein Personalentwicklungs-Konzept als solches wird explizit als Grundlage für die schulische PE in den jeweiligen Kapiteln von Berlin, Hessen und Sachsen benannt, wobei der Hessische Referenzrahmen im Weiteren mit Blick auf die Umsetzung des Konzepts eine Vielzahl möglicher Anhaltspunkte als Praxishilfen dafür benennt und daran anknüpfend aufzeigt, woran eine gelungene PE erkennbar ist. Eine periodische Überprüfung und Überarbeitung des Konzepts ist entsprechend vorgesehen. Sachsen stellt nicht im PE-betreffenden Kapitel selbst, aber direkt in der Einleitung zu seiner Kriterienbeschreibung unter Verweis auf das Schulgesetz fest, dass ein entsprechendes PE-Konzept für die Schulen verbindlich zu erstellen und von der Schulleitung zu verantworten ist. In Bremen wird darauf hingewiesen, dass die schulische Personalentwicklung sich an den Schwerpunkten des Schulprogramms orientieren und die dort beschriebenen Ziele in PE-Maßnahmen abbilden soll; ein Personalentwicklungskonzept als solches wird für den Stadtstaat im Kontext der Festlegung von innerschulischen Aufgabenverteilungen als Bezugspunkt erwähntFootnote 13.
Häufiger als die Erwartung eines Personalentwicklungskonzepts als Ganzem findet sich in den Ländern innerhalb des PE-Kapitels der Anspruch nach einem Fortbildungskonzept bzw. einer Fortbildungsplanung (BW, BY, BE, HH, MV, RP, SLFootnote 14, SNFootnote 15, ST), zu der zumeist auch Anforderungen in Bezug auf ihre Gestaltung gestellt werden. Dazu zählt etwa, diese auf Basis der schulischen Entwicklungsziele anzupassen (BW, BYFootnote 16) bzw. relevante pädagogische Handlungsfelder zu bedienen (BW, BE, MV) oder bildungspolitische Rahmensetzungen zu berücksichtigen (BW), eine regelmäßige Überprüfung/Aktualisierung vorzunehmen (HH) oder sie als Grundlage für Beratungsgespräche mit den Lehrkräften zur Entwicklung ihrer professionellen Kompetenzen heranzuziehen bzw. im Gesamtkollegium gemeinsam Schwerpunktsetzungen zu gestalten (BE, RP). In BY, HH, RP, SN und ST sind Anforderungen im Zusammenhang mit einem Fortbildungskonzept explizit als Aufgabe der Schulleitung aufgeführt.
Auch ausgehend von den Ausführungen des Niedersächsischen und Hessischen Referenzrahmens, des Bremer wie des Schleswig-Holsteinischen Orientierungsrahmens ist die Erstellung eines Fortbildungskonzepts vorgesehen – hier sind diesbezügliche Erwartungen in PE-benachbarten Teilbereichen wie „Fort- und Weiterbildung“ oder „Professionalisierung“ enthaltenFootnote 17. Für Bremer Schulen ist eine Fortbildungsplanung Teil des Schulprogramms. Es soll terminiert sein, Priorisierungen enthalten, ausgehend von den Schwerpunktsetzungen der Fach-, Lernfeld- und Jahrgangskonferenzen und bildungspolitischen Rahmensetzungen relevante schulspezifisch-pädagogische Handlungsfelder bedienen und regelmäßig überprüft werden. Alle Lehrkräfte haben sich mindestens 30 h pro Schuljahr weiterzuqualifizieren, die Schulleitung soll die Umsetzung des Gelernten sichern. Der Brandenburgische Rahmen, der die Fortbildungsplanung gleichermaßen separat behandeltFootnote 18, weist die Entwicklung der dazugehörigen Grundsätze explizit als Aufgabe der Lehrkräftekonferenz aus. Die fachlichen Schwerpunkte sind im Weiteren ebenfalls über die Fach-, Abteilungs- und Jahrgangsstufenkonferenzen ausgehend vom Schulprogramm zu bilden und der Fortbildungsbedarf regelmäßig unter Berücksichtigung der Wünsche aus dem Kollegium zu ermitteln. In Nordrhein-Westfalen wird die Fortbildungsplanung ebenfalls in einem benachbarten Teilkapitel als gemeinsame Aufgabe von Schulleitung und der Schule als korporativem Akteur behandelt; dabei ist die Planung am Schulprogramm wie an Evaluationen zu orientieren. Für den Schulleiter ist der Auftrag eingeschlossen, die Rolle des Fortbildungsbeauftragten zu übernehmen oder diese zu delegieren. In Baden-Württemberg stellt eine koordinierte Fortbildungsplanung einen Referenzpunkt (Qualitätsstandard) zur Sicherung und Entwicklung von Professionalität dar und bildet als solchen einen zweiten Indikator neben einer systematischen Personalentwicklung und -förderung. Dort ist spezifiziert, dass diese mittel- bzw. langfristig anzulegen und mit festgelegten Zuständigkeiten zu versehen ist.
3.4.4 Fortbildung
Für den Bereich der Fortbildung selbst werden innerhalb der Ausführungen zur PE häufig Erwartungen an die Angebote bzw. -inhalte von Fort- oder auch Weiterbildung kommuniziert (BW, BY, BE, BB, HH, MV, NW, SH, SN). Dazu zählt häufiger, dass die aktuellen Schulentwicklungsziele bzw. Schwerpunkte des Schulprogramms oder „relevante pädagogische Handlungsfelder“Footnote 19 die Grundlage bilden (BW, BE, HH, BY, MV, SH) oder dass neben schulischen Erfordernissen auch individuelle Wünsche der Lehrkräfte bedarfsgerecht berücksichtigt werden (BY, BE, SH). Zum Teil wird dabei auch die Initiierung/Aktivierung professioneller Weiterentwicklung bei Lehrkräften bzw. eine Ermöglichung und Unterstützung zur Fortbildungsteilnahme als Aufgabe der Schulleitung eingefordert (BW, BE, BBFootnote 20, HH, NW). In anderen Fällen wird der Wunsch betont, dass ein Transfer neuer Wissensbestände und Kompetenzen aus Fortbildungen in die Gesamtorganisation hinein erfolgt (BE, MV, RP, SL, SN, SHFootnote 21). In Hamburg und Bremen ist explizit auf die (regelmäßig vorzunehmende) Überprüfung einer Passung zwischen den Qualifikationen, persönlichen Stärken und Zielsetzungen der Mitarbeiter und den institutionellen Erfordernissen und Schulentwicklungszielen als Schulleitungsaufgabe hingewiesen. Für Nordrhein-Westfalen gilt ausdrücklich, dass Lehrkräfte ihre Kompetenzen auf der Basis des zusätzlich veröffentlichten Orientierungsrahmens „Lehrkräfte in der digitalisierten Welt“ und dabei vordergründig im Team und schulintern sowie auf Basis digitaler Angebote weiterentwickeln sollen. In Sachsen wird zur Sicherung nachhaltiger Bildung auch eine Überprüfung und Dokumentation der umgesetzten Fortbildungsmaßnahmen angeregt.
3.4.5 Mitarbeitergespräche, Leistungsfeedback und Unterrichtsbesuche
Als weitere in Einsatz zu bringende Instrumente und Maßnahmen werden in der Mehrzahl der Referenzrahmen Mitarbeitergespräche bzw. Mitarbeiter-Vorgesetzten-, Jahres- oder Personalentwicklungsgespräche genannt (BW, BY, BE, BB, HB, HE, MVFootnote 22, SN, ST) und/oder es sind Formate einer regelmäßigen Leistungsrückmeldung/Individualfeedback der Schulleitung an Lehrkräfte vorgesehen (BW, BB, HH, NW, RP, SHFootnote 23), die in einer organisationsorientierten Lesart als funktionales Äquivalent verstanden werden können. Dabei werden ausschließlich in Bayern, Bremen, Hessen und Sachsen als obligatorische Bestandteile der Mitarbeitergespräche zusätzlich Zielvereinbarungen explizit mitgenannt. In Hessen ist vermerkt, dass die Umsetzung der dabei getroffenen Vereinbarungen zu überprüfen ist und aus den Ergebnissen Konsequenzen gezogen werden sollen.
Unterrichtsbesuche bzw. -hospitationen, die üblicherweise als Basis entsprechender Gespräche dienen, werden explizit in den Ausführungen der Länder BE, BB, HH, MVFootnote 24 und NW als leitungsseitig einzusetzende Verfahren erwartet; in Berlin ist der Besuch und eine darauf aufbauende Beratung auch speziell mit Blick auf die Lehramtsanwärter aufgeführt. Ein einigen weiteren Ländern sind Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung ebenfalls im Referenzrahmen genannt, allerdings nicht im Bereich der Personalentwicklung, sondern an einer anderen Stelle, so etwa in Schleswig-Holstein (hier zum Teilbereich der Unterrichtsentwicklung gehörig) und in Rheinland-Pfalz (dem Bereich „Unterrichtsentwicklung als Führungsaufgabe“ zugeordnet). In Brandenburg sind Unterrichtsbesuche an mehreren Stellen des Orientierungsrahmens zusätzlich aufgeführt, da sie als Quelle zur Bewertung verschiedener Qualitätsmerkmale im Rahmen von Evaluationen herangezogen werden sollen. In BY, HE und ST werden keine schulleitungsseitigen Unterrichtsbesuche genannt, hingegen kollegiale Hospitationen innerhalb der Lehrerschaft erwartet. NW erwartet diese zusätzlich zu den Unterrichtsbesuchen der Schulleitung und weist darauf hin, dass auch die Bildung professioneller Lerngemeinschaften und kollegiale Fallberatung durch die Schulleitung zu fördern ist. Ausgehend von ihrer Funktion als peer reviews oder Instrument der Einarbeitung für neue Lehrkräfte werden die kollegialen Unterrichtsbesuche allerdings ebenfalls nicht im Bereich der PE, sondern an anderer Stelle des Referenzrahmens aufgeführt.
In einigen Ländern ist die Durchführung, das Einholen und die Nutzung von Individualfeedback gezielt als Aufgabe der Lehrkräfte ausgewiesen und wird als solche entweder unmittelbar im einschlägigen Handlungsfeld genannt (BY) oder als Qualitätsindikator neben der Personalentwicklung und -förderung aufgeführt, mit dem Ziel, dass diese gemeinsam auf den Qualitätsstandard der Sicherung und Entwicklung von Professionalität einzahlen (BW).
3.4.6 Auswahl und Einsatz von Personal
In den Referenzrahmen der Länder BW, BY, BE, BB, HE, NW, RP, SH wird im Themenbereich der Personalentwicklung auch die Auswahl, z. T. auch der Einsatz von Personal behandelt. Während dabei in Schleswig-Holstein allgemein ein professionelles, zielführendes Personalauswahlverfahren als Schulleitungsaufgabe benannt ist und Berlin die Personalauswahl an ein PE-Konzept koppelt, weist Hessen auf die Gesamterfordernis zur professionellen, systematischen und bedarfsgerechten Personalgewinnung, -auswahl und -ausbildung hin und zeigt im Weiteren mehrere Anhaltspunkte auf, wie Schulleitung dies sicherstellen und den diesbezüglichen Erfolg messen kann. Weiter heißt es, dass bei der vorausschauenden Planung neben schulischen auch (sofern möglich) persönliche Bedürfnisse der Lehrkräfte zu berücksichtigen sind. Auch in Baden-Württemberg und Bayern sowie in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen wird mit Blick auf die innerschulische Aufgabenzuteilung oder die Bildung schulischer Schwerpunktsetzungen die Erwartung betont, personenindividuelle Aspekte der Lehrkräfte, wie ihre Fähigkeiten, Lebenslagen und Interessen, zu berücksichtigen.
Im Brandenburger Orientierungsrahmen, wo Personalentwicklung und Personaleinsatz ein gemeinsames Handlungsfeld bilden, erfolgt zudem der spezifische Hinweis, einen fachfremden Einsatz von Lehrkräften zu vermeiden bzw. im Falle eines fachfremden oder schulformfremden Einsatzes begleitend zu qualifizieren und zu unterstützen. Fachfremdes Personal gezielt zu unterstützen, soll auch ausgehend von den Ausführungen in Nordrhein-Westfalen erfolgen, hier explizit durch die Fachlehrkräfte aus dem Kollegium. Zugleich wird im Kontext der Personalauswahl auf das Ziel einer Gleichstellung sowie der Berücksichtigung (inter)kultureller Aspekte hervorgehoben. In Bremen ist fachfremder Einsatz in einem Nebenkapitel als eigener Anlass für Fortbildungsangebote genannt und als solcher entsprechend im PE-Konzept und Fortbildungsprogramm zu berücksichtigen; auf eine Unterstützung durch Fortbildungsangebote des LIS wird hingewiesen.
Auch Rheinland-Pfalz benennt Grundsätze für die Personalauswahl (wie die nötige Passung von Qualifikation und Eignung mit der schulischen Qualitätsarbeit). Fragen zum Einsatz der Lehrkräfte werden hier jenseits des PE-Bereichs separat als Aufgabe des Schulmanagements beschrieben.
3.4.7 Einarbeitung und Leistungswürdigung
Die Einführung/Einarbeitung und Integration bzw. Begleitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt in BW, BY, BE, BB, NW, SN, SH, RP als Aufgabe ebenfalls mit zum Handlungsfeld der Personalentwicklung. In BE, HE und SH ist in diesem Zusammenhang speziell auch die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst angesprochen.
Aufforderungen zur leitungsseitigen Würdigung bzw. Anerkennung von Leistung und Erfolgen der Lehrkräfte finden sich in BY, SH sowie in BB (hier soll dies auch institutionalisiert werden). Auch in HH wird zur gezielten Anerkennung/Wertschätzung ihrer Arbeitsleistung aufgerufen, dies ist hier allerdings im benachbarten Bereich der Personalführung sowie im Teilkapitel „Zufriedenheit mit der Schulleitung“ genannt.
Weitere Einzelhinweise
In Bayern sind Schulleitungen aufgerufen, Unterstützungsangebote für die Bearbeitung von berufsrelevanten Problemen zur Verfügung zu stellen. Auf die Förderung von Mobilität, individueller Karriereplanung und der Möglichkeit zur Nutzung von Praktika durch Lehrkräfte wird speziell in Hamburg und Brandenburg hingewiesen. In Hessen ist im Zusammenhang mit der Begleitung von Lehrkräften die Förderung von Mentoring und eine spezifische Unterstützung von Frauen bei der Übernahme von Leitungsaufgaben eingefordert. Die Legende zum Bayerischen Qualitätstableau enthält den Hinweis, dass ein Feedback zur Wirksamkeit der eingeführten Verfahren durch die Schulleitung erfolgen soll.
Als weiterführende Querverweise (→ vierter Aspekt) - neben den bereits benannten, die sich auf Ausführungen zu PE-Instrumenten in einschlägigen benachbarten Kapitelteilen beziehen – lassen sich in einigen Ländern Erläuterungen zum Gegenstandsbereich von Personalentwicklungen im Gesamtzusammenhang der Referenzrahmen finden, mit denen Aussagen zum Stellenwert oder zu Akzentuierungen von PE oder auch zu konzeptionellen Verbindungen zwischen PE und weiteren Qualitätselementen getroffen werden.
So ist beispielsweise im Referenzdokument von BW (hier in einem integrierten Glossar) eine Definition von Personalentwicklung enthalten, die letztlich eine rahmengebende Funktion entfalten soll für die Bestandteile, die im Inhaltsteil zum PE-Bereich referiert werden. Hierzu heißt es, dass Personalentwicklung „alle Aktivitäten rund um die Auswahl, Laufbahnplanung und Fortbildung der Lehrkräfte, der Schulleitung sowie des nicht lehrenden Personals [einschließt]. Hierbei stehen insbesondere Maßnahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung fachlicher und überfachlicher Qualifikationen und Kompetenzen im Vordergrund.“ Berlin definiert demgegenüber in noch etwas erweiterter Form, dass „Personalentwicklung als wesentlicher Bestandteil professionellen Leitungshandelns .. gezielte Personalauswahl, adäquater Personaleinsatz zur Sicherstellung und Entwicklung des Unterrichts, kompetente Personalführung in der Schule und eine an den Entwicklungszielen der Schule ausgerichtete Aus-, Fort- und Weiterbildungsplanung [bedeutet]“.Footnote 25
Für Hessen wird darauf hingewiesen, dass Personalentwicklung seine Bedeutung als Einsatzfeld vor allem im Kontext erweiterter Gestaltungsspielräume von Schulen erhält. In Abschnitt 5.2 ist zudem für das Schulprogramm der Anspruch formuliert, dass Entwicklungsziele für PE enthalten sind. Hamburg betont die Relevanz von Personalentwicklung nicht über eine Ausweisung in seinem Strukturmodell zur Schulqualität, erläutert aber, dass der Gesamtzweck des Hamburger Orientierungsrahmens an sich u. a. darin besteht, „Anregungen für die Personalentwicklung zu liefern“.Footnote 26
Zudem werden in einzelnen Ländern wie Berlin und Brandenburg Verbindungen zwischen dem obligatorisch zu erstellenden und fortzuschreibenden Schulprogramm und Fragen der Personalentwicklung dahin gehend hergestellt, dass Entwicklungsziele für die schulische PE Bestandteile des Schulprogramms bilden sollen. Weitere Hinweise auf Querverweise sind Abb. 3.2 Konzeptionelle Elemente der Leitbilder schulischer Personalentwicklung in den Qualitätsrahmen der Länder zu entnehmen.
3.5 Zusammenfassung
Die Auswertung der in den Referenzrahmen enthaltenen Darstellungen zu Personalentwicklung als Handlungsfeld schulischer Qualitätsentwicklung zeigt, dass in einem überwiegenden Teil der Länder eine Übereinstimmung zur grundsätzlichen Einordnung des Gegenstands besteht. PE wird in fast allen Fällen als Merkmal von Schulmanagement bzw. als Element schulischen Führungshandelns verstanden; insofern sind auf der Basis von (allerdings im Umfang stark variierenden) Anforderungen zur Ausrichtung und Gestaltung des Handlungsbereichs in den meisten Fällen auch explizit der Schulleiter/die Schulleiterin bzw. der Kreis der erweiterten Schulleitung als Verantwortliche adressiert. Mit Blick auf die Wahrnehmung von Qualifizierungsangeboten, teilweise auch in Bezug auf einen Transfer der Lerninhalte in die Schulgemeinschaft hinein, werden daneben vielfach auch die Lehrkräfte selbst als Akteure zur Sicherung von Professionalisierungszielen mitangesprochen. Dies erfolgt allerdings schwerpunktmäßig in PE-benachbarten Qualitätsbereichen, in denen Erwartungen an die Professionalität der Schulgemeinschaft ergänzt bzw. vertieft werden.
Einzelne Länder wie MV oder NI setzen mit ihrer direkten Zuordnung von Personalentwicklung als Bestandteil des Kapitels zur Lehrerprofessionalität bzw. zur Schulentwicklung und einer insgesamt deutlich weniger schulleitungszentrierten oder sogar vordergründigen Ansprache der Lehrerschaft/Schulgemeinschaft in dieser Hinsicht eine etwas stärkere Akzentuierung. In den hierbei vorgenommenen Ausführungen wird auch entsprechend eine partizipative, ausdrücklich auch an den Bedarfen der Lehrkräfte ausgerichtete Entwicklung von Planungsleistungen wie die gemeinsame Erstellung von Fortbildungs- und Beratungskonzepten betont bzw. die Bereitschaft und Motivation der Lehrkräfte zum berufsbegleitenden Lernen als erfolgskritisches Element der Entwicklungsarbeit herausgestellt, für die Anreize geschaffen werden sollen. Die Schulleitung ist demgegenüber hier kaum explizit als Steuerungsakteur mit spezifischen Leitungsaufgaben bei der Umsetzung von PE adressiert.
Während PE in einigen Fällen ausdrücklich als Bestandteil des Qualitätsentwicklungszyklus im Zusammenhang mit einem entsprechenden Strukturmodell ausgewiesen wird, sodass ihre zentrale Funktion für eine dauerhafte Sicherung von Unterrichtsqualität (vgl. Qualitätskommission zur Schulqualität in Berlin 2020) unmittelbar erkennbar wird, verbleibt sie in den anderen Fällen, in denen ein solches Modell existiert, ausgehend von ihrer Einordnung auf zweiter oder dritter Ebene der Referenzrahmen als nicht direkt sichtbares Element unterhalb der ausgewiesenen Ebene der Qualitätsdimension.
Deutlichere inhaltlich-konzeptionelle Unterschiede bestehen zwischen den Ländern mit Blick auf die Frage, welche Instrumente und Verfahren jeweils als feste Bestandteile schulischer PE-Arbeit über die Referenzrahmen eingefordert werden und inwieweit damit spezifische (Gestaltungs-)Ansprüche an ihren Einsatz verbunden sind. Während in einigen Ländern hierzu insgesamt relativ wenige An- und Vorgaben existieren, erfolgt in anderen Konzepten eine vergleichsweise tief gehende Operationalisierung, die über die Benennung verschiedener Instrumente und Verfahren hinaus auch spezifische Qualitätsanforderungen an diese enthält. In einzelnen Fällen ist diese sogar bis hin zur Check-List in Form von aufschließenden Fragen heruntergebrochen, mittels derer die schulischen Akteure mit konkreten Erwartungen hinsichtlich definierter Schritte/Handlungsweisen und sogar einer anschließenden Erfolgskontrolle konfrontiert werden.
Während ein übergeordnetes Personalentwicklungskonzept in theoretischer Perspektive als Angelpunkt einer fundierten Ausrichtung und koordinierter PE-Maßnahmen auf Organisationsebene entsprechende Bedeutung erfährt, so wird dieses landespolitisch nur in einem Drittel der Länder über die Referenzrahmen vorausgesetzt und dort nur im Einzelfall weiter spezifiziert. Ein Fortbildungskonzept bzw. eine Fortbildungsplanung ist demgegenüber als Grundlage für die Einleitung und Umsetzung konkreter Bildungsmaßnahmen in allen Referenzdokumenten außer dem Thüringer Qualitätsrahmen, der infolge seines Zuschnitts als kommentiertes Modell insgesamt keine Angaben zur schulischen Fort- und Weiterbildung beinhaltet, klar vorgesehen. In der Hälfte der Länder bildet die Fortbildungsplanung einen unmittelbaren Bestandteil der Darstellungen zum PE-Kapitel, in dem anderen Teil finden sich entsprechende Ausführungen in Qualitätsbereichen wie „Professionalität“ oder „Ziele und Strategien der Schulentwicklung“. Dieser Umstand scheint mit der mal stärker, mal weniger stark betonten Brückenfunktion zwischen den schulischen Entwicklungszielen bzw. der Schulprogrammarbeit auf der einen und der Erwartung an eine zielgerichtete Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte auf der anderen Seite zu korrespondieren. Als beanspruchte Konzeptionselemente der Fortbildungsplanung wird insgesamt mehrfach eine systematische, mittel- bis langfristige Ausrichtung mit festgelegten Zuständigkeiten bei kontinuierlicher Anpassung genannt, wobei die Schulleitung in federführender Verantwortung steht, die konkrete Erstellung der Planungsschwerpunkte aber unter Einschluss der schulischen Konferenzen oder sogar durch die gesamte Schulgemeinschaft erfolgen sollte. In einigen Fällen ist auch die Schulleitung selbst als Adressat im Hinblick auf eine regelmäßige Erweiterung ihrer Kompetenzen mitangesprochen.
Anforderungen, die mit Blick auf die Auswahl bzw. den inhaltlichen Zuschnitt und die Umsetzung von Fortbildungsmaßnahmen gestellt werden, betreffen zumeist den erforderlichen Bezug zu (programmatisch definierten) Zielen der Schule, Ergebnissen aus Evaluationen oder bildungspolitischen Schulsetzungen, beziehen sich in mehreren Ländern aber ausdrücklich auch auf den gleichzeitig zu verfolgenden Anspruch, individuelle Wünsche der Lehrkräfte mitzuberücksichtigen. Die Schulleitung ist regelmäßig dazu aufgerufen, die Wahrnehmung von Fortbildungsmaßnahmen für das Kollegium zu ermöglichen bzw. zu unterstützen. In einzelnen Fällen ist ihre Rolle auch stärker konturiert, etwa wenn sie angehalten ist, die Teilnahme an Fortbildungen zu initiieren bzw. die Lehrkräfte dahin gehend zu aktivieren und (regelmäßig) die Passung zwischen den Kompetenzen und Zielen der Mitarbeitenden und den institutionellen Erfordernissen zu überprüfen und Anpassungen einzuleiten. Dabei findet sich mitunter auch die Festlegung, dass die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen Bestandteil schulleitungsseitigen Controllings ist, von daher regelmäßig von dieser dokumentiert und in ihrer Umsetzung gesichert werden soll; hier wird unter Verweis auf eine gesetzliche Festlegung auch ein Mindestumfang für Qualifizierungen genannt. Mehrfach wird in allgemeiner Form beansprucht, dass innerschulisch ein Austausch über Fortbildungsinhalte erfolgt bzw. Erkenntnisse oder neue Kompetenzen in schulische Arbeitszusammenhänge eingehen sollen. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass in den Rahmenkonzepten mit Blick auf die leitungsseitige Sicherung von Fortbildungsergebnissen, die einer Weiterentwicklung von Unterricht dienen, kaum Ansprüche an Überprüfungsroutinen erhoben werden.
Hinsichtlich der Festlegung von inhaltlichen Erwartungen an die (Weiter-)entwicklung von Kompetenzen der Lehrkräfte zur Sicherung und Verbesserung von Lehr-Lern-Prozessen stechen sicherlich Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit ihren eigenständigen Qualitätsrahmen für die Lehrkräfteaus- und -fortbildung hervor. Nordrhein-Westfalen hat hier im Jahr 2020 eine spezifische Lösung zur Darstellung von Kompetenzerwartungen geschaffen, die es erlaubt, konkrete Vorgaben kommunizieren zu können, ohne den allgemeinen Referenzrahmen zu überstrapazieren und laufend anpassen zu müssen: Es erfolgt hier im Referenzrahmen ein Verweis auf einen zusätzlich in 2020 neu veröffentlichten Orientierungsrahmen, in dem ein Kompetenzmodell für Lehrkräfte veröffentlicht ist, das sich aktuell auf ein Arbeiten in der digitalisierten Welt ausrichtet. Hamburg geht einen ähnlichen Weg mit seinem Referenzrahmen des Landesinstituts, wohin ebenfalls Anforderungen an die Ausbildungs- wie Anpassungsqualifizierung des Schulpersonals ausgelagert wurden; ein ausdrücklicher Querverweis aus dem regulären Orientierungsrahmen heraus ist hier allerdings nicht eingerichtet.
Ein klar miteinander geteiltes Verständnis besteht offenbar mit Blick auf die erforderliche Umsetzung von Mitarbeitergesprächen bzw. Formaten einer regelmäßigen Leistungsrückmeldung/Individual-feedback der Schulleitung an Lehrkräfte. Diese werden, wenngleich auch in meist voneinander abweichender Kennzeichnung und ohne tiefer gehende Spezifikationen, in fast allen Referenzrahmen genannt. Daran angeschlossene Zielvereinbarungen zwischen Schulleitung und Lehrkräften sind hingegen nur in wenigen Einzelfällen fest vorgesehen. Auffällig ist ebenfalls, dass Unterrichtsbesuche durch Schulleitungen nur in einer Handvoll Ländern in den Darstellungen zur PE explizit aufgeführt werden; in den Gesamttexten der Rahmenkonzepte konnten dazu zumindest in sieben Fällen Hinweise gefunden werden. Einzelne Länder benennen stattdessen kollegiale Hospitationen zwischen Lehrkräften als Grundlage zur Weiterentwicklung des Unterrichts.
Die Auswahl, Integration und der Einsatz von Personal wird in der Hälfte der Länder neben den o.g. Konzeptelementen und Instrumenten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lehrkräften offensichtlich unmittelbar mitgedacht, sodass entsprechende Erwartungen oder Anregungen recht häufig in das einschlägige Kapitel zur PE integriert sind. Zum Teil werden Personalplanung und -einsatz dabei gezielt mit Personalentwicklung in einem Kapitel kombiniert. In manchen Fällen sind bei den diesbezüglichen Ausführungen spezifische Gruppen wie schulform- und fachfremdes Personal oder Lehramtsanwärter gesondert berücksichtigt. Entsprechende Hinweise finden sich unabhängig vom Veröffentlichungszeitpunkt der Referenzrahmen in älteren wie auch aktuelleren Dokumenten.
Ausführungen zu (besonderen Unterstützungsbedarfen bei) Quer-/Seiteneinsteigern sind hingegen in keinem der Dokumente explizit enthalten. In Sachsen wird lediglich im Vorwort darauf hingewiesen, dass die Kriterienbeschreibung auch in der Einstiegsqualifizierung für Seiteneinsteiger genutzt werde. Zu der mit Blick auf den Berliner Schulbetrieb formulierten Erwartung der Qualitätskommission, dass bei weiter anhaltendem Bedarf an entsprechenden Schnelleinstiegen „Konzepte der verbindlichen langfristigen Qualifizierung entwickelt und erprobt werden, so dass die Professionalisierung auch quantitativ an die der grundständigen Studiengänge angepasst wird“ (S. 99), sind in den Referenzrahmen insofern bis dato keine Anknüpfungspunkte gegeben. Es wäre im Weiteren zu verfolgen, ob die angeschlossene Konkretisierung „Dazu könnten beispielsweise spezifische Maßnahmen der Personalentwicklung, insbesondere verpflichtende Angebote der fachdidaktischen Weiterqualifizierung in der Berufseingangsphase, entwickelt und an den Schulen implementiert werden“ (ebd.) im Rahmen von Neuauflagen oder zusätzlichen Orientierungsrahmen für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften in den Ländern aufgegriffen werden.
Für die vorgenannten PE-Aufgaben werden – neben der mit Abstand am häufigsten genannten Schulleitung und den gerade für die eigene Qualifizierung regelmäßig mitangesprochenen Lehrkräften – nur in wenigen Einzelfällen noch zusätzliche Steuerungsakteure in einer unterstützenden Zuständigkeit adressiert, wie die Schulaufsicht, eine externe Beratung oder das Landesinstitut. Die Fokussierung erfolgt hier also recht klar auf innerschulische Steuerungsakteure. In der Funktion einer Reflexion des beruflichen Handelns oder der Abstimmung von Fortbildungsschwerpunkten sind entsprechend vornehmlich die schulischen Konferenzen/Gremien als ergänzende Zuständige benannt. In einigen Fällen wiederum verbleibt die Adressierung in den Ausführungen des PE-betreffenden Kapitels stark auf der Ebene einer Ansprache der Schule als korporativer Akteur, ohne dass überhaupt klare Einzelzuständigkeiten konkretisiert werden.
Ausgehend von den aufgezeigten Elementen ergeben sich in den Referenzrahmen mancher Länder somit sehr umfassende Leitbilder schulischer Personalentwicklung, die grundsätzliche Ausführungen zur strategischen Konzeption von PE als Element von Schulqualität beinhalten sowie vergleichsweise detaillierte Erwartungen zu einer breiten Palette an Verfahren und Instrumenten unter jeweils spezifischen Adressierungen kommunizieren. Demgegenüber erfolgt in einzelnen Fällen keinerlei konzeptionelle Ausarbeitung von PE im eigentlichen Sinne, bleibt diese weitestgehend auf den Bereich der Fortbildung beschränkt oder erschöpft sich darin, einzelne Elemente ohne weiterführende Erläuterungen oder Anforderungen eher aufzählend zu erfassen. Interessant wäre im Weiteren zu untersuchen, inwieweit die hierzu gefundenen Ausprägungen mit den in anderen Textgattungen vorgenommenen Ausführungen, die länderseitig zur Konzeption von Personalentwicklung existieren (v. a. aus schul- und untergesetzlichen Normen sowie weiteren Konzeptpapieren), miteinander korrespondieren und sich zu kohärenten Gesamtbildern verdichten ließen. Hier wäre also die Annahme zu hinterfragen, ob sich Standards und Anforderungen über ein Land hinweg in vergleichbarer Weise wiederfinden oder ob tendenziell eher eine textgattungseigene denn eine dokumentübergreifende, landesweite Logik von Leitbildern schulischer Personalentwicklung erkennbar wird.
Inwieweit schließlich die Ausführungen zur PE aus den Referenzrahmen (respektive aus den weiteren Konzeptdokumenten) in jeweiliger Form in der schulischen Praxis wahrgenommen werden und hier als handlungsleitende Maßstäbe dienen, ist darüber hinaus eine sehr spannende, aber noch unbeantwortete Frage, die weiterer empirischer Forschung bedarf.
Change history
01 February 2023
Einige Korrekturen wurden im Zuge der Produktion des Buchs übersehen. Neben einigen kleineren Korrekturen wurde die Darstellung des Herausgebenden- und Autor*innenverzeichnisses vereinheitlicht und eine zentrale Widmung hinzugefügt.
Notes
- 1.
vgl. dazu die Festlegungen entsprechender Benchmarks/Targets im Rahmen der ET 2020-Strategie, die derzeit mit Blick auf die Weiterentwicklung des europäischen Bildungsraums (EEA) bis 2030 weiter geschärft werden (https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en).
- 2.
Dies sind in alphabetischer Sortierung der Länder:
BW: Qualitätsrahmen zur Fremdevaluation (zweiter Durchgang), 2. Aufl., 2015
BY: Qualitätstableau der externen Evaluation in Verbindung mit der Legende zum Qualitätstableau, Aufl. 2013
BE: Handlungsrahmen Schulqualität, 2.Aufl., 2013
BB: Orientierungsrahmen Schulqualität, 3. Aufl., 2016
HB: Orientierungsrahmen Schulqualität, 1. Aufl., 2007
HH: Orientierungsrahmen Schulqualität, 3. Aufl., 2019 sowie daneben Referenzrahmen Lehrkräfteausbildung und Anpassungsqualifizierung, 2019
HE: Referenzrahmen Schulqualität, 2. Aufl., 2011
MV: Gute Schule – Externe Evaluation von Schulen, 1.Aufl., 2006
NI: Orientierungsrahmen Schulqualität, 3.Aufl., 2014
NW: Referenzrahmen Schulqualität, Aufl. aus 2020 sowie daneben Orientierungsrahmen für die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in NRW, 2020
RP: Orientierungsrahmen Schulqualität, 2. Aufl., 2017
SL: Orientierungsrahmen zur Schulqualität, Aufl. aus 2012
SN: Schulische Qualität im Freistaat Sachsen – Kriterienbeschreibung, 5. Aufl., 2018
ST: Qualitätsrahmen schulischer Arbeit, Aufl. aus 2013
SH: Orientierungsrahmen Schulqualität, Anlage zum Handbuch Schulfeedback SH, Aufl. aus 2016
TH: Schulischer Qualitätsrahmen, 1. Aufl. 2006.
- 3.
So zumindest wird für den Hessischen Referenzrahmen Schulqualität (2011) die bewusst höhere Ausweisung des Gegenstandsbereichs auf Dimensionsebene „aufgrund aktueller Entwicklungen und des hohen Bedarfs an Nachwuchsführungskräften“ begründet (S. 15).
- 4.
- 5.
- 6.
Im Hessischen Rahmen wird allerdings für die Gesamtanlage betont, dass dem Aspekt der Personalführung und -entwicklung „aufgrund aktueller Entwicklungen und des hohen Bedarfs an Nachwuchskräften eine besondere Bedeutung zu[kommt]; er wird deshalb als eigenständige Dimension im HRS behandelt“ (S. 15).
- 7.
… unter Verweis auf die hohe Bedeutung, die dem Aspekt „Personalführung und Personalentwicklung“ zum Veröffentlichungszeitpunkt zukomme und diesem die Behandlung als eigenständige Dimension im Referenzrahmen zuteil werden lasse (S. 15).
- 8.
Dazu zählen ein Fortbildungsplan, regelmäßige kollegiale Unterrichtsbesuche, Mitarbeitergespräche und individuelle Förderpläne.
- 9.
In MV stellt PE gemeinsam mit der Lehrerprofessionalität einen eigenen Qualitätsbereich auf oberster Ebene dar (vgl. Abschn. 4.1).
- 10.
So den Ausführungen zum PE-benachbarten Teilbereich (4.3.2 Fort- und Weiterbildung) zu entnehmen.
- 11.
So den Ausführungen zum PE-benachbarten Teilbereich (4.5.2 Professionalisierung) zu entnehmen.
- 12.
So den Ausführungen zum PE-benachbarten Teilbereich (1.3.1 Personalführung) und 3.5.2 (Zufriedenheit mit der Schulleitung) zu entnehmen.
- 13.
Zu finden nicht im PE-Teilkapitel selbst, sondern in Abschn. 1.5.2 zu „Kompetenzen und Aufgabenverteilung“.
- 14.
Im Saarländischen Orientierungsrahmen werden keine Anforderungen oder Erwartungen im eigentlichen Sinne kommuniziert, sondern es wird in offener Weise dargestellt, was Anhaltspunkte für die Fortbildung der Einzellehrkräfte bzw. für die Fortbildungsschwerpunkte der Schule sein können.
- 15.
In Sachsen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einrichtung eines Fortbildungskonzepts für alle Schulen verbindlich ist.
- 16.
Die Legende zum Bayerischen Qualitätstableau enthält zudem in Kapitel S. 8 „Systematisches Monitoring“ den Hinweis, dass auch schulinterne Lehrerfortbildungen zur Unterrichtsentwicklung zur Planung zählen.
- 17.
Im Hessischen Referenzrahmen finden sich Hinweise zum Fortbildungsplan über zahlreiche Kapitel hinweg.
- 18.
Zu finden unter QM 5.2. Fortbildung und Fortbildungsplanung.
- 19.
MV definiert diese als die Bereiche Integration, Längeres gemeinsames Lernen, Binnendifferenzierung, individuelle und Förderdiagnostik sowie Hochbegabtenförderung, Beurteilung und Klassenführung.
- 20.
Weitere Erwartungen zur Umsetzung von Fortbildungen finden sich im Brandenburger Orientierungsrahmen unter QM 5.2
- 21.
Hier erfasst im benachbarten Qualitätsbereich V „Professionalität und Zusammenarbeit“
- 22.
Hier erfasst im benachbarten Qualitätsbereich 4 „Schulmanagement“
- 23.
Hier erfasst im Bereich III.2 „Unterrichtsentwicklung“
- 24.
Hier erfasst im benachbarten Qualitätsbereich 4 „Schulmanagement“
- 25.
Berliner Handlungsrahmen, S. 30.
- 26.
Hamburger Orientierungsrahmen, S. 11.
Literatur
Bach, A., Wurster, S., Thillmann, K., Pant, H. A., & Thiel, F. (2014). Vergleichsarbeiten und schulische Personalentwicklung. Ausmaß und Voraussetzungen der Datennutzung. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 17(1), 61–84
Becker, M. (2013). Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis (6. überarb. u. aktual. Aufl.). Stuttgart: Schaeffer-Poeschel
Buchen, J., Horster, L., Pantel, G., & Rolff, H.-G. (Hrsg.). (2001). Personalführung und Schulentwicklung. Berlin: Raabe
Buhren, C. G, & Rolff, H.-G. (2002). Personalentwicklung in Schulen. Konzepte, Praxisbausteine, Methoden. Weinheim: Beltz
Dobbelstein, P., Groot-Wilken, B., & Koltermann, S. (2017). Einleitung. In dies. (Hrsg.), Referenzsysteme zur Unterstützung von Schulentwicklung (S. 9–11). Münster: Waxmann
Falk, S. (2007). Personalentwicklung, Wissensmanagement und Lernende Organisation in der Praxis. Zusammenhänge – Synergien – Gestaltungsempfehlungen. Mering: Rainer Hampp
Fend, H. (1986). Gute Schulen – schlechte Schulen. Die einzelne Schule als pädagogische Handlungseinheit. Die deutsche Schule, 78(3), 275–293
Holtappels, H. G. (2009). Qualitätsmodelle – Theorie und Konzeption. In I. Kamski, H. G. Holtappels & T. Schnetzer (Hrsg.), Qualität von Ganztagsschulen. Konzepte und Orientierungen für die Praxis (S. 11–25). Münster: Waxmann
Holtappels, H. G., & Voss, A. (2006). Organisationskultur und Lernkultur – Über den Zusammenhang von Schulorganisation und Unterrichtsgestaltung am Beispiel selbstständiger Schulen. In W. Bos, H. G. Holtappels, H. Pfeiffer, H.-G. Rolff & R. Schulz-Zander (Hrsg.), Jahrbuch der Schulentwicklung. Daten, Beispiele und Perspektiven (Bd. 14, S. 247–275). Weinheim: Juventa
Kasper, B. (2018). Schulqualität und Qualitätsrahmen. Die Einzelschule als Adressat bildungspolitischer Entscheidungen ohne Evidenzen? In K. Drossel & B. Eickelmann (Hrsg.), Does ‚What works‘ work? Bildungspolitik, Bildungsadministration und Bildungsforschung im Dialog (S. 207–222). Münster: Waxmann
Klemm, K. (2019). Seiten- und Quereinsteiger ̲ innen an Schulen in den 16 Bundesländern. Versuch einer Übersicht (Friedrich-Ebert-Stiftung). http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/15305.pdf Zugegriffen: 19. Juli 2021
KMK (2019). Standards für die Lehrerbildung 2019: Bildungswissenschaften, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004 i. d. F. vom 16.05.2019 https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
Meetz, F. (2007). Personalentwicklung als Element der Schulentwicklung. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
Oelkers, J. (2010). Personalentwicklung als Schlüssel zur Schulqualität. Vortrag auf dem 4. Bundeskongress Evangelische Schule am 24. September 2010 im Congress Center Erfurt https://www.ife.uzh.ch/dam/jcr:00000000-4a53-efcc-0000-0001680f965/DillingenSchulleitung.pdf
Qualitätskommission zur Schulqualität in Berlin (2020). Empfehlungen zur Steigerung der Qualität von Bildung und Unterricht in Berlin. Abschlussbericht der Expertenkommission. Berlin, 7. Oktober 2020 https://www.ipn.uni-kiel.de/en/the-ipn/news/Abschlussbericht.6.10.final.pdf
Rolff, H.-G. (2013). Schulentwicklung kompakt. Modelle, Instrumente, Perspektiven. Weinheim: Beltz
Schreyögg, A. (2003). Personalentwicklung – was ist das? In A. Schreyögg & H. Lehmeier (Hrsg.), Personalentwicklung in der Schule (S. 13–31). Bonn: Deutscher Psychologen Verl.
Steffens, U. (2017). Referenzsysteme zur Schulqualität – ein konzeptioneller Ansatz und seine Ausgestaltung. In P. Dobbelstein, B. Groot-Wilken & S. Koltermann (Hrsg.), Referenzsysteme zur Unterstützung von Schulentwicklung (S. 13–34). Münster: Waxmann
Steffens, U., & Bargel, T. (2016). Die Diskussion um Schulqualität – Anfänge, Wege und Erträge des „Arbeitskreises Qualität von Schule“. In dies. (Hrsg.), Schulqualität – Bilanz und Perspektiven (S. 309–347). Münster: Waxmann
Tarkian, J. M. (2020). Personalentwicklung im Kontext testbasierter Steuerung im Schulsystem. Eine qualitative Studie über Praktiken, Bedingungen und Barrieren schulleitungsseitiger Nutzung von VERA-Arbeiten zur evidenzbasierten Entwicklung des Lehrkräftehandelns (Diss. FU Berlin) https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/27915
Tarkian, J., Lankes, E.-M., & Thiel, F. (2019a). Externe Evaluation – Konzeption und Implementation in den 16 Ländern. In: F. Thiel et al. (Hrsg.), Datenbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung in Schulen. Eine Bestandsaufnahme in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (S. 105–183). Wiesbaden: Springer VS
Tarkian, J., Riecke-Reulecke, T. & Thiel, F. (2019b). Interne Evaluation – Konzeption und Implementation in den 16 Ländern. In F. Thiel et al. (Hrsg.), Datenbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung in Schulen. Eine Bestandsaufnahme in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (S. 185–229). Wiesbaden: Springer VS
Thiel, F. (2008a). Die Organisation der Bildung – eine Zumutung für die Profession? In Y. Ehrenspeck et al. (Hrsg.), Bildung – Angebot oder Zumutung? (S. 211-228). Wiesbaden: VS
Thiel, F. (2008b). Organisationssoziologische Vorarbeiten zu einer Theorie der Schulentwicklung. Journal für Schulentwicklung, 12(2), 31–39
Thiel, F., & Tarkian, J. (2019). Rahmenkonzepte zur Definition von Schulqualität in den 16 Ländern. In F. Thiel et al (Hrsg.), Datenbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung in Schulen. Eine Bestandsaufnahme in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (S. 15–39). Wiesbaden: Springer VS
Wimmer, B., & Altrichter, H. (2017). Heterogenität als Thema von Einzelschulentwicklung. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Grundlagentheoretische Beiträge und didaktische Reflexionen (S. 207–221). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Tarkian, J. (2022). Leitbilder schulischer Personalentwicklung in den Referenzrahmen zur Schulqualität der 16 Länder. In: Thiel, F., Schewe, C.M., Muslic, B., Lankes, EM., Maritzen, N., Riecke-Baulecke, T. (eds) Personalentwicklung in Schulen als Führungsaufgabe. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36925-5_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36925-5_3
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-36924-8
Online ISBN: 978-3-658-36925-5
eBook Packages: Education and Social Work (German Language)