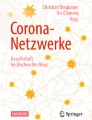Zusammenfassung
Seit Frühjahr 2020 hält das Coronavirus Japan und seine alternde Gesellschaft fest im Griff. Das Besondere an der Corona-Pandemie ist, dass sie innerhalb kürzester Zeit die gesamte Welt erfasste und sich global zeitgleich ausbreitete.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
1 Einleitung
Seit Frühjahr 2020 hält das Coronavirus Japan und seine alternde Gesellschaft fest im Griff. Das Besondere an der Corona-Pandemie ist, dass sie innerhalb kürzester Zeit die gesamte Welt erfasste und sich global zeitgleich ausbreitete. Aus diesem Grund werden in diesem Beitrag auch Vergleiche und Erwägungen auch aus einer globalen Perspektive angestellt.
Am 7. April 2020 wurde in Japan pandemiebedingt erstmals der Notstand für sieben Präfekturen (Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo und Fukuoka) ausgerufen und am 16. April auf das gesamte Land ausgeweitet, am 25. Mai dann aber landesweit wieder aufgehoben. Als Reaktion auf die zweite Pandemiewelle verhängte die Regierung am 6. Januar 2021 erneut einen einmonatigen Notstand. Da bis heute die Pandemie nicht unter Kontrolle ist, sind weitere Notstandsverkündungen nicht auszuschließen.
In diesem Beitrag geht es um die Herausforderungen, denen sich die alternde Gesellschaft Japans in der derzeit noch andauernden Corona-Pandemie gegenübersieht. Zunächst wird aus einer Makroperspektive anhand der derzeit verfügbaren Studien die Situation in ganz Japan betrachtet. Dabei kristallisieren sich zwei Arten von Problemen heraus: Corona-spezifische Probleme und solche, deren Ursachen tiefer liegen und die durch die Pandemie deutlicher zutage getreten sind. Neben nationalen Entwicklungen werden auch Unterschiede zwischen Großstadtregionen und ländlichen Gebieten sowie zwischen dicht und dünn besiedelten Regionen thematisiert.
Die im zweiten Teil des Beitrags angewandte Mikroperspektive richtet den Blick auf die lokale Ebene. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Präfektur Tottori und insbesondere der Gemeinde Chizu, in der der Verfasser seit mehr als 30 Jahren Feldforschung betreibt. Chizu liegt in einer „entvölkerten“ Region (Kaso chiikiFootnote 1) mit einem hohen Altenanteil. Die Corona-Inzidenz auf Präfekturebene ist bemerkenswert niedrig und bisher traten in Chizu selbst noch keine Covid-Fälle auf (Stand: Ende Februar 2021). Chizu macht sich die niedrige Bevölkerungsdichte zunutze und setzt auch in Zeiten von Corona auf eine „SMART Governance“, d. h. einen „flexiblen und adaptiven Umgang“ mit Herausforderungen (siehe unten Abschn. 3.3). Hierauf wird an anderer Stelle noch genauer eingegangen werden. Die am Beispiel des Governancemodells von Chizu erkennbare Bewältigungskapazität stärkt die kommunale Selbstverwaltung. Sie ist unerlässlich für eine nachhaltige Kommunalpolitik.
2 Die Corona-Pandemie im Kontext einer alternden Gesellschaft und unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede
2.1 Zusammenhang zwischen Alterung, Bevölkerungsrückgang und Finanzkraft
Untersuchungen des Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT o. J.) und des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Kommunikation (MIC o. J.) belegen eine hohe positive Korrelation zwischen dem Bevölkerungsrückgang und dem Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre auf Gemeindeebene bzw. eine hohe negative Korrelation zwischen Bevölkerungsrückgang und dem Anteil junger Menschen. Die Studie des MIC zeigt außerdem, dass zwischen Bevölkerungsrückgang und Bevölkerungsdichte kein Zusammenhang existiert. Unter den Gebietskörperschaften mit extrem geringer Bevölkerungsdichte (≤ 100 Einwohner/km2) gibt es eine breite Streuung – von Kommunen mit starkem bis zu geringem Bevölkerungsrückgang. Zwischen Bevölkerungsrückgang und Finanzkraft ist dagegen eine deutlich negative Korrelation erkennbar. Regionen mit einem hohen Anteil an Erwerbstätigen im Primärsektor (Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft) verzeichnen tendenziell einen stärkeren Bevölkerungsrückgang. Zwischen der Höhe des zu versteuernden Einkommens und der Bevölkerungsentwicklung besteht hingegen kein statistisch signifikanter Zusammenhang. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Gemeinden mit starkem Bevölkerungsrückgang tendenziell einen hohen Anteil an älteren bzw. einen niedrigen Anteil an jungen Menschen aufweisen und finanziell schwach aufgestellt sind. Diese Zusammenhänge treffen insbesondere auf „entvölkerte Regionen“ (Kaso chiiki) zu.
Die Alterung betrifft nicht nur Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte und stark rückläufigen Bevölkerungszahlen. Sie schreitet auch in Metropolregionen und regionalen Kernstädten fort, in denen die Bevölkerungsdichte hoch ist und die Bevölkerungszahlen steigen, stabil sind oder nur allmählich abnehmen. Untersuchungen von Morita et al. (2012) in der Präfektur Aichi haben gezeigt, dass gerade in Ballungsgebieten die hohe Bevölkerungszahl dazu führen kann, dass das Problem der Alterung unterschätzt wird, wenn als Indikator nur der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung herangezogen wird. Mit Hilfe der Kennziffer „Senioren-Bevölkerungsdichte“ veranschaulichten Morita et al. den Unterschied zwischen der Alterung in urbanen Gebieten, in denen die Bevölkerungsdichte in Bezug auf ältere Menschen hoch ist, und der Alterung in ländlichen Gebieten, die durch einen hohen Seniorenanteil gekennzeichnet ist.
2.2 Corona-Maßnahmen im internationalen Vergleich
Mit dem Ziel „Daten aus dem In- und Ausland zu analysieren, um das neue Coronavirus genauer zu erfassen und ein auf wissenschaftlichen Grundlagen, d. h. auf Evidenz basierendes Verständnis des Coronavirus zu entwickeln“, führte Mitsuyoshi Urashima (2021), Experte für medizinische Statistik, auf Grundlage der verfügbaren Daten (Stand Februar 2021) verschiedene Analysen durch. Seine Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
-
Erkranken ältere Menschen, insbesondere Personen ab 65 Jahren, an Covid-19, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt oder gar zum Tode führt. Auch in Japan sind 95 % der Covid-19 Todesfälle 60 Jahre oder älter, deshalb werden ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen bei den Impfkampagnen mit hoher Priorität behandelt.
-
Alle Länder weisen eine starke Korrelation zwischen durchschnittlicher Lebenserwartung und Inzidenz sowie zwischen durchschnittlicher Lebenserwartung und Sterberate auf.
-
Obgleich Japan im internationalen Vergleich den bei weitem höchsten Anteil an über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung aufweist, ist die Sterberate verhältnismäßig niedrig geblieben.
-
Japan verfügt über eine Volkskrankenversicherung, die allen Bevölkerungsschichten Zugang zu medizinischer Versorgung bietet, wodurch Covid-bedingte Lungenerkrankungen umfassender und schneller behandelt werden können.
-
In Europa und den USA, wo sich Covid-19 früher ausbreitete als in anderen Ländern, traten viele Todesfälle unter den Bewohnern von Senioreneinrichtungen auf. Der für Europa zuständige Experte der Weltgesundheitsorganisation WHO wies auf einer Pressekonferenz vom 23. April 2020 beispielsweise darauf hin, dass „Schätzungen der einzelnen Länder zufolge fast die Hälfte der Menschen, die in Europa an Covid-19 gestorben sind, Bewohner von Pflegeeinrichtungen waren“. Im Gegensatz dazu lag der Anteil älterer Menschen in Senioreneinrichtungen an den Todesfällen in Japan bei lediglich 15 % (NHK).
2.3 Auswirkungen der Notstandsverordnungen in Japan
Zu den Auswirkungen der Notstandsverordnungen gibt es verschiedene Untersuchungen, die im Folgenden ausschnittweise zusammengefasst werden (JMA Research Institute, 2020a, b; NHK, 2020a, b). Die durch die Notstandsverordnung bedingte Isolation wirkte sich in mehrerer Hinsicht negativ auf den physischen und den psychischen Zustand älterer Menschen aus (JMA Research Institute, 2020b).
-
Weniger Interaktionsmöglichkeiten: Eine zunehmende Zahl älterer Menschen fühlt sich isoliert, da die Betroffenen weniger Gelegenheit haben, andere Menschen zu treffen und sich auszutauschen.
-
Lustlosigkeit: Die Menschen können sich zu nichts aufraffen oder wissen nicht, wie sie Dinge angehen sollen.
-
Zunehmende Tendenz zum Rückzug aus der Gesellschaft (Hikikomori): Die Menschen haben weniger Gelegenheit, ihre Wohnung zu verlassen, was die Tendenz zu InaktivitätFootnote 2 und GebrechlichkeitFootnote 3 verstärkt.
-
Verminderte ADL-Fähigkeiten Activities of daily livingFootnote 4): Bei immer mehr älteren Menschen ist eine Beeinträchtigung der Gehfunktion und eine Verschlechterung der Alltags-Fitnesstests festzustellen.
-
Nachlassen der kognitiven Funktionen: Die Zahl der Fälle steigt, in denen die kognitiven Funktionen aufgrund verminderter Kontaktmöglichkeiten abnehmen.
-
Erhöhte psychische Belastung: Mehr Menschen verspüren Angst und/oder tendieren zunehmend zu Depressionen.
Zu Infektionen in japanischen Senioreneinrichtungen konstatierte Professor Toshihisa Hayasaka von der Toyo University, Experte für Altenpflege und Senioreneinrichtungen in einem Interview mit NHK (2020a), dass „die Sterberate bereits im derzeitigen Stadium als sehr hoch anzusehen ist. Angesichts des hohen Anteils von Bewohnern von Senioreneinrichtungen an den Todesopfern in Europa und den USA ist jedoch zu befürchten, dass die Zahl der Infizierten und der Todesfälle in Senioreneinrichtungen auch in Japan weiter steigen wird.“
Im November 2020 lag der Anteil der Infizierten im Alter von 60 + in der Präfektur Tokyo bei 17,1 % und war damit mehr als doppelt so hoch wie zum Zeitpunkt der zweiten Welle im Juli (NHK, 2020b). Eine entsprechende Tendenz ist auch in der Präfektur Osaka zu beobachten: hier stieg der Anteil der über 60-jährigen Infizierten von 9,5 % im Juli auf 25,8 % im November 2020.
Trotz zunehmender Ausbreitung des Coronavirus wurden bisher keine ausreichenden Maßnahmen zur Unterstützung von Pflegeeinrichtungen getroffen. Zur Vermeidung eines Zusammenbruchs der Versorgung müssen hier verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. So sollten Staat und Kommunen ein Mindestmaß an Schutzausrüstung wie Masken, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung bereitstellen, um eine Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Mitarbeitern und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sollten frühzeitig PCR-Tests angeboten werden, und es sollte rasch über Maßnahmen zum Aufbau eines Backupsystems nachgedacht werden, damit eine mögliche Masseninfektion in einer Einrichtung keine Auswirkungen auf die Qualität der Pflege hat. Zur Vermeidung eines Pflegekollaps müssen Mechanismen entwickelt werden, um die Pflegeleistungen in einem länger andauerndem „Leben mit dem Coronavirus“ langfristig aufrechterhalten zu können.
2.4 Corona-Cluster in einer geriatrischen Pflegeeinrichtung
Die Präfektur Toyama weist die dritthöchste Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) in Japan auf. Mehr als ein Viertel der knapp 220 Covid-19-Fälle (Stand 17. November 2020) waren auf einen Corona-Ausbruch in einer geriatrischen Pflegeeinrichtung in der Stadt Toyama zurückzuführen. Dabei infizierten sich nicht nur Bewohner sondern auch Beschäftigte der Einrichtung, was beinahe zu einem „Zusammenbruch der Pflegeversorgung“ geführt hätte. Im „Toyama Rehabilitation Home“, einer geriatrischen Pflegeeinrichtung, war am 17.4.2020 erstmals eine Corona-Infektion bestätigt worden, die sich in der Folge weiter ausbreitete. Insgesamt infizierten sich 58 Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung. Acht der infizierten Heimbewohner starben.
Die Präfektur entsandte ein medizinisches Team in die Einrichtung, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten und die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Professor Seiji Yamashiro vom Toyama University Hospital war Mitglied des Teams und äußerte sich anschließend in einem Telefoninterview mit dem Sender NHK (Auszug aus NHK, 2020b).
Da sich auch einige Pfleger und Krankenpfleger der Einrichtung infiziert hatten, mussten sich die verbliebenen ca. fünf Mitarbeiter um die mehr als 40 Bewohner der Einrichtung kümmern. In diesem Zustand einer extremen personellen Unterbesetzung war eine ausreichende pflegerische Versorgung nicht mehr gewährleistet. Die Einrichtung stand kurz vor einem „Pflegekollaps“, der unweigerlich eingetreten wäre, wenn sich nur noch ein weiterer Mitarbeiter infiziert hätte. Um den „Pflegekollaps“ zu verhindern, wendete sich die Stadt Toyama an das Gremium der Altenpflegeeinrichtungen der Präfektur und bat um die Entsendung von Pflegern. Am 2. Mai 2020 wurden daraufhin insgesamt sechs Alten- und Krankenpfleger entsandt, die u. a. die Körperpflege der Bewohner übernahmen und damit zu einer allmählichen Verbesserung der Versorgungslage in der Einrichtung beitrugen.
2.5 Strategien für Pflege- und medizinische Einrichtungen
Der Fall von Toyama ist nur ein Beispiel von vielen. Auch Initiativen in anderen Regionen haben gezeigt, dass akute Krisen durch flexible Maßnahmen überwunden werden können: So wurden z. B. Gremien (councils) eingerichtet, in denen sich die Akteure untereinander abstimmten, um im Fall einer Corona-bedingten Unterbesetzung Personal in die betroffenen Einrichtungen zu schicken. Die Arbeit der Pflegedienste ist vielfältig, es ist jedoch möglich, die Tätigkeiten aufzuteilen. So gab es zahlreiche Fälle, in denen Tätigkeiten, die vergleichsweise wenig Erfahrung erfordern, oder allgemeinere Dienstleistungen, die nicht auf Pflegeeinrichtungen beschränkt sind (z. B. Reinigen und Kochen) ausgelagert wurden, wodurch ein Zusammenbruch der pflegerischen Versorgung vermieden werden konnte.
Ein Beispiel für die Kooperation und Koordination medizinischer Einrichtungen untereinander ist das sogenannte „Matsumoto-Modell“, das große Aufmerksamkeit erfuhr. Am 8. Februar 2021 berichtete die Zeitung Tokyo Shimbun: „Als Maßnahme gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus wurde am 8. Februar die Notstandserklärung in zehn Präfekturen um etwa einen Monat verlängert. Im Hinblick auf das Ziel der Aufhebung des Notstands wurde der Fokus daraufhin auf die Sicherstellung der Kapazität an Intensivbetten in den Krankenhäusern gelegt. In diesem Zusammenhang hat der Ansatz des medizinischen Versorgungsgebiets Matsumoto rund um die Stadt Matsumoto in der Präfektur Nagano landesweit Beachtung gefunden. Bei dem sogenannten ‚Matsumoto-Modell‘ bilden öffentliche und private medizinische Einrichtungen ein Team und die Patienten werden entsprechend dem Schweregrad ihrer Krankheit auf die Einrichtungen verteilt, um so den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung in der Region zu verhindern“ (Tokyo Shimbun, 2021).
Auch in der Präfektur Tottori wurde eine interessante Initiative gestartet (Präfektur Tottori, 2020): Im Rahmen einer „Vereinbarung über gegenseitige Unterstützung im Fall eines Corona-Ausbruchs“ verständigten sich die beteiligten Akteure darauf, sich gegenseitig zu helfen, falls es in einer sozialen Einrichtung der Präfektur (Einrichtungen für Senioren, Menschen mit Behinderungen oder Kinder) aufgrund eines Corona-Ausbruchs zu einem Versorgungsengpass kommen sollte. Im September 2020 wurde die Vereinbarung von folgenden Einrichtungen auf Präfekturebene unterzeichnet: Gremium der Betreiber sozialer Einrichtungen (keikyo), Verband geriatrischer Gesundheitseinrichtungen (Association of Geriatric Health Services Facilities), Verband der Behindertenhilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Tottori Association on Intellectual Disability) und Rat der stationären Einrichtungen der Kinderhilfe. Tottori ist insofern bemerkenswert, als diese flexible Lösung unter der starken Führung des Gouverneurs umgesetzt wurde. Hierauf wird weiter unten nochmals die Rede sein.
Die Beispiele zeigen, dass für alle Dienste – ob im Bereich der Pflege oder der Medizin – die aufgrund der Corona-Pandemie von einem Versorgungsnotstand bedroht sind, dringend ein „Notfallmodus“ eingerichtet werden muss, der eine Umverteilung bzw. Kombination der verfügbaren Ressourcen wie „Personal“, „Material“, „Informationen“ und „Geld“ regelt.
2.6 Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten
Ausgehend von den Letalitätsraten des Coronavirus in den Präfekturen analysierte Mitsuyoshi Urashima (2021) statistisch Zusammenhänge zwischen folgenden Variablen: Positivrate bei PCR-Tests (Anzahl der positiv getesteten Personen im Verhältnis zur Zahl der durchgeführten PCR-Tests), Zahl der Beratungszentren für Rückkehrer aus dem Ausland und Kontaktpersonen, Zahl der Ambulanzen für Rückkehrer und Kontaktpersonen (Anzahl der Allgemeinkrankenhäuser), Zahl der Großkrankenhäuser ab 500 Betten, Zahl der medizinischen Pflegeeinrichtungen (Designated Medical Long-Term Care Sanatorium), Anzahl der Notaufnahmen, Zahl der Krankenhausbetten, Zahl der Intensivbetten, Rettungstransportzeiten, Anzahl der Rettungssanitäter, Zahl der Gesundheitsämter, Zahl der medical control-Systeme, Bevölkerungsdichte, Altenquotient, Prozentsatz der Studienanfänger eines Jahrgangs, und Einkommen.Footnote 5 Seine statistische Analyse lieferte folgende Ergebnisse:
-
Zwischen Bevölkerungsdichte und Corona-Infektionen wurde ein klarer positiver Zusammenhang festgestellt.
-
Je höher der Anteil der Corona-positiv getesteten Personen war, desto höher war die Sterberate. Die höchsten Positivraten verzeichneten die Präfekturen Tokyo mit 30 %, Ishikawa und Toyama mit jeweils ca. 10 %, während in den 14 Präfekturen ohne Todesfälle (Iwate, Miyagi, Akita, Fukushima, Niigata, Nagano, Yamanashi, Tochigi, Okayama, Shimane, Kagawa, Yamaguchi, Saga, Kagoshima) die Positivrate durchweg unter 4 % lag. Die Präfektur Tottori meldete zwei Todesfälle und rangiert damit direkt hinter diesen 14 Präfekturen.
-
Die Behauptung, dass die niedrige Sterberate künstlich dadurch erzeugt wurde, dass man weniger PCR-Tests durchführte, trifft so nicht zu. Es wurden ausreichend PCR-Tests vorgenommen, um infizierte Personen zu identifizieren und konsequent zu isolieren und deshalb konnte die Zahl der Todesfälle auf null gehalten werden. Die Zahlen beweisen, dass die von den 14 Präfekturen ergriffenen Maßnahmen hervorragend gegriffen haben.
-
Je mehr Notaufnahmen pro Million Einwohner vorhanden waren, desto geringer war die Sterberate. In Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie kann die Zahl der Notaufnahmen schicksalsentscheidend sein.
Ein Team um Professor Hirata vom Nagoya Institute of Technology analysierte für jede Präfektur die Daten zum Anstieg und Rückgang der Covid-19-Infektionen und stellten dabei fest, dass Bevölkerungsdichte und Witterungsverhältnisse Einfluss auf die Dauer des Anstiegs bzw. Rückgangs der Fallzahlen sowie auf die Zahl der Infizierten und Toten haben. Die Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen (Hirata, 2020):
-
Die Dauer der Ausbreitung und des Abklingens des Coronavirus in den jeweiligen Präfekturen wird von der Bevölkerungsdichte, den Temperaturen und der absoluten Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Die Präfekturen in und um die großen Ballungsräume Tokyo, Osaka oder Aichi weisen tendenziell längere Phasen des Ansteigens bzw. Abklingens der Infektionswellen auf.
-
Auch die Zahl der Infizierten und Todesfälle in den Präfekturen korrelieren jeweils mit der Bevölkerungsdichte, der Temperatur und der absoluten Luftfeuchtigkeit. Bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sinken die Zahlen leicht.
2.7 Auswirkungen auf das Leben älterer Menschen und der Erwerbsgeneration
Im Folgenden werden die – Stand Februar 2021 erkennbaren – Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Leben der älteren Menschen und das der erwerbstätigen Generation zusammengefasst. Ältere Menschen in den Metropolregionen und Ballungsgebieten waren von der Corona-Pandemie deutlich stärker betroffen als in den dünn besiedelten Gebieten. Dünn besiedelte Regionen sind sowohl im Hinblick auf die Zahl der Infizierten, der Todesfälle, die Geschwindigkeit der Ausbreitung und das Abklingen der Infektionswellen als auch hinsichtlich des Erhalts der Qualität von Dienstleistungen in Pflegeeinrichtungen bisher gut durch die Pandemie gekommen. Allerdings gilt auch zu beachten, dass in einigen regionalen Kernstädten und Präfekturhauptstädten teilweise Cluster auftraten, welche die medizinischen Ressourcen in medizinischen und Pflege-Einrichtungen in eine Notlage brachten.
Im Gegensatz zu den bevölkerungsarmen Gebieten hat Covid-19 das Alltagsleben im Großraum Tokyo und anderen Metropolregionen in erheblichem Maße beeinträchtigt. Während sich das Coronavirus ausbreitete, war es nicht einfach, die „3 Cs“ zu meiden.Footnote 6 Fernpendler waren der schwierigen Situation ausgesetzt, in den Zügen tagtäglich unter Ansteckungsgefahr zur Arbeit pendeln zu müssen. Darüber hinaus wurde die Bevölkerung ständig angehalten, auf das Essen, Trinken und sonstige Vergnügungen in den belebten Stadtvierteln zu verzichten, also gerade auf die Dinge, die die Attraktivität der Großstadtregionen ausmachen.
Obwohl viele ältere Menschen in den Großstädten und den dicht besiedelten Regionen sich daranhielten „zuhause zu bleiben (stay home)“, gab es dennoch eine Reihe von Fälle, in denen sich ältere Menschen beim Einkaufen in der Nachbarschaft oder bei Treffen in sozialen Einrichtungen infizierten, was zu Clustern führte, wodurch die Versorgung gefährdet war.
Die Corona-Krise hat die Schwachstellen einer zunehmend dichteren Besiedlung und der „Konzentration der urbanen Funktionen“, insbesondere in den Großstadtregionen, ans Licht gebracht. Die Krise veränderte außerdem die Einstellung gegenüber Telearbeit und veranlasste Veränderungen in der Arbeitsorganisation. In Unternehmen, Universitäten und Behörden wurde versuchsweise Telearbeit eingeführt. All dies hatte zur Folge, dass der Einwanderungssaldo Tokyos zwischenzeitlich negativ war und im Jahresdurchschnitt sehr stark zurückging. Allerdings profitierten davon vor allem die Nachbarpräfekturen in der Kantô-Region und nicht die entlegenen Regionen (Nagai, 2021).
3 Kommunale Selbstverwaltung auf dem Prüfstand – das Beispiel der Gemeinde Chizu
Wie oben bereits erwähnt, kann man der Präfektur Tottori insgesamt bescheinigen, dass sie sich im Vergleich zu anderen Präfekturen gut geschlagen hat. Gründe hierfür dürften u. a. die niedrige Bevölkerungszahl und die dünne Besiedlung sein. Ende Januar 2021 lebten 553.096 Menschen in der Präfektur, die Bevölkerungsdichte lag bei 157,7 Einwohnern/km2. Die Corona-Infektionszahlen in der Präfektur Tottori sind im Landesvergleich durchweg niedrig geblieben. Man kann für Tottori konstatieren, dass die rechtzeitig ergriffenen Maßnahmen in der ersten und zweiten Pandemiewelle Wirkung gezeigt haben. Unter der Federführung des Gouverneurs wurde auf Präfekturebene eine flexible und adaptive Governance (SMART Governance) zielführend implementiert.Footnote 7
Die Gemeinde Chizu befindet sich am südlichen Rand im Osten der Präfektur Tottori. Der Ort hat 6.670 Einwohner (Stand: Mai 2021), der Seniorenanteil (Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung) liegt bei 43,1 %. Stand Ende Januar 2021 wurden in Chizu glücklicherweise noch keine Corona-Infektionen festgestellt, daher herrscht auch keine Notlage in den medizinischen Einrichtungen, die für die Behandlung möglicher Infizierter zuständig wären. Auch in den Pflegeheimen traten bislang keine Corona-Cluster auf. Dennoch hat die Pandemie selbstverständlich beträchtliche Auswirkungen auf das Leben und die Arbeit der Menschen sowie auf die lokalen Geschäftsaktivitäten. So wurde eine Vielzahl der jährlich stattfindenden Veranstaltungen abgesagt. Im Folgenden werden einige beachtenswerte Aktivitäten und Projekte vorgestellt, die der Verfasser aus erster Hand von den Einwohnern Chizus erhielt. Die Ansätze veranschaulichen, wie die Region die Corona-Situation als Chance genutzt hat.
3.1 Neue kleinformatige SDG-orientierte Geschäftsmodelle
Die Café-Bäckerei TalmaryFootnote 8 in Chizu ist ein Paradebeispiel für ein kleines SDG-orientiertes neues Geschäftsformat. Die Management-Philosophie des Talmary lautet: „Ein Café mit Brot und Bier aus wilder Hefe“. Das Talmary ist ein Beispiel, wie die Corona-Pandemie als Chance genutzt werden kann. Im Folgenden werden einige Ausschnitte aus einem Interview mit dem Inhaber, Herrn Itaru Watanabe, wiedergegeben.Footnote 9
„Zu Beginn der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Kunden aus der ganzen Präfektur Tottori und den umliegenden Regionen, die unser Café besuchten. Ein Grund war, dass es in unserer Präfektur keine Corona-Infektionen gab. Wir spürten, dass dieser Zulauf an Kunden zu Spannungen mit den Anwohnern führte, und dachten darüber nach, den Betrieb freiwillig für eine Weile einzustellen.
Durch die Ausrufung des landesweiten Notstands im Mai 2020 waren wir gezwungen, unser auf Kundenverkehr ausgerichtetes Geschäftsmodell zu revidieren. Wir hatten ursprünglich schon einmal daran gedacht, den Fokus auf einen festen Kundenkreis zu richten, und haben daraufhin einen Fonds aufgelegt, in den die Kunden das Geld für ihre Bestellungen für ein Jahr im Voraus einzahlen. Wir haben die Zahl der Anleger begrenzt und im Nu den anvisierten Rahmen erreicht, so dass das nötige Betriebskapital vorerst sichergestellt war.
Um die Nachfrage zu bedienen, die durch das Corona-bedingte „Cocooning“ (Rückzug ins eigene Heim) anstieg, haben wir einen Lieferdienst beauftragt und unsere Produkte in alle Teile des Landes ausgeliefert. Wir haben den gewonnenen zeitlichen Spielraum dazu genutzt, unsere Managementstrategie weiterzuentwickeln. Da das jetzige Café weit vom Ortszentrum entfernt liegt, beschlossen wir, ein weiteres Geschäft im Ortskern an einem alten historischen Verkehrsweg zu eröffnen. Wir sind derzeit dabei, ein altes traditionelles Kaufmannshaus umzubauen und die Eröffnung des neuen Ladens vorzubereiten.
Der neue Laden ist als Mehrzweckeinrichtung gedacht und soll vielseitig genutzt werden: als lokaler Treffpunkt, als Unterkunft für Langzeitgäste oder als Ort für kulturelle und kreative Aktivitäten von Künstlern und anderen Besuchern von außerhalb. Wir wollen ihn auch einer lokalen Gruppe zur Verfügung stellen, die sich für eine neue Form der Ortsgestaltung engagiert.
Als wir die Mitarbeiterstellen für das neue Geschäft ausgeschrieben haben, bewarben sich viele sehr talentierte und gut ausgebildete junge Leute – nicht nur aus der benachbarten Kinki-Region, sondern auch von weit darüber hinaus. Unser Ziel ist es, auch diesen neuen Mitarbeitern, die wir aus den Bewerbern sorgfältig ausgewählt haben, die aktive Teilhabe am Management und dem Betrieb zu ermöglichen.“
Die Grundlagen für diese neuen Ansätze wurden bereits früher gelegt. Durch die „Zero-to-One Community Vitalization“-Bewegung entwickelte sich Chizu zu einer Gemeinde, die anderen Regionen gegenüber offen ist.Footnote 10 Der Verfasser dieses Beitrags befasst sich im Rahmen seiner Feldstudien seit vielen Jahren mit dieser Entwicklung. Die Entstehung sowie Zielsetzung und Wirkungen des „Zero-to-One Community Vitalization Movement“ werden in Okada et al. (2000) und Okada et al. (2015, 2018) erläutert.
3.2 Unterstützung für ältere Menschen
Die Initiative „Chizu-chō-Mori-no-Mini-dei“ (im Folgenden „Mini-Day“) hat während der Corona-Pandemie die Bewältigungskompetenz der Gemeinde auf besondere Weise zur Geltung gebracht.Footnote 11 Man hat mit viel Einfallsreichtum einen Weg gefunden, trotz der Restriktionen (Vermeidung der „3 Cs“) eine funktionierende Unterstützung für ältere Menschen sicherzustellen. So wurde beispielsweise im Ortsteil Yamagata eine nicht mehr genutzte Kindertagesstätte in einen dauerhaften Treffpunkt für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und andere Hilfsbedürftige umgewandelt, der es diesen ermöglicht, den Kontakt zur lokalen Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Mit Unterstützung der Anwohner wird zweimal pro Woche eine Mini-Tagespflege („Mini-Day“) angeboten. Ehrenamtliche Helfer holen die Teilnehmer von zu Hause ab und bringen sie wieder nach Hause, betreuen sie tagsüber in dem Treffpunkt, arrangieren ein Mittagessen, das gemeinsam eingenommen wird, oder besuchen ältere Menschen zu Hause und erkundigen sich nach deren Wohlbefinden. Das Besondere daran ist die organisatorische Aufstellung. Die Initiative wird im Wesentlichen vom „Zentrum für Bildung Yamagata“ (Yamagata kyōiku sentā)Footnote 12 des Förderrats des Ortsteils Yamagata (Yamagata-chiku shinkō kyōgikai) getragen, das den Lenkungsrat der Mini-Day-Tagespflege („mori-no-mini-dei-unei-kyōgikai“) bildet. Umgesetzt werden die Aktivitäten unter Beteiligung der Abteilung für Soziales der Gemeinde Chizu, des integrierten kommunalen Unterstützungszentrums (chiiki hōkatsu shien sentā) und der sozialen Wohlfahrtskommissionen (shakai fukushi kyōgikai) der Gemeinde und des Bezirks.
Genutzt wird der Treffpunkt von fünf älteren Menschen im Alter von 80 Jahren und älter, vier davon sind als pflegebedürftig eingestuft. Drei der vier Pflegebedürftigen nehmen keine Pflegedienste aus der Pflegeversicherung in Anspruch, sondern nutzen nur die Mini-Day-Tagespflege.
Das Konzept sowie die Umsetzung des „Mini-Day“ geht wie gesagt auf die Initiative des Ortsteils Yamagata zurück. Im Rahmen einer lokalen Initiative der „Zero-to-One Community Vitalization“-Bewegung wurde der Fokus darauf gelegt, einen Ort der Begegnung und Pflegedienste in der lokalen, vertrauten Umgebung anzubieten, die von den Anwohnern getragen werden. Ähnliche Ansätze gibt es – mit geringfügigen Unterschieden – auch in anderen Bezirken. Im Ortsteil Nagi wird beispielsweise ein Raum im japanischen Stil mit Tatamimatten im Gebäude des Nagi-Bahnhofs an der Inbi-Linie der Japan Railways als Treffpunkt genutzt.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Entwicklung verdient ebenfalls Erwähnung. Noch vor der „Zero-to-One Community Vitalization“-Bewegung hatte sich in Chizu bereits eine lokale Vorläuferinitiative herausgebildet – das sogenannte Himawari (Sonnenblumen)-System (Nihon-Chiiki to Kagaku no deaikan (Hrsg.) 1999; Okada, 2017). Es entstand aus der Idee heraus, das Netzwerk der Post zu nutzen, welches sich über das gesamte Land und alle Regionen erstreckt. Die Postboten übernehmen dabei einen Kommunikationsservice, indem sie auf ihren Zustellrouten alleinlebende ältere Menschen der Region besuchen, sich nach ihrem Befinden erkundigen und Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs zustellen. Die Initiative basierte auf dem Vorschlag einer Gruppe zur regionalen Revitalisierung unter Federführung des Leiters des lokalen Postamts. Obwohl es diverse Widerstände gab, dass dies z. B. mit dem traditionellen Postsystem nicht vereinbar sei, startete man schließlich doch einen Versuch. Dabei stellte sich heraus, dass der Ansatz dazu beitragen kann, nicht nur die sich im Kontext einer alternden Gesellschaft wandelnden Wünsche und Bedarfe auf lokaler Ebene zu erkennen, sondern gleichzeitig auch das Postwesen innovativ weiterzuentwickeln. Im Zuge der späteren nationalen Postreform wurde dieser Service in den Katalog der neuen landesweit angebotenen Postdienstleistungen aufgenommen. Die Erfahrungen mit diesem Projekt, das von der lokalen Bevölkerung getragen wurde und die Entwicklungen der alternden Gesellschaft bereits vorwegnahm, trugen mit dazu bei, dass die Region im Umgang mit der Corona-Pandemie ihre Anpassungsfähigkeit so gut unter Beweis stellen konnte.
Letztendlich hat man den Wert der in der Region bzw. im Ortsteil verbliebenen öffentlichen und halb-öffentlichen Einrichtungen wiederentdeckt und eine Strategie entwickelt, diese Einrichtungen zeitgemäß wieder zu nutzen. Dies spiegelt exakt den Grundgedanken der „Zero-to-One Community Vitalization“-Bewegung wider und setzt ihn in die Praxis um.
3.3 SMART Governance
Die Corona-Pandemie verursachte eine schwerwiegende Krise mit sehr schlimmen Auswirkungen. Man sollte sie nicht einfach als Einmalereignis abtun. Tatsächlich wurden und werden viele Gemeinden seit Jahren von unterschiedlichsten Naturkatastrophen heimgesucht, aber auch von großen längerfristigen Herausforderungen wie dem demographischen Wandel und dem Klimawandel. Der Verfasser dieses Beitrags schlägt für diese gravierenden Einwirkungen zusammenfassend den Begriff „persistent disruptive stressors (PDSs)“ vor (Okada et al., 2018; Weber, 2020). Die äußeren Stressfaktoren reagieren auf innere Stressoren, verbinden sich und verschmelzen mitunter so miteinander, dass eine Unterscheidung zwischen „innen“ und „außen“ nicht mehr möglich ist. Gemeinsam erschüttern sie die Struktur und das Wesen von Gemeinden, teilweise bis zu einem Punkt, an dem diese dann unvermeidlich vom Niedergang bedroht sind.
Betrachtet man diese Stressfaktoren über eine Zeitachse von einer oder mehreren Dekaden und setzt seine Vorstellungskraft ein, um mögliche künftige Stressoren mit in den Blick zu nehmen, dann kann man aus der Gesamtschau Ansatzpunkte für eine „nachhaltige lokale Governance“ ableiten. „Aus dieser Problemsicht heraus entstand das Konzept von SMART-Governance under PDSs“. SMART steht für S = small and solid, M = modest and multiple, A = anticipatory and adaptive, R = risk-concerned and responsive, T = transformative (Okada et al., 2018). Es handelt sich dabei um einen flexiblen, adaptiven Ansatz, den der Verfasser aus den Ergebnissen langjähriger Feldforschung und theoretischen Überlegungen abgeleitet hat.
Natürlich darf die Transformation nicht Selbstzweck sein. Viele Regionen verfügen über besondere Eigenschaften, die nicht verloren gehen dürfen bzw. als Identität weiterhin bewahrt werden sollten. Darauf aufbauend müssen die substanziellen Probleme entschlossen angegangen werden. Dabei bedarf es nicht nur Strategien und Maßnahmen übergeordneter Verwaltungsebenen, sondern gerade auch des kollektiven Handlungswillens und der Eigeninitiative der lokalen Bevölkerung. Dafür gilt es, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Hierzu zählt insbesondere die Entwicklung lokaler Kompetenzen. Auf diese Weise kann die Bewältigungskapazität lokaler Selbstverwaltung strategisch verbessert werden, was der Resilienz in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie zugutekommt.
4 Fazit
Der Fokus dieses Beitrags lag auf der alternden Gesellschaft in Japan in Zeiten der Corona-Pandemie. Dabei wurde untersucht, welchen Herausforderungen die Menschen – insbesondere ältere Menschen – in den einzelnen Regionen ausgesetzt sind. Zunächst wurde die Situation in Japan insgesamt betrachtet und unter Einbeziehung internationaler Vergleiche eine Beobachtung aus der Makroperspektive vorgenommen. Die dabei sichtbar gewordenen Probleme lassen sich unterscheiden in Corona-spezifische Probleme und grundlegendere Herausforderungen, die im Zuge der Corona-Pandemie zutage getreten sind. Die Probleme sind nicht landesweit einheitlich, sondern teilweise auch auf die Besonderheiten der jeweiligen Region zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurde das Augenmerk auch auf die Unterschiede zwischen Metropolregionen und ländlichen Gebieten sowie auf die Gegenüberstellung von dicht und dünn besiedelten Regionen gerichtet. Dabei wurde ein klarer Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte und der Zahl der Corona-Infektionen festgestellt. Folglich waren dünner besiedelte Regionen und Regionen mit niedrigen Bevölkerungszahlen, die in der Regel einen höheren Anteil an älteren Menschen aufweisen, weniger von der Corona-Pandemie betroffen. In einigen Regionen wurde auf Engpässe in der medizinischen und pflegerischen Versorgung durch die kurzfristige Umverteilung von Personal zwischen Einrichtungen reagiert. Insgesamt machte die Corona-Pandemie die negativen Aspekte einer hohen Bevölkerungsdichte und einer Konzentration urbaner Funktionen in Ballungszentren deutlich. Infolge der von Unternehmen, Universitäten und auch in der Verwaltung pandemiebedingt vermehrt eingesetzten Telearbeit zeigten sich erste Tendenzen hin zu einer Abwanderung aus der Metropolregion Tokyo.
Im zweiten Teil des Beitrags wechselte der Fokus auf die Mikroebene, also die lokale Ebene – in diesem Fall die Gemeinde Chizu in der Präfektur Tottori. Chizu ist ein typisches Beispiel für eine entvölkerte Region (kaso chiiki), in der die Alterung der Bevölkerung rasch voranschreitet. Chizu ging sehr flexibel und adaptiv mit der Corona-Krise um und nutzte seine geringe Bevölkerungsdichte als Chance. Im Vergleich zu den Kommunen in Großstadträumen und auch verglichen mit normalen Zeiten waren die älteren Bewohner Chizus bislang nicht größeren Unannehmlichkeiten ausgesetzt.
Die Corona-Pandemie sollte zum Anlass genommen werden, über die Rolle der lokalen Selbstverwaltung neu nachzudenken. In jedem Fall sollte nach Corona im Rahmen der strategischen Orts- bzw. Stadtentwicklung darauf geachtet werden, die Bewältigungskapazitäten lokaler Selbstverwaltung zu stärken. Dies gilt zwar vornehmlich für ländliche und dünn besiedelte Gebiete, ist aber auch für Großstadträume von Relevanz.
Notes
- 1.
Anm.d. Übers.: Kaso chiiki sind im „Law for Special Measures for Revitalizing Depopulated Areas“ definiert (https://www.soumu.go.jp/main_content/000753093.pdf). Sie bezeichnen extrem dünn besiedelte Gebiete. Im Folgenden wird auf eine explizite Unterscheidung zwischen diesen und anderen dünn besiedelten Regionen verzichtet.
- 2.
Das Inaktivitäts- oder Disuse-Syndrom bezeichnet einen Zustand, in dem das Ruhen aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen dazu führt, dass der Körper weniger bewegt wird. Diese Immobilität des Körpers ruft verschiedene physische und psychische Veränderungen hervor (https://www.osteopathie-schule.de/chronischer-schmerz-und-bewegungsmangel-das-disuse-inaktivitaets-syndrom-2/)
- 3.
Gebrechlichkeit oder „Frailty-Syndrom“ bezeichnet einen „Zustand altersbedingter physischer und psychischer Schwäche“. Allerdings ist es bei Gebrechlichkeit möglich, durch frühzeitiges Eingreifen und Gegenmaßnahmen den ursprünglichen gesunden Zustand wiederherzustellen. Gebrechlichkeit bei älteren Menschen führt nicht nur zu verminderter Lebensqualität, sondern kann auch eine Vielzahl von Komplikationen verursachen. (https://www.netdoktor.de/krankheiten/frailty-syndrom/)
- 4.
ADL (auf Deutsch: ATL) steht für Aktivitäten des täglichen Lebens. Der Begriff bezeichnet tägliche Aktivitäten, die als Mindestvoraussetzung gelten, um ein normales Alltagsleben führen zu können. Dazu gehören Bewegungen wie Schlafhaltung ändern, aufstehen, hinsetzen, sitzen, umsetzen, von A nach B bewegen, essen, sich umziehen, ausscheiden, baden, Körperpflege (einschließlich Gesicht waschen, Zähne putzen, Haare kämmen, rasieren etc.)
- 5.
Anm. d. Übers.: Einrichtungen, die aus dem Krankenhaus entlassene pflegebedürftige Personen auf die Rückkehr in ihre häusliche Umgebung vorbereiten. Der Aufenthalt ist anders als bei den Altenpflegeheimen nicht auf Dauer angelegt. Die Einrichtungen verfügen über medizinisches Personal und führen Rehabilitationsmaßnahmen durch. (https://www.roken.or.jp/about_roken)
- 6.
Anm. d. Übers.: Medical control (MC): Begriff aus der Notfallmedizin für Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Qualität der präklinischen Versorgung durch Rettungsdienste. Um das MC-System zu verbessern, wurden landesweit auf Präfektur- und regionaler Ebene MC-Gremien eingerichtet.
- 7.
In Japan spricht man statt von Abstandsregeln meist von den „3 Cs“ (closed spaces (geschlossene Räume), crowded places (dichte Menschenansammlungen), close-contact settings (enge Kontakte), den drei Bedingungen, die eine Ausbreitung von Infektionskrankheiten begünstigen.
- 8.
Der Verfasser dieses Artikels zeigte anhand des Beispiels der Präfektur Tottori, dass auf Ebene der Präfekturen und Kommunen eine adaptive Governance wirksamer umgesetzt wurde als auf nationaler Ebene, da Präfekturen und Kommunen die lokalen Gegebenheiten und die Corona-Situation vor Ort genau und zeitnah erfassen. (DIJ/DWIH, 2020; Weber, 2020).
- 9.
- 10.
Das Ehepaar Itaru und Mariko Watanabe, zogen im Juni 2016 nach Chizu. Ausschlaggebend war ihre Begeisterung für den „Waldkindergarten Marutanbō“, wo ihre Kinder Aufnahme fanden.
- 11.
Gemeint ist damit sinnbildlich, dass jeder Bürger einen ersten Schritt machen muss, also von Null startet, woraus sich dann in der Summe etwas (die Eins) entwickeln kann.
- 12.
Anm. d. Übers.: Wörtlich etwa: Mini-Tag im Wald von Chizu, https://www1.town.chizu.tottori.jp/chizu/fukushika/kaigo/mini_day/
- 13.
Anm. d. Übers.: Es handelt sich hierbei um eine vom Förderrat eingerichtete Arbeitsgruppe, die für die praktische Umsetzung der Aktivitäten zuständig ist.
Literatur
DIJ/DWIH. (2020). „National approaches to systemic Risk. Germany and Japan under the COVID-19 crisis.“, Web-Forum: https://www.dijtokyo.org/ja/event/national-approaches-to-systemic-riskgermany-and-japan-under-the-covid-19-crisis/. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
Hirata, A. (2020). „Bevölkerungsdichte, Temperatur und absolute Luftfeuchtigkeit haben Einfluss auf Coronaviren – Analyse zur Dauer der Ausbreitung des Coronavirus, Anzahl der Infizierten und Todesfälle“ [Shingata korona uirusu, jinkômitsudo to kion, zettaishitsudo ga eikyô – shingatakorona uirusu no kakudai, shûsokukan, kansenshasuu, shishasuu on bunsekikekka ni tsuite]. https://www.nitech.ac.jp/news/press/2020/8366.html. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
JMA Research Institute. (2020a). „Zwischenbericht: Psychische und physische Auswirkungen einer Corona-Infektion auf ältere Menschen“ [Shingata korona uirusu kansenshô eikyôka ni okeru kôreisha no shinshin he no eikyô (chûkanteki hôkoku)]. https://www.jmar.co.jp/asset/pdf/job/public/llgr2_3_7_report_s.pdf. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
JMA Research Institute, (2020b). „Gesundheitsförderungsprojekt für ältere Menschen (Förderungszuschüsse von Gesundheitsservices für ältere Menschen): Forschung zu Ansätzen regelmäßiger Besuche und präventiver Pflege unter dem Einfluss von COVID-19” [Reiwa ni nendo kôjinhoken kenkô zôshin nado jigyô (Kôjinhoken jigyô suishinbi nado hojokin). Shingata korona uirusu kansenshô eikyôka ni okeru kayoi no ba wo hajime tosuru kaigoyobô no torikumi ni kansuru chôsakenkyû]. https://www.jmar.co.jp/asset/pdf/job/public/llgr2_3_7_report_s(1).pdf. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
Kimura, M., Ojima, T., Kondo, K. (2020). „Auswirkungen auf das Leben älterer Menschen während der Coronavirus-Epidemie: Ergebnisse der JAGES-Studie“ [Shingatakorona uirusu kansenshô ryûkô shita de no kôreisha no seikatsu he no shisa: JAGES kenkyû no chiken kara], JAGES Kenkyû Review, 41, 3–13.
MIC. (o.J.). „Korrelation zwischen verschiedenen Indikatoren“ [Kakushihyô no sôkankankei], https://www.soumu.go.jp/main_content/000631821.pdf. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
MLIT. (o.J.). „Derzeitige Situation in den Regionen auf Grundlage von Basisdaten“ [Kisoshiryô ni motozuku chiiki no genkyô], https://www.mlit.go.jp/common/000025316.pdf. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
Morita, M., Okunuki, K., Shiode, S. (2012). „Studie zum Verständnis des räumlichen Verteilungsmusters der Alterungsrate unter Berücksichtigung der älteren Bevölkerungsdichte“ [Kôreijinkômitsudo wo kôryoshita kôreikaritsu no kûkanteki bunpupataan no haaku ni kansuru kenkyû], Chirigaku Hyôron, 85(6), 608–617.
Nagai, K. (2021). „Statistics Today 178: Übermäßiges Bevölkerungswachstum in Tokio nach Altersgruppen – auf Grundlage des Berichts über den Bevölkerungstransfer im Einwohnerregister.“ [Nenrei kaiyûbetsu ni mita Tôkyôto no ten’nyûchôka no jôkyû – Jûminkihondaichô jinkô idô hôkoku no kekka kara. Tôkei Today No. 178], https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/178.pdf. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
NHK. (2020a). „NHK News: Droht der Pflegekollaps unter dem Coronavirus? Was gerade in Altenpflegeheimen passiert“ [Shingatakorona de „kaigo hôkai“ no kiki?], https://www3.nhk.or.jp/news/html/2020a0508/k10012422701000.html. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
NHK. (2020b). „Blick auf die Daten: „Dritte Welle“ unterscheidet sich von Zweiter Welle wegen einer neuen Coronavirusvariante“ [Deeta de miru: „Daisan nami“ daini nami to no chigai ha Shingatakorona], https://www3.nhk.or.jp/news/html/2020b1117/k10012716911000.html. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
Nihon-Chiiki to Kagaku no deaikan. (1999). „Das Sonnenblumen-System des Machizukuri – Ein sich entwickelndes soziales System“ [Himawari shisutemu no machizukuri – Shinkasuru shakai shisutemu]. Haru Shobo.
Okada, N., Sugiman, T., Hiratsuka, S., Kawara, T. (2000). „Herausforderung für die Gemeinschaft – die Wiederbelebung der Stadt Chizu in der Präfektur Tottori“ [Chiiki kara no chôsen – Tottoriken, Chizuchô no ‚Kuni‘ okoshi]. Iwanami Shoten.
Okada, N., Sugiman, T., Hiratsuka, S., Kawara, T. (2015). „Anregung, die Dinge alleine anzugehen. Herausforderung und Systemtheorie für den regionalen Wiederaufbau von Null: Ein regionales Managementmodell nach 30 Jahren in Chigashichô, Präfektur Tottori“ [Hitori kara hajimeru koto okoshi no susume. Chiiki (machi) fukkô no tame no zero kara no chôsen to jissen shisutemu riron. Tottoriken, chizuchô 30 nen no chiiki keiei moderu]. Kansai Gakuin Shuppan.
Okada, N. (2017). „Chigashichô, Präfektur Tottori, der Geburtsort des Sonnenblumen-Systems: Gestaltung eines sozialen Systems für eine schrumpfende Bevölkerung, niedrige Geburtenrate und eine alternde Gesellschaft“ [Himawari shisutemu wo unda Tottori-ken Chizuchô no chiiki fukkô koto okoshi no machizukuri: Jinkôgen, shôshikôreika ni tekiôsuru shakai shisutemu dezain], Saigai Fukkô Kenkyû, 143–149.
Okada, N., Sugiman, T., Hiratsuka, S., & Kawara, T. (2018). Adaptive process for SMART community governance under persistent disruptive risks. Interntional Journal for Disaster Risk Science, 4, 454–463.
Präfektur Tottori. (2020). „ Unterzeichnung des Abkommens zur Kooperation im Falle des Ausbruchs einer neuen Coronavirus-Infektion“ [Shingata korona uirusu kansenshô hasseitoki ni okeru sôgokyôryoku ni kansuru kyôteiteiketsushiki no kaisai]. http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/179B0D6DE53C5730492585D8008278E3?OpenDocument. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
Tokyo Shimbun. (2021). „Verhinderung des Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung mit dem ‚Matsumoto-Modell‘: Schwere der Coronainfektionen wird von Krankenhäusern getragen” [Iryôhôkai fusege ‚Matsumoto-moderu‘ shingata korona jûshôdo de byôin ga buntan]. https://www.tokyo-np.co.jp/article/84718. Zugegriffen: 28. Nov. 2021.
Urashima, M. (2021). „Genauerer Blick auf die Daten zum Coronavirus: Evidenzbasiertes Verständnis“, [Shingatakorona deeta de semaru sono sugata: Ebidensu ni motozuki rikaisuru] Kagaku Dôjin, 76(4), 34–38.
Weber, T. (2020). „We should build back better, even before crises occur – Interview mit Norio Okada” Weltweit vor Ort – Das Magazin der Max Weber Stiftung, 2020/2, 26–28.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Okada, N. (2022). Die Corona-Pandemie im Kontext einer alternden Bevölkerung – Kommunale Selbstverwaltung auf dem Prüfstand. In: Waldenberger, F., Naegele, G., Kudo, H., Matsuda, T. (eds) Alterung und Pflege als kommunale Aufgabe . Dortmunder Beiträge zur Sozialforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36844-9_21
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36844-9_21
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-36843-2
Online ISBN: 978-3-658-36844-9
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)