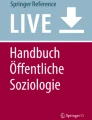Zusammenfassung
Die heutige Befassung mit den grundstürzenden Ereignissen, die mit dem Ende des Ersten Weltkriegs verbunden waren und alle Bereiche der gesellschaftlich-geschichtlichen Welt in Mitleidenschaft zogen, kann kaum als Alexandrinertum abgetan werden. So gut wie allen krisenhaften Zügen ihrer Zeit wandte sich die im deutschen Sprachraum erst seit den 1920er Jahren etablierte Soziologie zu. Eine ganze Batterie von sog. Bindestrich-Soziologien: von der Wirtschaftssoziologie über die Politische Soziologie und die Rechtssoziologie bis zur Religions- und Kultursoziologie, suchte nun unter dem Namen „Spezielle Soziologien“ die zahlreichen, bislang anderen Einzelwissenschaften zugeordneten Forschungsbereiche unter einer neuen Perspektive darzustellen und zu analysieren. Ausgehend von der Frage nach der Besonderheit des Soziologischen in der Vielfalt von Speziellen Soziologien, welche dem Umfang nach die einzelnen Bände der Reihe Soziologie der Zwischenkriegszeit dominieren, werden in der vorliegenden Einleitung skizzenhafte Befunde über den Gegenstand der Soziologie, über einige Arten der für sie charakteristischen Beschreibung und Erklärung sowie insbesondere über ihre leitenden Erkenntnisorientierungen unter Bezugnahme auf exemplarische einschlägige Literatur dieser Zeit vorgelegt.
Meinem Freund Michael Bock (1950–2021) zum Gedenken
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Die Herausgeber sind bestrebt, Ausführungen zu einer bestimmten Speziellen Soziologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zwei oder mehr Beiträge dazu nötig machen, um dem Vergleich bzw. der Spezifik der sich in verschiedenen Ländern vollziehenden Entwicklungen angemessen Rechnung zu tragen, jeweils im selben Band zum Abdruck zu bringen. Nicht immer gelingt es, diese Absicht umzusetzen. So kam z. B. bereits in Band 1 der Beitrag zur Bevölkerungswissenschaft in Österreich zum Abdruck, während der einschlägige auf Deutschland bezogene erst in Band 3 vorliegen wird.
- 2.
Vgl. dazu eines der frühen Lehrbücher der Soziologie in deutscher Sprache, Rudolf Eislers (1873–1926) Soziologie (Eisler 1903), in dem der Autor, hierin Georg Simmel verwandt und zum Teil im Anschluss an ihn, der Beziehungslehre in der Soziologie eine bestimmende Rolle eingeräumt hat.
- 3.
In diesem klassisch gewordenen Text versuchte Tönnies zu zeigen, dass mit einer bestimmten Form der „Gesellung“, also mit der besonderen Beschaffenheit von Verbänden, jeweils bestimmte Komponenten aus den soeben erwähnten konträren Begriffspaaren kovariieren: mit Gemeinschaften eher Gleichheit und Konsens, mit Gesellschaften hingegen eher Ungleichheit und Konflikt.
- 4.
Vgl. unter anderem zur generationsprägenden Erfahrung der 1918 unterlegenen Deutschen Wolfgang Schivelbusch: Die Kultur der Niederlage (Schivelbusch 2002).
- 5.
In diesem Zusammenhang sei auf Einsichten von Thomas C. Schelling zur Sozialtheorie und zu den Grundlagen des Wirtschaftshandelns hingewiesen (Schelling 1978), denen zufolge das menschliche Verhalten besser verständlich sei, wenn man die übliche Fixierung auf die Individualpsychologie aufgebe und stattdessen einen anderen Ansatz verfolge: Wir müssten Menschen als Entitäten betrachten, deren Verhalten durch Normen reguliert wird, wobei es darum gehe, die Muster zu erkennen, die sich aus der Wirksamkeit dieser Normen ergeben. Scheinbar komplizierte soziale Phänomene haben Schelling zufolge oft simple Ursachen, die erkannt werden könnten, sobald wir die Gesetzmäßigkeiten erfassen, die der Ausbildung dieser Muster des zwischenmenschlichen Verhaltens zugrunde liegen.
- 6.
Wie analysiert wird, hängt maßgeblich davon ab, was man zu beschreiben und zu erklären sucht. Für die auf das soziale Handeln von Individuen und Gruppen, und nicht allein auf die Handlungsresultate gerichteten Analysen der Soziologie gilt jedenfalls, dass in ihnen nicht von den Vorstellungen, Erwartungen, Stimmungen und Gefühlen abgesehen werden kann, aus denen jenes Handeln entspringt und von denen es begleitet ist.
- 7.
Vgl. in diesem Zusammenhang von Hans Kelsen: „Der Staatsbegriff der ‚verstehenden Soziologie‘“ (Kelsen 1921), ferner von Emil Lederer den Aufsatz „Zum Methodenstreit in der Soziologie. Ein Beitrag zum Grundproblem einer ‚verstehenden‘ Soziologie“ (Lederer 2014a,b [1925]); siehe auch die unter dem Titel „Varianten verstehender Soziologie“ erschienene Abhandlung von Martin Endreß (Endreß 2004).
- 8.
Exemplarisch sei hier auf Bücher von zwei Historikern aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hingewiesen, für die diese alte Dichotomie längst einer Kooperation von „Idiographen“ und „Nomothetikern“ Platz gemacht hat: auf Winfried Schulzes Soziologie und Geschichtswissenschaft (Schulze 1974) und Peter Burkes Soziologie und Geschichte (Burke 1989).
- 9.
In diesem Zusammenhang sei auf das grundlegende Werk von Otto Bauer (1881–1938) Der Kampf um Wald und Weide (Bauer 1925) hingewiesen.
- 10.
Diese Hypothesen betreffen zum einen den synchron bestehenden Zusammenhang von Teilen und Ganzem in funktionalen Erklärungen, durch welche die Relevanz des jeweiligen Systemelements für das Systemganze bestimmt wird, und zum anderen den diachronen Zusammenhang sozialer Phänomene in kausal-genetischen Erklärungen.
- 11.
Inama-Sternegg, der die erste mit Hollerithmaschinen durchgeführte Volkszählung in der Habsburgermonarchie leitete, gab der Entwicklung der Arbeits- und Sozialstatistik in Österreich wesentliche Impulse, die auch in der Zwischenkriegszeit ihre Wirkung zeitigten.
- 12.
Vgl. dazu Alexander Pinwinklers Beitrag über Wilhelm Winklers „Gesellschaftsstatistik“ in diesem Band.
- 13.
Daher soll Scheler zufolge die Aufgabe der Wissenssoziologie in einer das eine Mal ideal-, das andere Mal realsoziologisch vorgehenden Analyse bestehen: in der „Untersuchung des vorwiegend geistig bedingten und auf geistige, d. h. ‚ideale‘ Ziele gerichteten Seins und Handelns, Wertens und Verhaltens des Menschen – und [in der] Untersuchung des vorwiegend durch Triebe (Fortpflanzungstriebe, Nahrungstriebe, Machttriebe) und zugleich auf reale Veränderung von Wirklichkeiten intentional gerichteten Handelns, Wertens und Verhaltens nach ihrer sozialen Determiniertheit“ (Scheler 1960a [1926]: 18).
- 14.
- 15.
Wie für Dilthey, so war es auch für Karl Jaspers im Prinzip nicht widersinnig, beispielsweise bestimmte Vorstellungs- oder Gefühlsinhalte sowohl (mentalistisch) zu „verstehen“ als auch (physiko-chemisch) zu „erklären“. Nur seien die beiden gefundenen Zusammenhänge von ganz verschiedener Herkunft und ganz verschiedener Geltungsart: „Sie helfen sich gegenseitig nicht im geringsten. Die Erklärung macht den Zusammenhang nicht verständlicher, das Verständnis macht ihn nicht erklärter. Jedes, das Verstehen wie das Erklären, bedeutet dem andern gegenüber etwas Neues.“ Zwar sei etwa für den Psychologen die Kombination der verstehenden und der erklärenden Methode: des Erfassens des Sinnes von seelischen Akten oder von Handlungen, und des Erfassens der kausalen Bedeutung der sie bedingenden Umstände, gleich unentbehrlich; „aber“, so fügt Jaspers hinzu, „in keinem Falle treffen das Verstehen und das Erklären von verschiedenen Seiten her denselben realen Teil des komplexen seelischen Vorgangs“ (Jaspers 1990 [1913]: 333).
- 16.
Verstehen wird bei Dilthey lange Zeit hindurch tatsächlich als ein „Nacherleben“ durch „Einfühlung“ aufgefasst, in seinen späteren Abhandlungen jedoch vor allem als die Fähigkeit begriffen, jenen Regeln folgen zu können, die das Handeln von Menschen in Institutionen und die „Objektivationen“ ihres Schaffens bestimmen.
- 17.
Siehe in diesem Zusammenhang abermals Fußnote 7.
- 18.
Mit dem Begriff des „erklärenden Verstehens“ signalisierte Weber, nicht mehr Diltheys Terminologie für zweckmäßig zu halten, der zufolge sich das Verstehen auf das „Seelenleben“, das Erklären aber auf die „Natur“ beziehe (Dilthey 1982 [1894]: 144).
- 19.
Diese Ordnungsbegriffe und weitgehend auch deren Explikation sind Michael Bocks anregendem Aufsatz „Die Entwicklung der Soziologie und die Krise der Geisteswissenschaften in den 20er Jahren“ (Bock 1994) entnommen.
- 20.
Die in wirkungsgeschichtlicher Hinsicht wohl bedeutendste stammt von Max Scheler. Scheler hat im Anschluss an Wilhelm Diltheys Analyse der Weltanschauungen sowie an die im Jahr 1922 erschienene Strukturanalyse der Erkenntnistheorie von Karl Mannheim (Mannheim 1964a [1922]) im Jahr 1925 eine berühmt gewordene Unterscheidung von drei „Wissensformen“ formuliert: von „Erlösungs-“, „Bildungs-“ und „Herrschafts-“ oder „Leistungswissen“ (Scheler 1960a [1926]), mit welcher Unterscheidung er die von „emanzipatorischem“, „praktischem“ und „technischem Erkenntnisinteresse“ bei Jürgen Habermas (Habermas 1968) vorweggenommen hat. – Auch Werner Sombarts aus dem Jahr 1930 stammende Gliederung der Nationalökonomie in eine „richtende“, eine „ordnende“ und eine „verstehende Nationalökonomie“ (Sombart 1930) ist hier zu nennen. Die richtende Nationalökonomie ist ihrem Charakter nach wertend, die ordnende Nationalökonomie analysiert ihren Gegenstand mit den Mitteln der Naturwissenschaft, während ihn die verstehende Nationalökonomie als ein Kulturphänomen unter den Gesichtspunkten des „Sinnverstehens“, des „Sachverstehens“ und des „Seelverstehens“ untersucht; dabei wird nach Sombart allein die zuletzt genannte Form des Verstehens der Ökonomie als Kulturphänomen wirklich gerecht. – Vgl. in diesem Zusammenhang Adolf Löwes Besprechung von Sombarts Buch, die unter dem Titel „Über den Sinn und die Grenzen verstehender Nationalökonomie“ (Löwe 1932) erschienen ist.
- 21.
Dass die Kultursoziologie und die historische Soziologie im deutschen Sprachraum nicht allein auf das mit „Bildungswissen“ Bezeichnete einzuschränken waren, sondern vor allem auch essentielle Inhalte des sog. Weltanschauungswissens enthielten, ist nicht zu übersehen. Volker Kruse hat die verschiedenen Inhalte und Funktionen der deutschen historischen Soziologie in dem Buch „Geschichts- und Sozialphilosophie“ oder „Wirklichkeitswissenschaft“? vorzüglich dargestellt (Kruse 1999).
- 22.
Für wertvolle Hinweise danke ich an dieser Stelle Frau Barbara Boisits von der Kommission für Musikforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- 23.
Beidem entspricht bei Werner Sombart die „ordnende Nationalökonomie“ (vgl. Sombart 1930: 85–139).
- 24.
Werner Sombart hat dafür in seiner Monographie Die drei Nationalökonomien die Bezeichnung „richtende Nationalökonomie“ gewählt (vgl. Sombart 1930: 21–84).
- 25.
Exemplarische Vertreter einer solchen wertenden Wissenschaft sind in Deutschland die vor allem als Kulturkritiker in Erscheinung getretenen Paul de Lagarde und Julius Langbehn, aber auch der als Volkserzieher wirksame Philosoph und Pädagoge Friedrich Paulsen, der unter anderem mit Ferdinand Tönnies in engerer persönlicher Beziehung stand. Verschiedene Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler aus unterschiedlichen politisch-weltanschaulichen Lagern ließen sich hier hinzufügen, für deren Schrifttum eine Vermischung von Tatsachenaussagen mit subjektiv wertenden Stellungnahmen charakteristisch ist, wogegen bekanntlich insbesondere Max Weber deutlich Stellung bezogen hat. Als ein scharf gegen Max Webers Wertfreiheitsprinzip argumentierender Autor aus jüngerer Zeit sei hier Leo Strauss mit seinem vor allem in den USA einflussreichen Buch Natural Right and History angeführt (Chicago: University of Chicago Press 1953; die deutsche Übersetzung erschien im selben Jahr unter dem Titel Naturrecht und Geschichte im Verlag K.F. Köhler in Stuttgart.).
- 26.
In besonderem Maße trifft dies auf die schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum umfangreich betriebenen Studien zur „sozialen Frage“ zu, die im 20. Jahrhundert auch unter dem Namen „Armutsforschung“ in Erscheinung getreten sind; vgl. in diesem Zusammenhang exemplarisch Hildegard Hetzers (1899–1991) Buch Kindheit und Armut (Hetzer 1929).
- 27.
Wie sich in Werner Sombarts Buch Die drei Nationalökonomien (Sombart 1930) Probleme bei der Abgrenzung der Erkenntnisabsicht der „verstehenden“ von der „ordnenden“ Nationalökonomie ergeben, so später auch bei Habermas bezüglich der Abgrenzung bestimmter geistes- und sozialwissenschaftlicher von bestimmten naturwissenschaftlichen Fächern im Hinblick auf die „emanzipatorische“ Funktion des sie leitenden Erkenntnisinteresses (vgl. Acham 1972).
- 28.
Vgl. dazu auch von Sebald Rudolf Steinmetz, dem Begründer der niederländischen Soziologie, die Abhandlung „Das Verhältnis von Soziographie und Soziologie“ (Steinmetz 1927).
- 29.
Hier ist auch die Auseinandersetzung von Friedrich Hertz mit dem wichtigsten Proponenten der nationalsozialistischen Rasseforschung zu erwähnen, die unter dem Titel Hans Günther als Rassenforscher erschienen ist (Hertz 1930).
- 30.
So wies Kenneth Arrow mit dem nach ihm bezeichneten Unmöglichkeitstheorem auf ein Paradoxon der sozialen Wahl (Social choice) hin, dem zufolge eine eindeutige Reihenfolge der Präferenzen in einem Ranglistensystem nicht bestimmt werden kann, wenn die verbindlichen Grundsätze eines ethisch fairen und methodisch korrekten Wahlverfahrens eingehalten werden; mit anderen Worten: dass es keine vollständige und transitive gesellschaftliche Rangordnung gibt, die sich aus beliebigen individuellen Rangordnungen unter Einhaltung dieser Grundsätze zusammensetzt (Arrow 1963 [1951]). – Von den mannigfachen Knappheitseffekten, die mit verschiedenen Formen der immer wieder intendierten Vereinheitlichung von Bedürfnissen und Wertorientierungen verbunden wären, sei hier erst gar nicht die Rede.
- 31.
Auch aus Gründen der Moralität, und nicht allein aus solchen der Wissenschaftlichkeit kann man die Reduzierung eines zunehmend ritualistisch erstarrten Moralismus als wünschenswert betrachten.
Literatur
(Bei den folgenden bibliographischen Angaben wurde es häufig unterlassen, die aktuellsten Neuausgaben oder Nachdrucke von Büchern und Abhandlungen zu nennen. Als bedeutsamer erschien die Nennung ihrer Ersterscheinungsjahre.)
Acham, Karl (1972): „Hermeneutik und Wissenschaftstheorie aus der Sicht des Kritischen Rationalismus – Zum Verhältnis von Hermeneutik und Sozialwissenschaften“, in: Uwe Gerber (Hg.), Hermeneutik als Kriterium für Wissenschaftlichkeit? Der Standort der Hermeneutik im gegenwärtigen Wissenschaftskanon. Dokumente des Kolloquiums vom Oktober 1971 (= Loccumer Kolloquien 2), Loccum: o. V., S. 102–128.
Acham, Karl (2016): Vom Wahrheitsanspruch der Kulturwissenschaften. Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Weltanschauungsanalyse, Wien/Köln/Weimar: Böhlau.
Adler, Max (1924): Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erziehung, Berlin: E. Laub’sche Verlagsbuchhandlung.
Adler, Max (1926): Politische oder soziale Demokratie. Ein Beitrag zur sozialistischen Erziehung, Berlin: E. Laub’sche Verlagsbuchhandlung.
Adorno, Theodor W. (1932): „Zur gesellschaftlichen Lage der Musik“, in: Zeitschrift für Sozialforschung 1, S. 103–124, 356–378. [Wiederabgedruckt in: Gesammelte Schriften 18, S. 729–777.]
Arlt, Ilse (von) (1921): Die Grundlagen der Fürsorge, Wien: Österreichischer Schulbuchverlag.
Arrow, Kenneth J. (1963 [1951]): Social Choice and Individual Values, 2. Aufl., New Haven: Yale University Press.
Bauer, Otto (1925): Der Kampf um Wald und Weide. Studien zur österreichischen Agrargeschichte und Agrarpolitik, Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung. [Neuauflage in: Otto Bauer Werkausgabe, Bd. 3, Wien: Europaverlag 1976, S. 31–248.]
Behrendt, Richard F. (1932): Politischer Aktivismus. Ein Versuch zur Soziologie und Psychologie der Politik, Leipzig: Hirschfeld.
Benn, Gottfried (1961 [1948]): „Berliner Brief, Juli 1948 an den Herausgeber einer süddeutschen Monatsschrift“, in: Vermischte Schriften, Wiesbaden/München: Limes Verlag [= Das Hauptwerk. Vierter Band], S. 197–202.
Bock, Michael (1994): „Die Entwicklung der Soziologie und die Krise der Geisteswissenschaften in den 20er Jahren“, in: Knut Wolfgang Nörr/Bertram Schefold/Friedrich Tenbruck (Hg.), Geisteswissenschaften zwischen Kaiserreich und Republik. Zur Entwicklung von Nationalökonomie, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft im 20. Jahrhundert, Stuttgart: Franz Steiner, S. 159–185.
Böhm, Franz (1928): „Das Problem der privaten Macht“, in: Die Justiz 3, S. 324–345.
Borkenau, Franz (1971 [1934]): Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. [Unveränderter reprographischer Nachdruck der Ausgabe Paris: Alcan 1934.]
Burke, Peter (1989): Soziologie und Geschichte, aus dem Engl. v. Johanna Friedman, Hamburg: Junius.
Cohn, Arthur Wolfgang (1922): „Wirtschaftslehre oder Sozialwissenschaft?“, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 39, S. 1–80.
Comte, Auguste (1830–1842): Cours de philosophie positive, 6 Bde., Paris: Bachelier.
Curtius, Ernst Robert (1982 [1929]): „Soziologie – und ihre Grenzen“, in: Volker Meja/Nico Stehr (Hg.), Der Streit um die Wissenssoziologie, 2 Bde., Bd. 2: Rezeption und Kritik der Wissenssoziologie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 417–426. [Aus: Neue Schweizer Rundschau 22 (Oktober 1929), S. 727–736.]
Dilthey, Wilhelm (1982 [1894]): „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“, in: Ders., Die geistige Welt (= Ges. Schriften, Bd. V), 7. Aufl., Stuttgart/Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 139–240.
Dobretsberger, Josef (1931/32): „Zur Soziologie ökonomischen Denkens“, in: Archiv für angewandte Soziologie 4, S. 21–55.
Eisler, Rudolf (1903): Soziologie. Die Lehre von der Entstehung und Entwickelung der menschlichen Gesellschaft, Leipzig: J.J. Weber.
Elias, Norbert (1997a [1939]): Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 Bde., Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp (= Bd. 3.1 der Gesammelten Schriften, bearb. v. Heike Hammer). [Die Erstauflage erschien 1939 in Basel im Verlag Haus zum Falken.]
Elias, Norbert (1997b [1939]): Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 Bde., Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Frankfurt a. M.: Suhrkamp (= Bd. 3.2 der Gesammelten Schriften, bearb. v. Heike Hammer). [Die Erstauflage erschien 1939 in Basel im Verlag Haus zum Falken.]
Endreß, Martin (2004): „Varianten verstehender Soziologie“, in: Klaus Lichtblau (Hg.), Max Webers „Grundbegriffe“, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 21–46.
Geiger, Theodor (1928): Die Gestalten der Gesellung, Leipzig: Buske.
Geiger, Theodor (1932): Die soziale Schichtung des deutschen Volkes. Soziographischer Versuch auf statistischer Grundlage, Stuttgart: Enke.
Geiger, Theodor (1962 [1930]): „Zur Theorie des Klassenbegriffs und der proletarischen Klasse“, in: Ders., Arbeiten zur Soziologie. Methode – Moderne Großgesellschaft – Rechtssoziologie – Ideologiekritik. Ausgew. u. eingel. von Paul Trappe, Neuwied am Rhein/Berlin-Spandau: Hermann Luchterhand, S. 206–259. [Aus: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 54 (1930), S. 185–236.]
Geiger, Theodor Julius (1933): Soziologische Kritik der eugenischen Bewegung, Berlin: R. Schoetz.
Goldscheid, Rudolf (1921): „Die Stellung der Entwicklungs- und Menschenökonomie im System der Wissenschaften“, in: Kölner Vierteljahreszeitschrift für Soziologie 1, S. 5–15.
Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von (1926): Fordismus. Über Industrie und technische Vernunft, 3. erw. Aufl., Jena: Gustav Fischer.
Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von (1929): Vom Sinn der Rationalisierung, Jena: Gustav Fischer.
Grünwald, Ernst (1934): Das Problem der Soziologie des Wissens, Wien/Leipzig: Braumüller.
Günther, Adolf (1925): „Soziologie und Sozialpolitik“, in: Verhandlungen des Vierten Deutschen Soziologentages, Tübingen: J.C.B. Mohr, S. 8–70.
Habermas, Jürgen (1968): „Erkenntnis und Interesse“, in: Ders., Technik und Wissenschaft als „Ideologie“, Frankfurt a. M., S. 146–168.
Hayek, Friedrich August von (1979): Mißbrauch und Verfall der Vernunft, 2. erw. Aufl., Salzburg: W. Neugebauer. [1. amerik. Aufl. 1952.]
Heberle, Rudolf (1931): „Soziographie“, in: Alfred Vierkandt (Hg.), Handwörterbuch der Soziologie, Stuttgart: F. Enke, S. 564–568.
Heberle, Rudolf/Fritz Meyer (1937): Die Großstädte im Strome der Binnenwanderung, Leipzig: S. Hirzel.
Heinrich, Walter [als Reinald Dassel] (1929): Gegen Parteienstaat, für Ständestaat, Wien/Graz/Klagenfurt: Verlag des Steirischen Heimatschutzverbandes.
Hertz, Friedrich (Otto) (1925): Zahlungsbilanz und Lebensfähigkeit Österreichs, München/Leipzig: Duncker & Humblot.
Hertz, Friedrich Otto (1928): Race and Civilisation, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co./New York: Macmillan.
Hertz, Friedrich Otto (1930): Hans Günther als Rassenforscher, Berlin: Philo-Verlag.
Hertz, Friedrich (1931): „Zur Soziologie der Nation und des Nationalbewußtseins“, in: Archiv für Sozialwissenschaft 65, S. 1–60.
Hetzer, Hildegard (1929): Kindheit und Armut. Psychologische Methoden in Armutsforschung und Armutsbekämpfung, Leipzig: Hirzel.
Honigsheim, Paul (1930): „Musik und Gesellschaft“, in: Leo Kestenberg (Hg.), Kunst und Technik, Berlin: Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, S. 63–96.
Horkheimer, Max (1982 [1930]): „Ein neuer Ideologiebegriff?“, in: Volker Meja/Nico Stehr (Hg.), Der Streit um die Wissenssoziologie, 2 Bde., Bd. 2: Rezeption und Kritik der Wissenssoziologie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 474–496. [Aus: Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung 15 (1930), S. 33–56.]
Inama-Sternegg, Karl Theodor von (1882): „Geschichte und Statistik“, in: Statistische Monatschrift 8, S. 3–15.
Inama-Sternegg, Karl Theodor von (1903a): „Vom Wesen und den Wegen der Sozialwissenschaft“, in: Ders., Staatswissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 1, Leipzig: Duncker & Humblot, S. 1–19.
Inama-Sternegg, Karl Theodor von (1903b): „Zur Kritik der Moralstatistik“, in: Ders. Staatswissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 1, Leipzig: Duncker & Humblot, S. 303–333.
Jaspers, Karl (1990 [1913]): „Kausale und ,verständliche‘ Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei der Dementia praecox (Schizophrenie)“, in: Ders., Gesammelte Schriften zur Psychopathologie, Nachdruck der 1. Aufl. von 1963, Berlin/Heidelberg/New York: Springer, S. 329–412. [Erstmals in: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. Originalien 14 [1913], S. 158–263.]
Kaufmann Felix (1936): Methodenlehre der Sozialwissenschaften, Wien: Springer.
Kelsen, Hans (1920): Sozialismus und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus, Leipzig: Hirschfeld.
Kelsen, Hans (1921): „Der Staatsbegriff der ‚verstehenden Soziologie‘“, in: Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik, Neue Folge, Bd. 1, S. 104–119.
Kelsen, Hans (1922): „Staat und Recht. Zum Problem der soziologischen und juristischen Erkenntnis des Staates“, in: Kölner Vierteljahreshefte für Sozialwissenschaften 2, S. 18–37.
Kelsen, Hans (1928a): Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht, Tübingen: J.C.B. Mohr.
Kelsen, Hans (1928b): Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Charlottenburg: R. Heise.
Kelsen, Hans (1933): Staatsform und Weltanschauung, Tübingen: J.C.B. Mohr.
Klezl-Norberg, Felix (von) (1921): Zur Statistik der Teuerung in Österreich, Wien: Österreichische Staatsdruckerei.
Kruse, Volker (1999): „Geschichts- und Sozialphilosophie“ oder „Wirklichkeitswissenschaft“. Die deutsche historische Soziologie und die logischen Kategorien René Königs und Max Webers, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Lazarsfeld, Paul Felix/Arthur W. Kornhauser (1935): The techniques of market research from the standpoint of a psychologist. (Presented at the Institute of management meeting, Hotel Pennsylvania, May 24, 1935) New York: American Management Association.
Lazarsfeld, Paul Felix/Marie Jahoda/Hans Zeisel (1933): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit, hrsg. und bearbeitet von der Österreichischen Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle, Leipzig: S. Hirzel.
Lederer, Emil (1918/1919): „Zum sozialpsychischen Habitus der Gegenwart“, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 46, S. 114–139.
Lederer, Emil (1922): Die sozialen Organisationen, 2. Aufl., Leipzig/Berlin: Teubner.
Lederer, Emil (2014a [1922]): „Zeit und Kunst“, in: Ders., Schriften zur Wissenschaftslehre und Kultursoziologie, hrsg. u. eingel. v. Peter Gostmann u. Alexandra Ivanova, Wiesbaden: Springer, S. 227–234.
Lederer, Emil (2014b [1925]): „Zum Methodenstreit in der Soziologie. Ein Beitrag zum Grundproblem einer ,verstehenden‘ Soziologie“, in: Ders., Schriften zur Wissenschaftslehre und Kultursoziologie, hrsg. u. eingel. v. Peter Gostmann u. Alexandra Ivanova, Wiesbaden: Springer, S. 259–282.
Leichter, Käthe (1927): Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in Österreich, Wien: Verlag „Arbeit und Wirtschaft“.
Leichter, Käthe (1932): So leben wir ... 1320 Industriearbeiterinnen berichten über ihr Leben. Eine Erhebung, Wien: Verlag „Arbeit und Wirtschaft“.
Löwe, Adolf (1932): „Über den Sinn und die Grenzen verstehender Nationalökonomie. Zu Sombarts Werk ‚Die drei Nationalökonomien‘“, in: Weltwirtschaftliches Archiv 36, S. 149–162.
Löwe, Adolf (1935): Economics and Sociology: A Plea for Co-operation in the Social Sciences, London: Allen and Unwin.
Löwenthal, Leo (1932): „Zur gesellschaftlichen Lage der Literatur“, in: Zeitschrift für Sozialforschung 1–2, S. 85–102.
Luschan, Felix (von) (1922): Völker, Rassen, Sprachen, Berlin: Welt-Verlag.
Maas, Walther (1938): „Geographie und Soziologie“, in: Slavische Rundschau 10, S. 176–182.
Mann, Fritz Karl (1930): Die Staatswirtschaft unserer Zeit. Eine Einführung, Jena: Gustav Fischer.
Mann, Golo (1979): „Plädoyer für die historische Erzählung“, in: Jürgen Kocka/Thomas Nipperdey (Hg.), Theorie und Erzählung in der Geschichte (= Beiträge zur Historik, Bd. 3), München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 40–56.
Mannheim, Karl (1964a [1922]): „Die Strukturanalyse der Erkenntnistheorie“, in: Ders., Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingel. u. hrsg. von Kurt H. Wolff, Berlin/Neuwied: Hermann Luchterhand, S. 166–245. [Kant-Studien, Ergänzungsheft Nr. 57, Berlin: Reuther und Reichard 1922.]
Mannheim, Karl (1964b [1924]): „Historismus“, in: Ders., Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingel. u. hrsg. von Kurt H. Wolff, Berlin/Neuwied: Hermann Luchterhand, S. 246–307. [Aus: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 52 (1924), H. 1, S. 1–60.]
Mannheim, Karl (1964c [1928]): „Das Problem der Generationen“, in: Ders., Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingel. u. hrsg. von Kurt H. Wolff, Berlin/Neuwied: Hermann Luchterhand, S. 509–565. [Aus: Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie 7 (1928), S. 157–185, 309–330.]
Mannheim, Karl (1969 [1929]): Ideologie und Utopie, Frankfurt: Schulte-Bulmke. [Die 1. Aufl. erschien im Verlag F. Cohen in Bonn.]
Mannheim, Karl (1984 [1926]): Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens, hrsg. von David Kettler, Volker Meja und Nico Stehr, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Martin, Alfred von (1932): Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomik und Rhythmik bürgerlicher Kultur, Stuttgart: Ferdinand Enke.
Mayreder, Rosa (1922): Zur Kritik der Weiblichkeit. Essays, 5. Aufl., Jena: E. Diederichs.
Mayreder, Rosa (1923): Geschlecht und Kultur. Essays, Jena: E. Diederichs.
Mayreder, Rosa (1927): Ideen der Liebe, Jena: E. Diederichs.
Meja, Volker/Nico Stehr (Hg.) (1982): Der Streit um die Wissenssoziologie, 2 Bde. Bd. 2: Rezeption und Kritik der Wissenssoziologie, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Messner, Johannes (1928): Sozialökonomik und Sozialethik, Paderborn: Schöningh.
Mises, Richard von (1939): Kleines Lehrbuch des Positivismus. Einführung in die empiristische Wissenschaftsauffassung, The Hague, Holland: W.P. van Stockum & Zoon. [Ein Nachdruck, hrsg. u. eingel. v. Friedrich Stadler, erschien 1990 bei Suhrkamp in Frankfurt a. M.]
Morgenstern, Oskar (1928): Wirtschaftsprognose. Untersuchung ihrer Voraussetzungen und Möglichkeiten, Wien: J. Springer.
Morgenstern, Oskar (1935): „Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht“, in: Zeitschrift für Nationalökonomie 6, S. 337–357.
Neurath, Otto (1928): Lebensgestaltung und Klassenkampf, Berlin: E. Laubsche Verlagsbuchhandlung.
Neurath, Otto (1998): Gesammelte ökonomische, soziologische und sozialpolitische Schriften, 2 Bde., hrsg. v. Rudolf Haller und Ulf Höfer, Wien: Hölder-Pichler-Tempsky.
Nietzsche, Friedrich (1963 [1872]): „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ (= Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück), in: Ders., Werke in drei Bänden, Bd. 1, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 209–285.
Plenge, Johann (1919): Drei Vorlesungen über die allgemeine Organisationslehre, Essen: G.D. Baedeker.
Plessner, Helmuth (1935): Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche, Zürich/Leipzig: Niehans. [Dieses Buch erschien unter dem Titel Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1959 in 5 Auflagen im Verlag Kohlhammer in Stuttgart, seit 1974 unter demselben Titel in mehreren Auflagen bei Suhrkamp in Frankfurt a. M.]
Plessner, Helmuth (1982 [1931/1932]): „Abwandlungen des Ideologiegedankens“, in: Volker Meja/Nico Stehr (Hg.), Der Streit um die Wissenssoziologie, 2 Bde., Bd. 2: Rezeption und Kritik der Wissenssoziologie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 637–662. [Zuerst erschienen in: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie 10 (1931/1932), S. 148–170.]
Popp, Adelheid (1922): Frauenarbeit in der kapitalistischen Gesellschaft, Wien: Verlag des Frauen-Zentralkomitees.
Preussner, Eberhard (1935): Die bürgerliche Musikkultur. Ein Beitrag zur deutschen Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.
Pribram, Karl (1917): „Die Weltanschauungen der Völker und ihre Politik“, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 44, S. 161–197.
Rebling, Eberhard (1935): Die soziologischen Grundlagen der Stilwandlung der Musik in Deutschland um die Mitte des 18. Jahrhunderts, Saalfeld, Ostpr.: Günthers Buchdruckerei.
Renner, Karl (1929): Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, Tübingen: J.C.B. Mohr. [Überarbeitete Neuausgabe des unter dem Pseudonym „Josef Karner“ 1904 veröffentlichten Buchs Die soziale Funktion der Rechtsinstitute.]
Salomon, Albert (1979 [1921]): Der Freundschaftskult im 18. Jahrhundert in Deutschland. Versuch zur Soziologie einer Lebensform. Diss. Universität Heidelberg (Microfiche). [Wiederabgedruckt in: Zeitschrift für Soziologie 8 (1979), S. 279–308.]
Scheler, Max (1960a [1926]): Die Wissensformen und die Gesellschaft, 2. Aufl., Bern/München: Francke (= Gesammelte Werke, Bd. 8).
Scheler, Max (1960b [1925]): „Probleme einer Soziologie des Wissens“, in: Ders., Die Wissensformen und die Gesellschaft, 2. Aufl., Bern/München: Francke (= Gesammelte Werke, Bd. 8), S. 15–190.
Schelling, Thomas C. (1978): Micromotives and Macrobehavior, London/New York: W.W. Norton.
Schivelbusch, Wolfgang (2002): Die Kultur der Niederlage. Der amerikanische Süden 1865 – Frankreich 1871 – Deutschland 1918, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Schütz, Alfred (1974 [1932]): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, 2. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Schulze, Winfried (1974): Soziologie und Geschichtswissenschaft. Einführung in die Probleme der Kooperation beider Wissenschaften, München: Fink.
Schumpeter, Joseph A. (1952 [1932]): „Das Woher und Wohin unserer Wissenschaft. Abschiedsrede gehalten vor der Bonner staatswissenschaftlichen Fachschaft am 20. Juni 1932“, in: Ders., Aufsätze zur ökonomischen Theorie, Tübingen: J.C.B. Mohr, S. 598–608.
Serauky, Walter (1934): „Wesen und Aufgaben der Musiksoziologie,“ in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 16, S. 232–244.
Simmel, Georg (1917): Grundfragen der Soziologie (Soziologie und Gesellschaft), Berlin: Göschen.
Sombart, Werner (1925): Die Ordnung des Wirtschaftslebens, München/Leipzig: Duncker & Humblot.
Sombart, Werner (1930): Nationalökonomie und Soziologie, Jena: Gustav Fischer.
Sombart, Werner (1967 [1930]): Die drei Nationalökonomien. Geschichte und System der Lehre von der Wirtschaft, 2. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.
Spann, Othmar (1921): Der wahre Staat. Vorlesung über Abbruch und Neubau der Gesellschaft, Leipzig: Quelle und Meyer.
Spann, Othmar (1934): Kämpfende Wissenschaft. Gesammelte Abhandlungen zur Volkswirtschaftslehre, Gesellschaftslehre und Philosophie, Jena: Gustav Fischer.
Steinmetz, Sebald Rudolf (1927): „Das Verhältnis von Soziographie und Soziologie“, in: Verhandlungen des Fünften Deutschen Soziologentages, Tübingen: Mohr, S. 217–225, Diskussion: S. 226–227.
Tietze, Hans (1930): Die Kunst in unserer Zeit, Wien: R. Lányi.
Tönnies, Ferdinand (1963 [1887]): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie (Nachdr. [der] 8., verb. Aufl., Leipzig 1935), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Topitsch, Ernst (Hg.) (1964): Hans Kelsen. Aufsätze zur Ideologiekritik, Neuwied am Rhein/Berlin: Luchterhand.
Vierkandt, Alfred (1928): Gesellschaftslehre. Hauptprobleme der Philosophischen Soziologie, 2. umgearb. Aufl., Stuttgart: Ferdinand Enke.
Voegelin, Erich (1928): Über die Form des amerikanischen Geistes, Tübingen: J.C.B. Mohr.
Wald, Abraham (1939): „Contributions to the theory of statistical estimation and testing hypotheses“, in: Annals of Mathematical Statistics 10, S. 299–326.
Weber, Alfred (1909): Reine Theorie des Standorts, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Weber, Alfred (1935): Kulturgeschichte als Kultursoziologie, Leiden: A. W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij.
Weber, Max (1921): Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Theodor Kroyer, München: Drei Masken Verlag. [Aus dem Nachlass herausgegeben.]
Weber, Max (1968a [1913]): „Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie“, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (1922), 3. Aufl., Tübingen: J.C.B. Mohr, S. 427–474.
Weber, Max (1968b [1921]): „Soziologische Grundbegriffe“, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (1922), 3. Aufl., Tübingen: J.C.B. Mohr, S. 541–581.
Weber, Max (1968c [1922]): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 3. Aufl., Tübingen: J.C.B. Mohr.
Weber, Max (1972a [1904/05]): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, 6., photomech. gedr. Aufl. [der Ausgabe 1920], Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 17–206.
Weber, Max (1972b [1916]): Einleitung in die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, in: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, 6., photomech. gedr. Aufl. [der Ausgabe 1920], Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 237–275.
Wiese, Leopold von (1923–1928): Allgemeine Soziologie als Lehre von den Beziehungsbedingungen der Menschen, 2 Bde., Teilband 1: Beziehungslehre, 1924, Teilband 2: Gebildelehre, 1928, München: Duncker & Humblot. [Zweite überarbeitete Aufl. in einem Band: System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre), München/Leipzig: Duncker & Humblot 1933.]
Wieser, Friedrich von (1919): Österreichs Ende, Berlin: Ullstein & Co.
Wieser, Friedrich (1924 [1914]): Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, 2. Aufl., Tübingen: J.C.B. Mohr.
Winkler, Wilhelm (1931–1933): Grundriß der Statistik, Bd. 1 und 2, Berlin: Springer. [2., umgearb. Aufl. Wien 1947–1948.]
Wittgenstein, Ludwig (1977): Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlass, hrsg. von Georg Henrik von Wright unter Mitarbeit von Heikki Nyman, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Wundt, Wilhelm (1892): Ethik. Eine Untersuchung der Thatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens, 2. Aufl., Stuttgart: Ferdinand Enke.
Žižek, Franz (1912): Soziologie und Statistik, München/Leipzig: Duncker & Humblot.
Žižek, Franz (1921): Grundriß der Statistik, München: Duncker & Humblot.
Zweerde, Evert van der (1997): Soviet Historiography of Philosophy. Istoriko-Filosofskaja Nauka, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2022 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Acham, K. (2022). Einleitung: Einige Bemerkungen zu Gegenstand, Methode und Erkenntnisinteressen der deutschsprachigen Soziologie der Zwischenkriegszeit. In: Acham, K., Moebius, S. (eds) Soziologie der Zwischenkriegszeit. Ihre Hauptströmungen und zentralen Themen im deutschen Sprachraum. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31401-9_1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31401-9_1
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-31400-2
Online ISBN: 978-3-658-31401-9
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)