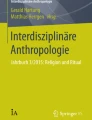Zusammenfassung
Ausgehend von der Differenzierung zwischen Selbstoptimierung und historisch wie systematisch anderen Praktiken der Menschenverbesserung sowie ihrer jeweils zugrund liegenden Selbstverständnisse der technischen Perfektionierbarkeit und der perfectibilité, d. h. der Bildsamkeit, Unbestimmtheit und Zukunftsoffenheit des Menschen, wird der utopische bzw. messianische Zukunftsbezug beider Perspektiven problematisiert. Statt – wie im technologieorientierten Transhumanismus – die Kontingenz der Zukunft abzuschaffen, die natürliche Bedingtheit des Menschen technisch zu supplementieren und die Evolution selbst zu perfektionieren, setzt sich der philosophische Posthumanismus für ein Offenhalten der Zukunft und ein Anderswerden des Menschen durch Überwindung seines Anthropozentrismus ein. Gezeigt wird, dass dies nur durch eine radikale Öffnung des Zukunftsbezugs möglich wird, durch eine Messianizität ohne Messianismus, die die eschatologischen Grundströmungen entkräften kann, die noch die Moderne durchziehen und die Zukunft verschließen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
„Das Subjekt hat […] immer eine antizipierte Beziehung zu seiner eigenen Verwirklichung, die es selbst auf die Ebene einer tiefen Unzulänglichkeit zurückwirft, und bei sich von einem Sprung zeugt, von einer ursprünglichen Zerrissenheit, einer Verfallenheit […]. Darin manifestiert sich in allen seinen imaginären Beziehungen eine Todeserfahrung. Eine Erfahrung, die ohne Zweifel konstitutiv ist für sämtliche Manifestationen des Menschseins“ (Lacan, 1980, S. 66 f.; vgl. auch Kamper, 1986, S. 72–93).
- 2.
Diese Differenz wäre genauer zu analysieren, und zwar nicht nur, weil sich schon aktuell z. B. in der Schule Probleme im Umgang mit pharmazeutischen Optimierungen der Leistungen zeigen (Schäfer, 2015), sondern weil der Gegensatz zwischen äußerlicher Technik und autonomer Selbsttätigkeit im modernen Diskurs der Pädagogik schon lange selbst wirksam und nicht erst jetzt entstanden ist. Man kennt die in vieler Hinsicht homologe Problematik z. B. aus den Diskursen um das Verhältnis zwischen individueller Bildung und schulischer Leistungsanforderung, überhaupt zwischen (von außen veranlasster) Erziehung und (eigenaktiver und selbsttätiger) Bildung. Erziehung und Bildung können daher nicht mehr als bloß moralisch-geistig ausgerichtete Veranstaltungen angesehen werden, die im Gegensatz zu technischen Maßnahmen und Körperpraktiken als vermeintlich bloß äußerlichen Mitteln stünden, da es keine pädagogische Interaktion gibt, die ohne sie stattfinden könnte. Und nicht nur pädagogische Prozesse, sondern auch die Subjektwerdung ist gekennzeichnet durch eine originäre Technizität wie z. B. die Alphabetisierung. Der pädagogische Glaube, die ‚Natur‘ des Menschen nur geistig-moralisch zur Vernunft bringen und vervollkommnen zu müssen und das auch zu können, war von Anfang an ein Irrtum. Zwar sind die heutigen Möglichkeiten des Human Enhancement vermeintlich primär technologischer Natur, doch dies nicht mehr als das Lesen und Schreiben Lernen, das wie erstere als Selbsttechnologie Subjektivationswirkungen hat, für die Entstehung von Wahrnehmung und Gedächtnis konstitutiv ist und eminent geistig-moralische Formierungskraft entfaltet.
- 3.
Hinsichtlich der biotechnologischen Möglichkeiten hat diese Problematik der Umstellung vom Zufallsprinzip auf Optionsmöglichkeiten bekanntlich eine heftige und bis heute andauernde Diskussion zwischen Biokonservativen und Bioliberalen um die menschliche Natur und die Ethik der Reproduktionsmedizin ausgelöst (vgl. Habermas, 2001; Woyke, 2010).
- 4.
Zum Verhältnis zwischen Tiefenzeit (geologische Zeitdimension) und Microzeit (elektronische Zeitdimension), die das menschliche Fassungsvermögen übersteigen oder unterlaufen, vgl. die Beiträge in Balke et al. (2018).
- 5.
Zu nennen wären z. B. der Kölner Kongress im März 2019 „Erzählen, Sound. Öffentlichkeit“, der „Global Solutions Summit“ im März 2019 in Berlin, die DGS-Regionalkonferenz im September 2019 an der Universität Jena zum Thema „Great Transformation: Die Zukunft moderner Gesellschaften“, die auch im September 2019 von der EERA (European Educational Research Association) und der DGfE an der Uni Hamburg veranstaltete Konferenz „Education in an Era of Risk. The Role of Educational Research for the Future“.
- 6.
- 7.
Die Konsequenzen dieser Abschließung in einer absoluten Gegenwart beschreibt Marcus Quent (2016, S. 7, Herv. i. O.) eindrücklich als Verabsolutierung des Jetzt, als „Eindruck, die eigene Gegenwart sei unfassbar und ein eingreifendes Handeln, das qualitative Veränderungen provoziert, unmöglich geworden […]. Die Zementierung der Gegenwart und das Verschwinden von Gegenwart fallen heute ineinander“.
- 8.
Ich möchte betonen, dass es sich nicht um einen einfachen Gegensatz oder eine schlichte Fortsetzung der überkommenen Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften handelt (Snow, 1998). Die Differenzen zwischen den Positionen liegen auf anderen Ebenen, die hier so wenig berücksichtigt werden können wie die Berührungspunkte. Zwar ließen sich die Positionen schematisch kontrastieren (Änderung des Selbstverständnisses/des biologischen Menschen, Bildung/Optimierung, perfectibilité/Perfektionierung, Gleichheit/elitärer Individualismus, Verbesserung/Ersetzung, ethisch/technisch), doch werden nicht nur die Begriffe und ihre Relationen jeweils verschieden interpretiert, die Schematisierung in eine duale Oppositionslogik selbst wird von kritischen Posthumanisten abgelehnt. Kurz, der mögliche Eindruck, es handele sich um schlicht gegensätzliche Positionen, ist primär der hier notwendig knappen Darstellung geschuldet.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
Literatur
Ach, J. S., & Pollmann, A. (Hrsg.). (2006). no body is perfect. Baumaßnahmen am menschlichen Körper – Bioethische und ästhetische Aufrisse. transcript.
Alloa, E. (2018). Berechenbare Zukunft. Eine Kritik der algorithmischen Prognostik. In E. Angehrn & J. Küchenhoff (Hrsg.), Erwartung. Zukunft zwischen Furcht und Hoffnung (S. 15–34). Velbrück Wissenschaft.
Altner, G. (1998). Leben in der Hand des Menschen. Die Brisanz des biotechnischen Fortschritts. Primus Verlag.
Anders, G. (1980). Die Antiquiertheit des Menschen (2 Bde.). C. H. Beck.
Arendt, H. (1981). Vita activa oder Vom tätigen Leben. Piper.
Balke, F., Siegert, B., & Vogl, J. (Hrsg.). (2018). Mikrozeit und Tiefenzeit. Archiv für Medien Geschichte. Fink.
Baudrillard, J. (1994). Überleben und Unsterblichkeit. In D. Kamper & C. Wulf (Hrsg.), Anthropologie nach dem Tode des Menschen (S. 334–356). Suhrkamp.
Becker, J., Bühler, B., Pravica, S., & Willer, S. (Hrsg.). (2019). Zukunftssicherung. transcript.
Benedikter, R. (2015). 2014: Drei Schritte zum „Transhumanismus“. Telopolis. https://www.heise.de/tp/features/2014-Drei-Schritte-zum-Transhumanismus-3369401.html?view=print. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Bielik-Robson, A. (2018). The Merrano God. Abstraction, Messianicity, and Retreat in Derrida’s „Faith and Knowledge“. Religions, Special Issue. The Marrano Phenomenon. Jewish ‘Hidden Tradition’ and Modernity. https://www.academia.edu/38218254/The_Marrano_God_Abstraction_Messianicity_and_Retreat_in_Derrida_s_Faith_and_Knowledge_?auto=download&campaign=weekly_digest. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Boelderl, A. R., & Leisch-Kiesl. M. (Hrsg.). (2018). „Die Zukunft gehört den Phantomen“. Kunst und Politik nach Derrida. transcript.
Bostrom, N. (2008/2010). Letter from Utopia. Studies in Ethics, Law, and Technology, 2(1), 1–7. https://nickbostrom.com/utopia.html. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Bostrom, N. (2018). Die Zukunft der Menschheit. Aufsätze. Suhrkamp.
Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Polity.
Butler, J. (2001). Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Suhrkamp.
Clarke, B. (2008). Posthuman Metamorphosis. Narrative and Systems. Fordham University Press.
Clay, E. (2012). Transhumanism and the orthodox christian tradition. In H. Tirosh-Samuelson & K. L. Mossman (Hrsg.), Building better humans? (S. 157–180). Suhrkamp.
Coenen, C. (2010). Zum mythischen Kontext der Debatte über Human Enhancement. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 63–90). transcript.
Coenen, C., Gammel, S., Heil, R., & Woyke, A. (Hrsg.). (2010). Die Debatte über „Human Enhancement“. transcript.
Davis, E. (1998). Techgnosis. Myth, magic + mysticism in the age. Three Rivers Press.
Degele, N. (2004). Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. VS Verlag.
Derrida, J. (1995). Marx’ Gespenster. Suhrkamp.
Derrida, J. (1999). Bemerkungen zu Dekonstruktion und Pragmatismus. In C. Mouffe & S. Critchley (Hrsg.), Dekonstruktion und Pragmatismus. Demokratie, Wahrheit und Vernunft (S. 171–195). Passagen Verlag.
Derrida, J. (2000). Politik der Freundschaft. Suhrkamp.
Derrida, J. (2001). Glaube und Wissen. Die beiden Quellen der „Religion“ an den Grenzen der bloßen Vernunft. In J. Derrida & G. Vattimo (Hrsg.), Die Religion (S. 9–106). Suhrkamp.
Derrida, J. (2003). Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen. Merve.
Derrida, J. (2004). Marx & Sons. Suhrkamp.
Derrida, J. (2006). Das Schreibmaschinenband. Limited Ink II. In J. Derrida, Maschinen Papier. Das Schreibmaschinenband und andere Antworten (S. 35–138). Passagen Verlag.
Derrida, J. (2011). Politik und Freundschaft. Gespräch über Marx und Althusser. Passagen Verlag.
Derrida, J. (2018). Was tun – mit der Frage „Was tun“? Turia + Kant.
Dinerstein, J. (2006). Technology and its discontents. On the verge of the posthuman. American Quarterly, 58, 569–595.
Duttweiler, S., Gugutzer, R., Passoth, J.-H., & Strübing, J. (Hrsg.). (2016). Leben nach Zahlen. Self-Tracking als Optimierungsprojekt? transcript.
Ferrando, F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms. Differences and Relations. Existenz, 8(2), 26–32.
Ferrari, A. (2010). Die Verbesserung der Natur in der Vision konvergierender Technologien. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke, (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 287–306). transcript.
Flatscher, M. (2018). Derridas „Politik der Alterität“. Zur normativen Dimension des Kommenden. In A. R. Boelderl & M. Leisch-Kiesl (Hrsg.), „Die Zukunft gehört den Phantomen“. Kunst und Politik nach Derrida (S. 305–334). transcript.
Foucault, M. (1974). Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Suhrkamp.
Gammel, S. (2010). Narrative Elemente der Science-Fiction in gegenwärtigen Visionen von der Verbesserung des Menschen im Kontext konvergierender Technologien. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke, (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 209–234). transcript.
Gane, N., & Haraway, D. (2006). When we have never been human, what is to be done? Interview with Donna Haraway. Theory Culture Society, 23, 135–158.
Habermas, J. (2001). Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Suhrkamp.
Hägglund, M. (2008). Radical Atheism. Derrida and the Time of Life. Stanford University Press.
Halberstram, J., & Livingston, I. (1995). Introduction. Posthuman Bodies. In J. Halberstram & I. Livingston (Hrsg.), Posthuman Bodies (S. 1–22). Indiana University Press.
Handel, L. (2018). Ontomedialität. Eine medienphilosophische Perspektive auf die aktuelle Neuverhandlung der Ontologie. transcript.
Harari, Y. N. (2017). Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. C. H. Beck.
Haraway, D. J. (1995). Ein Manifest für Cyborgs. In C. Hammer & D. J. Haraway, Die Neuerfindung der Natur (S. 33–72). Campus.
Haraway, D. J. (2018). Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän. Campus.
Hauskeller, M. (2014). Utopie. In R. Ranisch & S. L. Sorgner (Hrsg.), Post- and Transhumanism. An Introduction (S. 101–108). Suhrkamp.
Hayles, N. K. (1999). How We Became Posthuman. University of Chicago Press.
Heil, R. (2010). Human Enhancement – Eine Motivsuche bei J. D. Bernal, J. B. S. Haldane und J. S. Huxley. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 41–62). transcript.
Herbrechter, S. (2009). Posthumanismus. Eine kritische Einführung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Herrmann, B. (2018). Über den Menschen als Kunstwerk. Zu einer Archäologie des (Post-)Humanen im Diskurs der Moderne (1750–1820). Fink.
Hornuff, D. (2019). Von der Zukunft erzählen. Deutschlandfunk. Essay und Diskurs vom 17.03.2019. https://www.deutschlandfunk.de/koelner-kongress-2019-von-der-zukunft-erzaehlen.1184.de.html?dram:article_id=440729. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Hughes, J. (2012). The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination, 1626–2030. Zygon. Journal of Religion & Science, 47(4), 757–776.
Jones, R. A. L. (2016). Against Transhumanism. The delusion of technological transcendence, self-published. http://www.softmachines.org/wordpress/?p=1772. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Kaminski, A. (2010). Psychotechnik und Intelligenzforschung 1903–1933. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke, (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 117–142). transcript.
Kamper, D. (1973). Geschichte und menschliche Natur. Die Tragweite gegenwärtiger Anthropologiekritik. Hanser.
Kamper, D. (1980). Die Auflösung der Ich-Identität. In F. A. Kittler (Hrsg.), Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften (S. 79–86). Schöningh/UTB.
Kamper, D. (1986). Zur Soziologie der Imagination. Carl Hanser.
Kamper, D. (2001). Horizontwechsel. Fink.
Kamper, D., & Wulf, C. (1987). Die Zeit, die bleibt. In D. Kamper & C. Wulf (Hrsg.), Die sterbende Zeit. Zwanzig Diagnosen (S. 7–12). Luchterhand.
Khurana, T. (2004). „…besser etwas geschieht“. Zum Ereignis bei Derrida. In M. Rölli (Hrsg.), Ereignis auf Französisch. Von Bergson bis Deleuze (S. 235–256). Fink.
King, V., & Gerisch, B. (Hrsg.). (2015). Perfektionierung und Destruktivität. Psychosozial Nr. 141, 38(3).
Koselleck, R. (1979). Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Suhrkamp.
Kurzweil, R. (1999). Homo S@piens. Leben im 21. Jahrhundert – Was bleibt vom Menschen? Econ-Taschenbuch.
Kurzweil, R. (2005). The singularity is near. Viking.
Kurzweil, R. (2014). Menschheit 2.0. Die Singularität naht. Lola Books.
Kushner, D. (2009). When man and machine merge. Rolling Stone, 1072, 57–61.
Lacan, J. (1980). Der Individualmythos des Neurotikers. Der Wunderblock. Zeitschrift für Psychoanalyse, 5(6), 50–68.
Lacan, J., & Haas, N. (1973). Schriften (Bd. I.). Walter.
Lanier, J. (2014). Wem gehört die Zukunft? Hoffmann und Campe.
Lynes, P. (2018). Futures of life death on earth. Derrida’s general ecology. Rowman & Littlefield International.
Metzger, S. (2018). Hat die Zukunft eine Zukunft? Über die Zurückeroberung eines Imaginationsraums. Deutschlandfunk, Essay und Diskurs vom 08. April. https://www.deutschlandfunk.de/hat-die-zukunft-eine-zukunft-ueber-die-zurueckeroberung.1184.de.html?dram:article_id=412392. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Möbius, T. (2010). Die Planbarkeit des Glücks – Dostojewskis Kritik des rationalistischen Menschenbildes der Utopie. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke, (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 91–114). transcript.
Moravec, H. (1988). Mind children. The future of robot and human intelligence. Harvard University Press.
Mossman, K. L. (2012). In Sickness and in Health. The (Fuzzy) Boundary between „Therapy“ and „Enhancement“. In H. Tirosh-Samuelson & K. L. Mossman (Hrsg.), Building Better Humans? Refocusing the Debate on Transhumanism (S. 229–254). Lang.
Neyrat, F. (2016). Besetzen der Zukunft. Zeit und Politik im Zeitalter der hellseherischen Gesellschaften. In S. Witzgal & K. Stakemaier (Hrsg), Die Gegenwart der Zukunft (S. 85–98). Diaphanes.
Paura, R. (2016). Singularity believers and the new utopia of transhumanism. Im@go. A Journal of the Social Imaginary 5(7), 23–55.
Pearce, D. (2007). The Hedonistic Imperative. https://www.hedweb.com/hedab.htm. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Pico della Mirandola, G. (1990). Über die Würde des Menschen (1486). Lateinisch-Deutsch. Meiner.
Portmann, A. (1965). Zoologie und das neue Bild des Menschen. Rowohlt.
Prisco G. (2012). Order of Cosmic Engineers, Turing Church. January 2. http://turingchurch.com/2012/01/02/order-of-cosmic-engineers/. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Prisco G. (2015). Don’t Worry, Intelligent Life Will Reverse the Slow Death of the Universe. IEET.org. August 13. http://ieet.org/index.php/IEET/more/prisco20150813. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Quent, M. (Hrsg.). (2016). Absolute Gegenwart. Merve.
Ranisch, R., & Sorgner, S. L. (Hrsg.). (2014). Post- and Transhumanism. Suhrkamp.
Rank, O. (1993). Der Doppelgänger. Eine psychoanalytische Studie. Turia + Kant.
Ravasi G. (2015). Uomo sull’orlo del futuro. Il Sole 24 Ore. 21. Giugno, n. 169, S. 32.
Roco, M. C., & Bainbridge, W. S. (Hrsg.). (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, National Science Foundation/DOC-sponsered Report. Kluwer.
Sandberg, A. (2013). Morphological Freedom – Why We Not Just Want It, But Need It. In M. More & N. Vita-More (Hrsg.), The Transhumanist Reader (S. 56–64). Wiley-Blackwell.
Schäfer, A. (2015). Schulische Leistungsdiskurse. Zwischen Gerechtigkeitsversprechen und pharmazeutischem Hirndoping. Schöningh/UTB.
Schenk, S., & Karcher, M. (Hrsg.). (2018). Überschreitungslogiken und die Grenzen des Humanen. (Neuro-)Enhancement – Kybernetik – Transhumanismus. Wittenberger Gespräche V. WG-Verlag.
Schirrmacher, F. (Hrsg.). (2015). Technologischer Totalitarismus. Eine Debatte. Suhrkamp.
Sieb, L. (2006). Die biotechnische Neuerfindung des Menschen. In J. S. Ach & A. Pollmann (Hrsg.), no body is perfect. Baumaßnahmen am menschlichen Körper – Bioethische und ästhetische Aufrisse (S. 21–42). transcript.
Sieben, A., Sabisch-Fechtelpeter, K., & Straub, J. (Hrsg.). (2012). Menschen machen. Die hellen und die dunklen Seiten humanwissenschaftlicher Optimierungsprogramme. transcript.
Snow, C. P. (1998). The Two Cultures. Cambridge University Press.
Sorgner, S. L., & Innerhofer, J. E. (2013). Hirnschrittmacher für alle! Ein Gespräch mit dem Philosophen Stefan Lorenz Sorgner. Zeit Online, http://www.zeit.de/2013/20/transhumanismus-philosoph-stefan-lorenz-sorgner. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Spreen, D. (2015). Upgradekultur. Der Körper in der Enhancement-Gesellschaft. transcript.
Spreen, D., Flessner, B., Hurka, H. M., & Rüster, J. (2018). Kritik des Transhumanismus. Über eine Ideologie der Optimierungsgesellschaft. transcript.
Stiegler, B. (2014). Licht und Schatten im digitalen Zeitalter. In R. Reichert (Hrsg), Big Data. Analysen zum digitalen Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie (S. 35–46). transcript.
Straub, J., Sabisch-Fechtelpeter, K., & Sieben, A. (2012). Homo modificans, homo modificatus. Ein Vorwort zu aktuellen „Optimierungen des Menschen“. In A. Sieben, K. Sabisch-Fechtelpeter, & J. Straub (Hrsg.), Menschen machen. Die hellen und die dunklen Seiten humanwissenschaftlicher Optimierungsprogramme (S. 9–25). transcript.
Sullivan, J. E. (2018). Transhumanism. Utopian Vision or Dystopian Future? https://www.academia.edu/37686332/Transhumanism. Zugegriffen: 28. Sept. 2020.
Tirosh-Samuelson, H. (2012a). Science and the Betterment of Humanity: Three British Prophets of Transhumanism. In H. Tirosh-Samuelson & K. L. Mossman (Hrsg.), Building better Humans? (S. 55–82). Suhrkamp.
Tirosh-Samuelson, H. (2012b). Transhumanism as a secularist faith. Zygon. Journal of Religion & Science, 47(4), 710–734.
Tirosh-Samuelson, H. (2014). Religion. In R. Ranisch & S. L. Sorgner (Hrsg.), Post- and Transhumanism. An Introduction (S. 49–72). Suhrkamp.
Villa, P.-I. (Hrsg.). (2008). schön normal. Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst. transcript.
Wagner, G. (2017). Selbstoptimierung. Praxis und Kritik von Neuroenhancement. Campus.
Wimmer, M. (2014). Zwischen Utopie und Pragmatismus. Zum Status und Wandel pädagogischer Zukunftsvorstellungen. In M. Wimmer, Pädagogik als Wissenschaft des Unmöglichen (S. 119–134). Schöningh.
Wimmer, M. (2019). Posthumanistische Pädagogik. Unterwegs zu einer poststrukturalistischen Erziehungswissenschaft. Schöningh.
Wolfe, C. (2010). What is Posthumanism? University of Minnesota Press.
Woyke, A. (2010). Human Enhancement und seine Bewertung – Eine kleine Skizze. In C. Coenen, S. Gammel, R. Heil, & A. Woyke, (Hrsg.), Die Debatte über „Human Enhancement“ (S. 21–38). transcript.
Zuboff, S. (2018). Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Campus.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2023 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Wimmer, M. (2023). Der unbedingte Mensch. Die Zukunft der Perfektionierung und die Perfektionierung der Zukunft. In: Heite, C., Henning, C., Magyar-Haas, V. (eds) Perfektionierung. Zürcher Begegnungen. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30384-6_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-30384-6_12
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-30383-9
Online ISBN: 978-3-658-30384-6
eBook Packages: Education and Social Work (German Language)