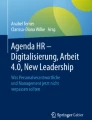Zusammenfassung
„New Work“ als zukunftsforscherische Kategorie: In diesem Artikel plädieren wir dafür, das Label aus dem trendorientierten Beratungsdiskurs herauszulösen und zu einem ökonomischen Grundbegriff zu qualifizieren, an dem sich ein Leitbild-Wechsel in Bezug auf unternehmerisch erbrachte Arbeit zeigen lässt. Im Vergleich mit der Ursprungsidee von New Work (Frithjof Bergmann) werden Unternehmensbeispiele aus Europa und den USA skizziert, um sowohl den Wandel des Konzepts zu verdeutlichen, als auch die soziokulturell jeweils unterschiedlichen Adaptionsweisen in den Ländern herauszustellen. Abschließend geht es um Bewertungen: Einerseits darum, worin die breite, kulturübergreifende Akzeptanz des Konzepts begründet liegt, und andererseits, wie es speziell aus europäischer Perspektive zu beurteilen ist bzw. welche Handlungsoptionen sich für uns abzeichnen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Hier in etymologisch korrekter Schreibweise verwendet. Antezipieren/vorwegnehmen, von lat. antecapio: ante = vor(her) und capere = nehmen (nicht: anti-zipieren im Sinne von etwas-entgegensetzen). Zum wissenschaftstheoretischen Hintergrund vgl. Müller-Friemauth und Kühn (2017, S. 188–204).
- 2.
Abduktion ist das für wissenschaftliche Zukunftsforschung zentrale logische Schlussverfahren, das aus der amerikanischen Erkenntnistheorie stammt (Charles Sanders Peirce) und – im Gegensatz zu Induktion und Deduktion – eine erkenntniserweiternde Funktion hat (vgl. Müller-Friemauth und Kühn 2016, S. 128–136).
- 3.
Begründung bei Facebook dafür von Mike Schroepfer, verantwortlich für die globalen Server-Farmen des Unternehmens direkt unter Marc Zuckerberg: „Hier sieht es bewusst unfertig aus, denn unser Job in der Welt ist unfertig. Wir brauchen kein Denkmal und kein Museum, das Meiste, was wir schaffen wollen, liegt noch vor uns.“ (Andersen und Kleber 2016).
- 4.
Logischerweise – denn Bergmanns Konzept steht in marxistischer Tradition. „Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert: …“ – in dieser berühmten Passage eines Artikels über eine Schrift von James Mill formulierte Marx seine Utopie von nicht-entfremdeter Arbeit („Meine Arbeit wäre freie Lebensäußerung, daher Genuss des Lebens“). Vgl. Marx (1981, S. 462 f.).
- 5.
- 6.
Ein ursprünglich hegelianisches Motiv (Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit).
- 7.
Ist Komplexitätsbewältigung nicht möglich (Kompetenzdefizite auch und gerade in akademisierten Milieus), unerwünscht oder zu anstrengend, liegt ein Reaktionsmuster in der Devise „Zurück in die Vergangenheit“. Diesen Schlachtruf nutzt die populistische Rechte – mit Erfolg in der gesamten westlichen Welt.
- 8.
Bereits die Gegenüberstellung von „neuer“ und „alter“ westlicher Welt, auf die wir uns hier beschränkt haben, ist heute nur noch bedingt legitim, weil sie zahlreiche einschlägige Aspekte soziokultureller Innovationsspezifika außer Acht lässt. Die globale Exzellenz – und das heißt vor allem innovationsgetriebene Unternehmensentwicklung – spielt auf inzwischen äußerst professionelle Weise mit den jeweiligen soziokulturellen Profilen derjenigen Gesellschaften, in der die Innovationskultur steht. Zu einer ersten vorläufigen Schematisierung, die sich an den Unterscheidungen einerseits zwischen individualistischen und kollektivistischen Sozialstilen und andererseits zwischen unternehmensinternen, vornehmlich betriebswirtschaftlichen Innovationszielen („purpose driven“) versus umfeldbezogenen, gesellschaftlichen (social driven) Zielen orientiert, vgl. Müller-Friemauth und Kühn (2016, S. 136–153).
- 9.
Genauer: Gefühlt nehmen Entscheidungsspielräume (etwa durch Dashboards), die Autonomie der privaten Lebensführung (Entgrenzung von Arbeits- und Freizeit durch diverse Flexibilisierungen qua Job-Arten oder Zeitmodellen, holistische Lebensräume innerhalb moderner Unternehmensuniversen etc.) und Sinnangebote durch die Unternehmen (MTPs) zwar zu. Diese Regulierung von Freiheit „nach außen“, also in die unternehmensabgewandte, persönliche Sphäre des Einzelnen hinein, wird jedoch flankiert durch eine Regulierung auch „nach innen“, bei der es kein Entkommen mehr gibt vor einer alles umspannenden und anspruchsvollen Kennzahlen-Transparenz; vor einem Kommunikationszugriff, der sich auf bis zu 24h erstrecken kann; und vor einem, mitunter geradezu herkulisch anmutenden, Unternehmenszweck, der vom Mitarbeiter nahezu alles Menschenmögliche einfordern kann (und genau das funktional auch ermöglichen soll).
- 10.
Freilich als kognitiver Topos insbesondere bei Fragen des Wandels und Systemveränderungen kaum bekannt bzw. wissenschaftlich bearbeitet (vgl. Luhmann 1994). Unter anderem im Kontext früher arbeitsrechtlicher Debatten hatte sie einen hohen Stellenwert (Ernst Fraenkel etwa konzeptualisierte das Arbeitsrecht auf Basis eben dieser Gedankenfigur als Katalysator einer schrittweisen und friedlichen Umwandlung der sozialen Ordnung; vgl. Kühn 2000).
- 11.
Dafür gibt es genügend Beispiele. Ein besonders instruktives (nicht zuletzt deswegen, weil zahlreiche Politiker bzw. Minister in Deutschland bekennende Anhänger des Konzepts sind), ist der „New Deal on Data“ von Sandy Pentland, MIT-Wissenschaftler und Google-Berater: Ein verhaltensökonomisch speziell für den europäischen Markt fein justierter Vorschlag, auf Basis welcher Vereinbarungen Internetnutzer freigiebig mit ihren Daten umgehen können (Pentland 2014). Die Diskursstrategien speziell für Europäer werden an mehreren amerikanischen Universitäten gezielt entwickelt (und gut bezahlt): Das Wegbrechen europäischer Märkte aufgrund allzu großer normativer Diskrepanzen kann und will man sich nicht leisten.
- 12.
In Bezug auf New Work ist das inzwischen belegt. Hackl et al. haben (2017) in betriebswirtschaftlichem Kontext Ergebnisse zu diesem Themenkreis aus drei aktuellen Studien unter insgesamt 684 Mitarbeitern und 215 Führungskräften präsentiert. Etwas mehr als die Hälfte der Mitarbeiter fühlt sich in eher klassischen Arbeitsstrukturen wohl. New-Work-Apologeten sind vor allem Führungskräfte – Akademiker und gut Ausgebildete, die mit dem öffentlichen New-Work-Diskurs vertraut sind. Ein Missmatch zwischen ihnen und den Mitarbeitern liegt insbesondere bei den Faktoren „Beteiligung der Mitarbeiter an der Strategie“, „Selbstbestimmung/Zeit für eigene Projekte“ und „flexibler Wechsel zwischen Führungs- und Fachkarriere“ vor. Aus Mitarbeitersicht sind sie die wichtigsten (von insgesamt zwölf operationalisierten Stellhebeln); im Vergleich zu den übrigen Faktoren repräsentieren alle drei offen Machtfragen. – Die Vermutung, dass viele Arbeitnehmer instinktiv erfassen, dass mit New Work zwar viel moralischer Anspruch, aber entweder wenig oder unerwünschter realer Wandel in der individuellen Arbeits- und Lebensqualität im Unternehmen verhandelt wird, ist durch diese Ergebnisse zwar nicht im Einzelnen belegbar, mit Blick auf gesamtgesellschaftlich beobachtbare Reaktionen auf Modernisierungsprozesse, etwa im Wahlverhalten, oder Themen-Hypes wie Achtsamkeit, „Digital Detox“ und viele andere Verhaltenstrends, die allesamt Züge eines Rückzugshabitus aufweisen, aber naheliegend.
- 13.
Bekanntlich verhält sich insbesondere der Mittelstand zurückhaltend, was Digitalisierung betrifft (Deloitte 2017; ZEW Mannheim 2016; zu Konzernen vgl. Kawohl und Becker 2017). Interessanterweise wurden hier zwar zahlreiche Führungskräfte zu diesem Thema befragt. Gedacht und bewertet wird jedoch grundsätzlich anstelle bzw. anstatt der Befragten – durch die Studienautoren. Soll heißen: Als Ursachen und Gründe der Innovationsbarrieren deklariert werden Wissensdefizite seitens der Unternehmen (IT-Know-how, Geschäftsmodelle, Innovationsmethoden etc.), das Thema Datenschutz bzw. Datensicherheit (es fehlten praktikable technologische Lösungen) sowie Mängel in der Infrastruktur (geringe Übertragungsgeschwindigkeiten etc.) – empirisch exploriert wurden sie jedoch nicht. Mit Blick auf das mittelständische Unternehmensleitbild wäre jedoch erst zu prüfen, ob nicht die Skepsis gegenüber Digitalisierung auch (oder sogar weitgehend) zurückzuführen ist auf einen politischen Steuerungsmodus, der ohne Ansehung jeglichen Marktrahmens, Unternehmensbezugs und ökonomische Traditionen Digitalisierung als Pflichtaufgabe staatlich verordnet. – Subjektive Beobachtung und Wertung der Autoren: Dieses Staatsverhalten erzeugt bei vielen Unternehmern erhebliche Irritationen.
Literatur
Andersen, A., & Kleber, C. (2016). Schöne neue Welt. Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt. Film-Dokumentation 60 Min., Produktion ECO Media. https://www.youtube.com/watch?v=wtDLi4P6P_s. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
AugenhöheWege-Filme. (2015). Weiß. https://vimeo.com/157708354. Orange. https://vimeo.com/157724336. Zugegriffen: 2. Mai 2018.
Bergmann, F. (2005). Die Freiheit leben. Freiburg i. Br.: Arbor.
Bergmann, F. (2017) Neue Arbeit, Neue Kultur. Freiburg i. Br.: Arbor.
Coonradt, C. A. (2012). The game of work. Layton: Gibbs Smith.
Coonradt, C. A. (2013). Website von Game of Work. www.gameofwork.com. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
Deloitte. (2017). Datenland Deutschland. Renaissance der Innovation – Der Deloitte Innovation Survey. https://www2.deloitte.com/de/de/pages/trends/datenland-deutschland-renaissance-der-innovation.html. Zugegriffen: 25. Febr. 2018.
Hackl, B., Wagner, M., & Attmer, L. (2017). New Work – Auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt. Wiesbaden: Springer Gabler.
Hamel, G. (2011). First, let’s fire all the managers. Harvard Business Review, 90(10), 48–60.
Kawohl, J. M., & Becker, J. (2017). Unternehmergeist und Digitalkompetenz im Topmanagement. Verfügen deutsche Vorstände über die Zukunftsfähigkeiten, die die digitale Transformation erfordert? Eine Analyse der DAX- und MDAX-Konzerne. https://docs.wixstatic.com/ugd/63eb59_4465a197bb6f4f34b784c3c52e1456fb.pdf. Zugegriffen: 25. Febr. 2018.
Kühn, R. (2000). Die Schriften Ernst Fraenkels zur Weimarer Republik – Das Arbeitsrecht als Knoten und Katalysator. In H. Buchstein & G. Göhler (Hrsg.), Vom Sozialismus zum Pluralismus. Beiträge zu Werk und Leben Ernst Fraenkels (S. 9–28). Baden-Baden: Nomos.
Luhmann, N. (1994). Kapitalismus und Utopie. Merkur, 48(540), 189–198.
Marx, K. (1981) [1844]. Auszüge aus James Mills Buch „Élements d’économie politique“. In Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.), Karl Marx – Friedrich Engels – Werke [MEW] (Bd. 39, S. 443–463). Berlin: Dietz.
Morning Star. (2018). Colleague principles. http://morningstarco.com/index.cgi?Page=About%20Us/Colleague%20Principles. Zugegriffen: 2. Mai 2018.
Müller-Friemauth, F., & Kühn, R. (2016). Silicon Valley als unternehmerische Inspiration. Zukunft erforschen – Wagnisse eingehen – Organisationen entwickeln. Wiesbaden: Springer Gabler.
Müller-Friemauth, F., & Kühn, R. (2017). Ökonomische Zukunftsforschung. Grundlagen – Konzepte – Perspektiven. Wiesbaden: Springer Gabler.
Naß, M. (2018). Schleimen ist Chefsache: Kommentar zum Treffen in Davos. ZEIT Online, (erstellt 31. Januar). https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-01/donald-trump-davos-siemens-bayer-5vor8. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
Pentland, A. S. (2014). Alles wieder auf Null. Harvard Business Manager, 36(12), 76–81.
Piketty, T. (2016). Das Kapital im 21. Jahrhundert (8. Aufl.) München: Beck.
Ramge, T. (2015). Nicht fragen. Machen. Brand Eins, 17(3), 88–93.
Siciliano, J. (2018). Trump attracts big energy investment, tax reform admirers in Davos. https://www.washingtonexaminer.com/trump-attracts-big-energy-investment-tax-reform-admirers-in-davos. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
Täubner, M. (2015). Der Animateur. Brand Eins, 17(3), 104–109.
Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. New Haven: Yale University Press.
Werner, G. (2006). Hartz IV löst nur Leid aus. Interview in der TAZ vom 27. November. http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2006/11/27/a0146. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
Werner, G. (2011). Jeder ist wichtig. Interview im Spiegel vom 22. Februar. http://www.spiegel.de/spiegelwissen/a-763299.html. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
Werner, G. (8. Juni 2012). Geld ist Saatgut: Götz Werner im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Süddeutsche Zeitung. Zugegriffen: 08. Juni 2012.
XINGcom. (2017). NWX17 – Prof. Dr. Frithjof Bergmann auf der XING New Work Experience 2017. https://www.youtube.com/watch?v=29IoGFD86QM. Zugegriffen: 30. Mai 2018.
ZEW Mannheim. (2016). Digitalisierung im Mittelstand 2017. Status quo, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/Digitalisierung-im-Mittelstand.pdf. Zugegriffen: 25. Febr. 2018.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2019 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Müller-Friemauth, F., Kühn, R. (2019). New Work-Challenge – Die schöne neue Arbeitswelt aus zukunftsforscherischer Sicht. In: Hermeier, B., Heupel, T., Fichtner-Rosada, S. (eds) Arbeitswelten der Zukunft. FOM-Edition. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23397-6_21
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-23397-6_21
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-23396-9
Online ISBN: 978-3-658-23397-6
eBook Packages: Business and Economics (German Language)