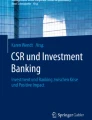Zusammenfassung
Was ist nachhaltige Finanzierung? Obwohl Nachhaltigkeitsexperten stolz auf ihre Errungenschaften sein können, befindet sich die Welt letztlich nicht auf einem nachhaltigen Entwicklungspfad. Es gibt mindestens drei Gründe, warum dies für die Finanzinstitute Anlass zur Sorge sein sollte: Erstens sind sie potenziell mit erheblichen Risiken konfrontiert. Zweitens, und das ist ebenso wichtig, sind sie immer noch mit vielen der Aktivitäten verbunden, die den Herausforderungen der Nachhaltigkeit zugrunde liegen. Sowohl Banken als auch Versicherer erbringen wesentliche Dienstleistungen, die solche Aktivitäten unterstützen und manchmal sogar erst ermöglichen – was dann wiederum zu Risiken für diese Finanzinstitute führt. Drittens gibt es eine bedeutende Einnahmequelle, die es zu nutzen gilt.
In diesem Papier wird dargelegt, dass die Entwicklung effektiverer nachhaltiger Finanzstrategien ein besseres Verständnis dessen erfordert, was nachhaltige Finanzen eigentlich bedeuten. Der Zweck dieses Papiers ist es daher, einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Komponenten der nachhaltigen Finanzwirtschaft zu geben. Insbesondere soll ein Rahmen geschaffen werden, der dem Leser hilft, besser zu verstehen, was nachhaltige Finanzen sein können. Darüber hinaus werden Taktiken vorgeschlagen, um effektivere Strategien für Finanzinstitute zu entwickeln, und es werden Fragen gestellt, die die akademische Forschung auf dem Gebiet der nachhaltigen Finanzen voranbringen sollen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
1991 wurde die Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) von den Vereinten Nationen und einer Gruppe von Finanzinstituten ins Leben gerufen. Sie veröffentlichten 1992 die UNEP-Erklärung der Banken zu Umwelt und nachhaltiger Entwicklung. Diese wurde zuletzt 2011 als UNEP-Verpflichtungserklärung der Finanzinstitute zur nachhaltigen Entwicklung aktualisiert. Die UNEP FI trug zur Einführung der Principles for Responsible Investment (PRI) im Jahr 2006 bei und entwickelte die Principles for Sustainable Insurance (PSI), die im Jahr 2012 eingeführt wurden.
- 2.
Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) entwickelte eine Reihe von Umwelt- und Sozialleistungsstandards, die schließlich zur Einführung der Äquator-Prinzipien führten, einem freiwilligen Rahmen für das Umwelt- und Sozialrisikomanagement bei projektbezogenen Transaktionen. Die Äquator-Prinzipien wurden von vielen Finanzinstituten übernommen.
- 3.
Siehe Fußnote 16.
- 4.
Im Jahr 2010 gründete eine Gruppe von Banken die Banking Environment Initiative (BEI), die vom University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) ins Leben gerufen wurde.
- 5.
Siehe zum Beispiel Haigh (2012).
- 6.
Siehe Unruh et al. (2016); der Bericht ist Teil einer MIT Sloan Management Review-Forschungsinitiative in Zusammenarbeit mit und gesponsert von The Boston Consulting Group.
- 7.
Siehe McKinsey (2016).
- 8.
Siehe zum Beispiel KPMG (2015).
- 9.
Siehe zum Beispiel WWF (2015).
- 10.
Siehe z. B. WWF und BankTrack (2006), wo auch die Collevecchio-Erklärung von 2003 erörtert wird, die „nach wie vor der Maßstab ist, an dem die Zivilgesellschaft das Engagement des Bankensektors für eine nachhaltige Entwicklung messen wird“.
- 11.
Die Fußnoten enthalten Vorschläge für weiterführende Literatur, um die Studierenden bei der Erforschung nachhaltiger Finanzen zu unterstützen.
- 12.
Dieser Absatz stammt aus dem Editorial der vierten Ausgabe des ECOFACT Quarterly (ECOFACT, 2013).
- 13.
Siehe z. B. Busch et al. (2015): Bei der Erörterung nachhaltiger Investitionen fragen die Autoren, „inwieweit die Finanzmärkte nachhaltigere Geschäftspraktiken fördern und erleichtern“. Sie kommen zu dem Schluss, dass „ihre derzeitige Rolle eher bescheiden ist“ und dass nachhaltige Investitionen „die nachhaltige Entwicklung nicht wirklich vorantreiben“.
- 14.
Siehe CISL und UNEP FI (2014).
- 15.
Die Basel-III-Rahmenregelung ist ein umfassendes Paket von Reformmaßnahmen, das vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht entwickelt wurde, um die Regulierung, die Aufsicht und das Risikomanagement des Bankensektors zu stärken. Der Basler Ausschuss ist der führende Standardsetzer für den Bankensektor. Siehe http://www.bis.org/bcbs/.
- 16.
Der PRA-Bericht war ein Faktor bei der Initiierung der Green Finance Study Group (GFSG) durch die G20 und der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) durch das Financial Stability Board (FSB). Sowohl die GFSG als auch die TCFD finden derzeit im Finanzsektor große Beachtung. Weitere Informationen darüber, wie die Finanzmarktregulierungsbehörden begonnen haben, sich mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, finden Sie in Alexander (2016).
- 17.
Rede von Mark Carney, gehalten am 29. September 2015: „Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate Change and Financial Stability“. Hervorhebungen von den Autoren hinzugefügt. Siehe http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/844.aspx.
- 18.
Zu den Vorgängen in den frühen Phasen der Entwicklung eines neuen Marktes siehe Geroski (2003).
- 19.
Eine bemerkenswerte Ausnahme in der Welt der Praktiker ist die UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System (UNEP Inquiry), die bewährte Praktiken, Finanzmarktpolitik und regulatorische Innovationen untersucht hat, die die Entwicklung eines „grünen Finanzsystems“ unterstützen würden. Einer der jüngsten Berichte, The Financial System We Need, „beschreibt eine ‚stille Revolution‘, da Nachhaltigkeitsfaktoren in die Regeln des Finanzsystems aufgenommen werden. (…) Beim Übergang von der Konzeption zur Umsetzung wird die Untersuchung die Ausweitung und den Austausch politischer Optionen unterstützen, neue kritische Forschungsbereiche vorantreiben und ihr nationales, regionales und internationales Engagement fortsetzen, um Nachhaltigkeit in der Finanzarchitektur zu verankern.“ Siehe http://web.unep.org/inquiry.
- 20.
[Erscheint demnächst].
- 21.
Siehe zum Beispiel McNeely (1997), der Mechanismen für eine nachhaltige Finanzierung von Schutzgebieten erörtert.
- 22.
Wir danken Dr. Benjamin Wilding, Geschäftsführender Direktor Finanzen und Lehre am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich, für die Durchsicht des Kapitels „Finanzverständnis“.
- 23.
Es gibt weitere umgangssprachliche Verwendungen des Begriffs „nachhaltig“, zum Beispiel im Zusammenhang mit „umweltfreundlichen“ oder „ethisch produzierten“ Produkten. Wir konzentrieren uns auf die beiden Verwendungen, die vor allem in wissenschaftlichen Arbeiten zu finden sind.
- 24.
Oxford Dictionaries. Oxford University Press. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sustainable.
- 25.
Oxford Dictionaries. Oxford University Press. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sustainability.
- 26.
Siehe zum Beispiel Costanza und Patten (1995).
- 27.
Siehe Meadows et al. (1972). Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „wenn die gegenwärtigen Wachstumstrends bei der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Erschöpfung der Ressourcen unverändert anhalten, die Grenzen des Wachstums auf diesem Planeten irgendwann innerhalb der nächsten 100 Jahre erreicht werden. Das wahrscheinlichste Ergebnis wird ein ziemlich plötzlicher und unkontrollierbarer Rückgang sowohl der Bevölkerung als auch der industriellen Kapazität sein“. Die Autoren stellen fest, dass es umso wahrscheinlicher ist, „einen Zustand ökologischer und wirtschaftlicher Stabilität zu schaffen, der weit in die Zukunft reicht, je früher die Menschheit beginnt, diese Wachstumstrends zu ändern“.
- 28.
Siehe Gómez-Baggethun und Naredo (2015) für eine Diskussion über die Entwicklung der Nachhaltigkeitspolitik seit der Veröffentlichung von „Grenzen des Wachstums“ und wie der Brundtland-Bericht „einen neuen Leitgedanken für die globale Umweltpolitik verfolgte“. Siehe Hopwood et al. (2005) für eine Klassifizierung und Kartierung von Trends im Denken über nachhaltige Entwicklung. Die Autoren sind der Ansicht, dass die nachhaltige Entwicklung „einen nützlichen Rahmen für die Debatte über die Entscheidungen, die die Menschheit treffen muss, bietet“.
- 29.
Siehe WCED (1987). In dem Bericht wird die Definition auf drei verschiedene Arten verwendet. Wir haben die Definition vom Anfang des zweiten Kapitels verwendet.
- 30.
Siehe z. B. Lant et al. (2008), die Ökosystemleistungen als unterstützende Funktionen (z. B. Bodenbildung), regulierende Funktionen (z. B. Wasserreinigung, Schädlingsbekämpfung), einige kulturelle Funktionen (z. B. ästhetische Bereicherung) und Versorgungsfunktionen (z. B. Fangfischerei, Brennholz) beschreiben.
- 31.
Siehe zum Beispiel Howarth (1997).
- 32.
So zum Beispiel die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, der Johannesburg-Gipfel für nachhaltige Entwicklung 2002, die UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung (Rio+20) in Rio de Janeiro 2012 und der UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung am Sitz der Vereinten Nationen 2015, auf dem die Ziele für nachhaltige Entwicklung offiziell verabschiedet wurden.
- 33.
Deshalb zielt dieser Artikel darauf ab, Strategien zu entwickeln, die es Finanzinstituten ermöglichen, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit effektiver anzugehen. Man könnte kritisieren, dass der Fokus auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu eng gefasst ist und ein negatives Verständnis dessen, was Nachhaltigkeit bedeuten könnte, widerspiegelt. Nichtsdestotrotz ist dieser Ansatz praktikabel und wahrscheinlich ausreichend, da er von der folgenden Annahme ausgeht: Wenn es der Menschheit gelingt, angemessen auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu reagieren, wird sie höchstwahrscheinlich automatisch einen nachhaltigen Entwicklungspfad einschlagen.
- 34.
Wir danken Dr. Benjamin Wilding, Geschäftsführender Direktor Finanzen und Lehre am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich, für die Durchsicht des Kapitels „Finanzverständnis“.
- 35.
Die oben kurz erwähnte bevorstehende Veröffentlichung wird eine quantitative Analyse dieser Beobachtung liefern.
- 36.
Nachhaltige Anlagestrategien konzentrieren sich nicht nur auf Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, sondern auch auf solche, die von anderen Organisationen, wie Gemeinden und staatlichen Stellen, ausgegeben werden. Darüber hinaus umfassen solche Strategien mehrere Anlageklassen, die von nachhaltigen Immobilien bis zu Mikrofinanzierungen reichen.
- 37.
Dies gilt sowohl für Banken als auch für Versicherer. Diese Aussage stammt aus einem Bericht des CRO-Forums, einer Denkfabrik für Risikomanagement, die hauptsächlich europäische multinationale Versicherungsunternehmen vertritt (CRO-Forum, 2010).
- 38.
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das Geschäft mit Firmenkunden, da die Finanzinstitute hier am direktesten mit den Unternehmen verbunden sind, die die Ursache für die Nachhaltigkeitsprobleme sind. Umgekehrt können auch Firmenkunden über die Mittel verfügen, um Nachhaltigkeitsprobleme anzugehen.
- 39.
Für den Bankensektor wurden die Geschäftsbereiche aus der beispielhaften Zuordnung von Geschäftsbereichen abgeleitet, die der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 2001 in einem Konsultationspapier vorgelegt hat (BCBS, 2001). Für Versicherungen sind die Geschäftsbereiche aus der oben erwähnten Veröffentlichung des CRO-Forums abgeleitet (CRO-Forum, 2010).
- 40.
Eine Ausnahme bildet die Arbeit der Banking Environment Initiative (BEI) an einem nachhaltigen Versandakkreditiv, die darauf abzielt, Lösungen zur Integration von „Nachhaltigkeitsstandards für einzelne Waren […] in Akkreditive“ zu schaffen; siehe CPSL (2014).
- 41.
Für eine Einführung in die Finanzprodukte und -dienstleistungen, die im internationalen Handel verwendet werden, siehe beispielsweise (Platt, o. J.).
- 42.
Dieser Absatz ist von Jaeggi (2013) abgeleitet.
- 43.
Siehe Abschn. „Ein zweites Verständnis taucht auf“.
- 44.
- 45.
So zum Beispiel Naifar (2014), der den Begriff „nachhaltig“ in seiner traditionellen Bedeutung verwendet, wenn er Ansätze für ein „nachhaltigeres Finanzsystem“ erörtert, oder Anderson (2015), der die Rolle der Banken in Gesellschaft und Wirtschaft untersucht, ohne auf die hier erörterten Herausforderungen der Nachhaltigkeit einzugehen.
- 46.
Siehe zum Beispiel Jaeggi und Webber Ziero (2016). Obwohl in diesem Artikel die regulatorischen Erwartungen der Anleger erörtert werden, gelten dieselben Erwartungen auch für alle anderen Geschäftsbereiche, in denen es direkte Beziehungen zwischen Finanzinstituten und Kunden gibt.
- 47.
Auch Finanzinstitute kaufen Waren von Unternehmen ein. Obwohl die Lieferanten häufig in das Nachhaltigkeitsmanagement eines Finanzinstituts einbezogen sind, sind die Lieferantenbeziehungen in der Regel kein Element des nachhaltigen Finanzwesens, da (a) Finanzinstitute Lieferantenbeziehungen haben, die mit denen anderer Branchen vergleichbar sind, und (b) die Beziehungen nicht durch Finanzprodukte oder -dienstleistungen geprägt sind.
- 48.
Dies gilt auch für Finanzinstitute, aber der Schwerpunkt des nachhaltigen Finanzwesens liegt auf den positiven und negativen Auswirkungen, mit denen Finanzinstitute durch ihre eigenen Investitionen und die Finanzprodukte und -dienstleistungen, die sie ihren Kunden anbieten, verbunden sein können.
- 49.
Jaeggi et al. (2015) konzentrieren sich auf Investmentbanken. Für die Zwecke dieses Artikels wurden die Konzepte und Formulierungen so angepasst, dass sie auch für andere Geschäftszweige gelten. Einige der folgenden Absätze in diesem Abschnitt sind ebenfalls aus diesem Artikel abgeleitet.
- 50.
Bei der Arbeit mit Firmenkunden im Bank- und Versicherungswesen werden Governance-Themen im Gegensatz zur Vermögensverwaltung und Anlageberatung traditionell im Rahmen der Compliance (z. B. Geldwäsche), im Risikomanagement (z. B. Corporate Governance) oder in politischen Risikoteams (z. B. Krisenpotential) beurteilt. Folglich ist, zumindest im Bankwesen, der Begriff E&S immer noch gebräuchlicher (wie in „environmental and social risk management“).
- 51.
- 52.
- 53.
Siehe Credit Suisse et al. (2014).
- 54.
- 55.
- 56.
Siehe International Finance Corporation (2011).
- 57.
Die Credit Suisse hat beispielsweise mit mehreren Partnern an der Gestaltung eines Marktes gearbeitet, der Investitionen in den Naturschutz erleichtert, siehe Credit Suisse et al. (2014) und Credit Suisse und McKinsey (2016). Vor etwa einem Jahrzehnt hatte die Credit Suisse eine ähnliche Rolle als Marktinnovator, als sie dazu beitrug, Anlegern den Zugang zu Mikrofinanzmärkten zu ermöglichen.
- 58.
Das Engagement steht auch im Einklang mit den aktuellen Ansätzen zur Bewältigung von Menschenrechtsrisiken. Ein Paradigmenwechsel, den die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte mit sich brachten, besteht darin, dass sich ein Unternehmen nicht einfach von einem Geschäftspartner abwenden sollte, wenn es feststellt, dass dieser in Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist. Stattdessen wird von dem Unternehmen erwartet, dass es zunächst versucht, zur Verbesserung der Situation beizutragen und gegebenenfalls seinen Einfluss zu verstärken, indem es sich beispielsweise mit anderen Unternehmen und Aufsichtsbehörden zusammenschließt. Siehe Menschenrechtsrat (2011) und Jaeggi (2014).
- 59.
Internetquellen: Alle Internetquellen in diesem Dokument wurden im September 2016 aufgerufen.
Literatur
Internetquellen: Alle Internetquellen in diesem Dokument wurden im September 2016 aufgerufen.
Alexander, K. (2016). Greening banking policy. G20 Green Finance Study Group.
Anderson, R. W. (2015). Doing the right thing: The role of banks in society and the economy. Systemic Risk Centre, London School of Economics, Centre for Economic Policy Research (CEPR).
BCBS. (2001). Consultative document: Operational risk – Supporting document to the new Basel capital accord. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS); Bank for International Settlement (BIS).
Berkey, J. (2016). Sustainability legal pressure points for financial services. http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/Sustainability_Legal_Pressure_Points_Judson_Berkey_Mar16.pdf
Busch, T., Bauer, R., & Orlitzky, M. (2015). Sustainable development and financial markets: Old paths and new avenues. Business & Society, 55(3), 303–329.
CISL, & UNEP FI. (2014). Sustainability in banking reform: Are environmental risks missing in Basel III? Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), University of Cambridge.
Costanza, R., & Patten, B. C. (1995). Defining and predicting sustainability. Ecological Economics, 15, 193–196.
CPSL. (2014). The BEI’s sustainable shipment letter of credit – A financing solution to incentivise sustainable commodity trade. University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL), University of Cambridge.
Credit Suisse, & McKinsey. (2016). Conservation finance – From Niche to mainstream: The building of an institutional asset class.
Credit Suisse, WWF, & McKinsey. (2014). Conservation finance: Moving beyond donor funding toward an investor-driven approach.
CRO Forum. (2010). Recommendations for managing environmental, social and ethical challenges in business transactions.
Crutzen, P. J. (2002, January). Geology of mankind. Nature, 415, 23.
Crutzen, P. J., & Steffen, W. (2003). How long have we been in the Anthropocene era. Climatic Change, 61(3), 251–257.
Diamond, A. M., Jr. (2006). Schumpeter’s creative destruction: A review of the evidence. Journal of Private Enterprise, XXII(1), 120–146.
ECOFACT. (2013). The ECOFACT Quarterly (Issue 4). Zurich.
Geroski, P. A. (2003). The evolution of new markets. Oxford University Press.
Gómez-Baggethun, E., & Naredo, J. M. (2015). In search of lost time: The rise and fall of limits to growth. Sustainability Science, 10, 385–395.
Haigh, M. (2012). Publishing and defining sustainable finance and investment. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2, 88–94.
Haines-Young, R., Potschin, M., & Chesire, D. (2006). Defining and identifying environmental limits for sustainable development. A scoping study. Final overview report to Defra (Project Code NR0102). University of Nottingham, Centre for Environmental Management, Nottingham.
Hopwood, B., Mellor, M., & O’Brien, G. (2005). Sustainable development: Mapping different approaches. Sustainable Development, 13, 38–52.
Howarth, R. B. (1997). Defining sustainability: An overview. Land Economics, 73, 445–447.
Human Rights Council. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (A/HRC/17/31).
International Finance Corporation. (2011). Strengthening access to finance for women-owned SMEs in developing countries. IFC.
Jaeggi, O. (2013). The insurance industry’s renewed commitment to sustainability. http://sloanreview.mit.edu/article/the-insurance-industrys-renewed-commitment-to-sustainability/
Jaeggi, O. (2014). Human rights: The next frontier. http://sloanreview.mit.edu/article/human-rights-the-next-frontier/
Jaeggi, O., & Santos, G. (2015). Closing the trade finance sustainability gap. http://sloanreview.mit.edu/article/the-insurance-industrys-renewed-commitment-to-sustainability/
Jaeggi, O., & Webber Ziero, G. (2016). What new OECD standards mean for investors. http://sloanreview.mit.edu/article/investors-required-by-oecd-to-broaden-due-diligence/
Jaeggi, O., Kruschwitz, N., & Manjarin, R. (2015). The case for environmental and social risk management in investment banking. In K. Wendt (Hrsg.), Responsible investment banking (S. 535–543). Springer International Publishing.
Jerneck, A., Olsson, L., Ness, B., Anderberg, S., Baier, M., Clark, E., et al. (2011). Structuring sustainability science. Sustainability Science, 6, 69–82.
KPMG. (2015). Ready or not – An assessment of sustainability integration in the European banking sector.
Lant, C. L., Ruhl, J. B., & Kraft, S. E. (2008). The tragedy of ecosystem services. BioScience, 58(10), 969–974.
McKinsey. (2016). Sustaining sustainability: What institutional investors should do next on ESG.
McNeely, J. A. (1997). Sustainable finance for protected areas. Presented at the “Protected Areas in the 21st Century: From Islands to Networks” conference, Albany, Western Australia, 24–28 November 1997.
Meadows, D. L., Meadows, D. H., Randers, J., & Behrens, W. W. III (1972). The limits to growth – A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind (5th printing). Universe Books.
Naifar, N. (2014). Credit default sharing instead of credit default swaps: Toward a more sustainable financial system. Journal of Economic Issues, XLVIII(1), 1–17.
OECD/IEA. (2015). World energy investment outlook. OECD.
Perelman, M. (1995). Schumpeter, David Wells, and creative destruction. Journal of Economic Perspectives, 9(3), 189–197.
Platt, G. (Hrsg.). (o.J.). The guide to the finance of international trade. HSBC Trade Services, Marine Midland Bank & The Journal of Commerce.
Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4, 155–169.
Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F., et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472–475.
UNCTAD. (2014). World investment report 2014: Investing in the SDGs: An action plan. UNCTAD.
Unruh, G., Kiron, D., Kruschwitz, N., Reeves, M., Rubel, H., & Zum Felde, A. M. (2016). Investing for a sustainable future. MIT Sloan Management Review.
WCED. (1987). Report of the world commission on environment and development: Our common future. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
World Economic Forum. (2016). Long-term investing, infrastructure and development.
WWF. (2015). Financial market regulation for sustainable development in the BRICS countries.
WWF, & BankTrack. (2006). Shaping the future of sustainable finance – Moving from paper promises to performance.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Nature Switzerland AG
About this chapter
Cite this chapter
Jaeggi, O., Webber Ziero, G., Tobin-de la Puente, J., Kölbel, J.F. (2023). Nachhaltige Finanzen verstehen. In: Wendt, K. (eds) Positives Impact Investing. Springer Gabler, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31297-7_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31297-7_3
Published:
Publisher Name: Springer Gabler, Cham
Print ISBN: 978-3-031-31296-0
Online ISBN: 978-3-031-31297-7
eBook Packages: Business and Economics (German Language)