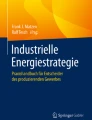Zusammenfassung
Für die im Verbundprojekt Energieeffiziente Auslegung und Planung dezentraler Versorgungsnetze zum Heizen und Kühlen von Stadtquartieren unter Nutzung des oberflächennahen geologischen Raumes (EASyQuart) durchgeführten Untersuchungen, Validierungen und Realmessungen wurden eine Reihe von Standorten und -modellen verwendet. Mit der Einschränkung, dass kein einheitliches Gesamtmodell für die Durchführung aller Vorhaben an einem Standort zur Verfügung stand, wurden für die jeweiligen Anwendungsfälle spezifische Bezugspunkte genutzt.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Für die im Verbundprojekt Energieeffiziente Auslegung und Planung dezentraler Versorgungsnetze zum Heizen und Kühlen von Stadtquartieren unter Nutzung des oberflächennahen geologischen Raumes (EASyQuart) durchgeführten Untersuchungen, Validierungen und Realmessungen wurden eine Reihe von Standorten und -modellen verwendet. Mit der Einschränkung, dass kein einheitliches Gesamtmodell für die Durchführung aller Vorhaben an einem Standort zur Verfügung stand, wurden für die jeweiligen Anwendungsfälle spezifische Bezugspunkte genutzt. Für einzelne Modelle konnten überdies generierte Daten aus der Begleitforschung bezogen werden, welche für Validierungszwecke der erstellten Simulationsmodelle herangezogen wurden.
Abb. 2.1 zeigt den örtlichen Ursprung der im Projekt EASyQuart verwendeten Daten und Standortmodelle. Die farbliche Einteilung unterscheidet zwischen den Arten der verwendeten Daten.
2.1 Berlin-Weißensee
In Berlin wurde für die Wärme- und Kälteversorgung eines öffentlichen Gebäudes ein Heizkonzept basierend auf erdgekoppelten Wärmepumpen umgesetzt. Die benötigte Primärenergie aus dem geologischen Untergrund wird von 16 Erdwärmesonden extrahiert. Für die Planung hat die geoENERGIE Konzept GmbH ein umfassendes 3D-Modell des Standorts entwickelt und numerische Langzeitsimulationen durchgeführt, welche im Rahmen des Genehmigungsprozesses von den verantwortlichen Behörden verlangt werden. Die Simulationsergebnisse sollen eine ausreichende Dimensionierung sowie eine nachhaltige Betriebsweise des Erdwärmepumpensystems garantieren. Das mit einer Größe von ca. 1100 m \(\times \) 800 m \(\times \) 175 m und in über 3 Mio. Elementen diskretisierte sehr komplexe Modell wurde in EASyQuart für eine Vergleichsrechnung zwischen der kommerziellen und etablierten Software Finite Element Subsurface Flow & Transport Simulation System (FEFLOW) und dem vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) Leipzig entwickelten Open-Source-Tool OpenGeoSys (OGS) aufbereitet. Das ursprünglich in FEFLOW aufgebaute Modell konnte in OGS importiert und die genutzten Parameter analog verwendet werden. Unter anderem konnten mit den Modelldaten umfangreiche Analysen durchgeführt sowie der Programmcode von OGS angepasst und optimiert werden. Die zugehörigen Ergebnisse wurden in Randow et al. (2022) veröffentlicht. Detaillierte Simulationsergebnisse können außerdem in Kap. 6 eingesehen werden. Weiterhin konnten am Standort durchgeführte Thermal-Response-Tests (TRT) mittels analytischer sowie numerischer Verfahren erneut abgebildet und validiert werden. Darüber hinaus wurde für dieses Projekt eine interaktive 3D-Visualisierung zur Darstellung aller gemessenen und simulierten Daten erstellt, welche in Abschn. 7.1.3 beschrieben wird.
2.2 Offenbach-Kaiserlei
In Offenbach am Main war für die Versorgung eines Quartiers, bestehend aus Wohn- und Gewerbeeinheiten, vorgesehen, dass anteilig die Wärme- und Kälteversorgung über erdgekoppelte Wärmepumpen erfolgt. Das Quartier setzt sich u. a. aus sanierten Bestandsgebäuden und Neubauten zusammen. Das Bauvorhaben gliedert sich in einzelne Bauabschnitte bzw. Bauteile, welche sich in ihrer Nutzungsform (Wohnen, Gewerbe) sowie deren energetischen Anforderung unterscheiden (Heiz- und Kühlbedarf). Das Gesamtsondenfeld setzt sich letztendlich aus insgesamt fünf Teilsondenfeldern zusammen, mit jeweils separaten Wärmepumpen. Das Gesamtsondenfeld besteht aus insgesamt 263 EWS à 100 m (153 Doppel-U-Sonden) und 125 m (110 Doppel-U-Sonden). Die EWS wurden alle errichtet, sind jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Betrieb genommen worden, sodass keine tatsächlichen Verbrauchs- sowie Monitoringdaten zur Einschätzung der Betriebsweise vorliegen.
Im Zuge einer thermohydrodynamischen Modellierung wurde durch die geoENERGIE Konzept GmbH bestimmt, wie der Untergrund räumlich und langfristig durch die geothermische Anlage thermisch beeinflusst wird. Auch für dieses Quartier wurden alle verfügbaren Daten in einer 3D-Szene visualisiert, deren Details in Abschn. 7.1.4 beschrieben werden.
2.3 Kiel-Wik
Eingebettet in eine größere Studie für das Bundesland Schleswig-Holstein mit dem Fokus auf die Gewinnung und Speicherung erneuerbarer Energien wurden für den Stadtteil Kiel-Wik Methoden für die Zusammenführung heterogener Observations- und Simulationsdaten für eine intuitive Darstellung von Energiesystemen untersucht. Basierend auf im Rahmen des ANGUSII-Forschungsprojekts gesammelten und erzeugten Daten wurde in enger Abstimmung mit Geowissenschaftlern der Universität Kiel eine komplexe Visualisierungsstudie für die zuvor genannten Fragestellungen aufgesetzt. Neben der für ganz Schleswig-Holstein erfassten Infrastruktur an Solarparks, Biogasanlagen sowie On- und Offshore-Windparks wird für den Kieler Stadtteil Wik ein Simulationsszenario für die Speicherung von Wärme in einem Grundwasserleiter visualisiert. Gemeinsam mit statistisch modellierten Daten zur Wärmebedarfsverteilung kann somit die mögliche Kapazität des Speichers dem benötigten Bedarf gegenübergestellt werden. Für eine anschauliche Gestaltung, die neben Experten auch die interessierte Öffentlichkeit adressieren soll, wurden möglichst intuitive Darstellungsarten der verwendeten Daten gewählt. So werden beispielsweise der für das Untersuchungsgebiet relevante Gebäudebestand durch etwa 3500 Modelle dargestellt, die geografische Einordnung durch die Verwendung von Luftbildern und geografischen Karten erleichtert und die Simulationsergebnisse durch Isotemperaturflächen approximiert. Das Ergebnis ist ein Prototyp für ein Umweltinformationssystem zu Fragen der Energieinfrastrukturen, das auch für die Erstellung von vergleichbaren Studien für andere Untersuchungsgebiete genutzt werden kann (vgl. Abschn. 7.1.5).
2.4 Köln-Junkersdorf
Bei dem Demonstrationsstandort Köln-Junkersdorf handelt es sich um ein ca. 350 m \(\times \) 550 m großes Wohnquartier im Kölner Westen mit intensiver Nutzung Oberflächennaher Geothermie. Im Zuge der Sanierung von Wohngebäuden im Bestand sowie dem Neubau von Wohngebäuden, vornehmlich im Zeitraum von 2010 bis 2015, wurde die Wärmeversorgung von 51 der rund 150 Einfamilienhäuser in dem Quartier auf die Nutzung Oberflächennaher Geothermie umgestellt. Hierbei lag der Fokus auf der Wärmebereitstellung durch Nutzung von EWS. Der geologische Untergrund des Testgeländes besteht aus Sand- und Kiesablagerungen der quartären Terrassenabfolge des Rheins, die von einer feinsandigen, gelegentlich tonigen und schwachkiesigen Schluffschicht mit einer lokal variierenden Mächtigkeit von 6–8 m überdeckt werden. Bodenprofile, die während der Installation von EWS aufgenommen wurden, belegen eine lokale Mächtigkeit der quartären Schichtenfolge von 30–40 m, auf die die Nutzung der Oberflächennahen Geothermie am Teststandort beschränkt ist. Der Grundwasserflurabstand beträgt rund 21 m. Der Übergang zwischen Quartär und Tertiär wird in der Literatur durch Feinsandablagerungen mit reduzierter hydraulischer Leitfähigkeit beschrieben (Losen 1984). Die Grundwasserströmung im Bereich des Demonstrationsstandortes erfolgt in ost-nordöstlicher Richtung zum Rhein als Hauptvorfluter in etwa 6,5 km Entfernung. Detaillierte Informationen über die Stratigrafie und Hydrogeologie im Raum Köln gibt Klostermann (1992), weitere Informationen zum Demonstrationsstandort finden sich in Vienken et al. (2019) sowie Meng et al. (2019).
2.5 Untersuchungsfläche im Rhein-Main-Gebiet
Bei dem Demonstrationsstandort handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen Bingen und Mainz mit einer Größe von ca. 430 m \(\times \) 760 m. Die Fläche liegt rund 1000 m vom Rhein entfernt, der geologische Untergrund im oberflächennahen Bereich besteht entsprechend aus Sand und Kiesablagerungen des Rheins, die im Liegenden von einer Schluff- und Tonschicht abgelöst werden, die das oberste Grundwasserstockwerk entsprechend abgrenzt. Im Untersuchungsgebiet selbst variiert die Tiefenlage des Stauers zwischen 6,1 m und 10,7 m unter Geländeoberkante (GOK). Die grundwassergesättigte Mächtigkeit des obersten Grundwasserleiters variiert zwischen 4,3 m und 7,3 m. Daher repräsentiert der Demonstrationsstandort eine Fläche, die insbesondere für die Nutzung von Erdwärmekollektoren oder offenen Systemen zur Wärme- und Kältebereitstellung sowie der saisonalen Energiespeicherung geeignet wäre.
2.6 Berlin-Gesundbrunnen
Das Wohn- und Gewerbegebäude im Norden von Berlin wird durch 18 EWS mit einer Tiefe von jeweils 99,9 m EWS geothermisch beheizt und gekühlt. Die Vorerkundung zeigt einen ausgeprägten Grundwasserleiter in einer Tiefe von 70–90 m unter GOK. Vom Projektpartner geoENERGIE Konzept GmbH werden die Auswirkungen der thermischen Untergrundnutzung in Form von Stichtagsmessungen der Temperaturprofile in einer Anstrom- und zwei Abstrommessstellen seit 2020 in einem viermonatigen Turnus dokumentiert. Der Standort konnte im Rahmen von EASyQuart insbesondere zur Anwendung eines ergänzenden, angepassten Monitoringkonzepts sowie zum Vergleich verschiedener Monitoringtechnologien genutzt werden.
2.7 Testfeld des UFZ in Leipzig
Das Testfeld Leipzig befindet sich auf dem Standort des UFZ im Zentrum des Wissenschaftsparks in Leipzig. Die Testfläche hat eine Größe von ca. 50 m \(\times \) 25 m und bietet Raum für eine Vielzahl von Experimenten im Bereich Messtechnik und Untergrunderkundung. Im Projekt EASyQuart wurde der Standort insbesondere innerhalb des Schwerpunktes Monitoring umfangreich genutzt. Der geologische Untergrund ist durch die quartären Lockergesteinsablagerungen der Grundmoräne aus dem Saale-Komplex aufgebaut. Die Ablagerungen zeichnen sich dabei durch eine ausgeprägte Heterogenität aus, d. h., es finden sich starke Variationen des Korngrößenspektrums über kurze vertikale Distanzen in den zahlreich abgeteuften Bohrungen und Erkundungssondierungen. Unter einer ca. 0,3 m mächtigen Auffüllung folgt ein knapp 10 m mächtiger siltig-toniger Geschiebemergel mit variierenden Sand- und Kiesanteilen. Der Geschiebemergel ist von einzelnen Sandeinschaltungen unterbrochen. Ab ca. 10 m unter GOK folgt der eigentliche Grundwasserleiter, in dem sich wiederum siltig-tonige Einschaltungen finden. Der Grundwasserspiegel liegt im Bereich der Stauerunterkante und kann damit lokal leicht gespannt ausgeprägt sein.
2.8 Wüstenrot
Die Gemeinde Wüstenrot in Baden-Württemberg ist ein Vorreiter auf dem Weg zur Energiewende. In der ca. 3000 ha großen Kommune soll eine Plusenergiegemeinde entstehen, die ihren Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Energien decken kann und deren Überschüsse ins Netz eingespeist werden. Die Mitarbeiter des Forschungsprojekts Kommunale netzgebundene Energieversorgung – Vision 2020 am Beispiel der Gemeinde Wüstenrot (EnVisaGe) der Hochschule für Technik Stuttgart unterstützen das Vorhaben durch konkrete Planungen für die Energienutzung mithilfe innovativer Planungswerkzeuge auf Grundlage von 3D-GIS-Daten. Potenzialanalysen verschiedener Standorte und Szenarien sollen die Methodik skalierbar und auf weitere Projekte anwendbar machen. Im Rahmen dieses Projekts wurde u. a. die Neubausiedlung „Vordere Viehweide“ konzeptioniert und umgesetzt, welche über einen agrothermalen Flächenkollektor mit Wärme versorgt wird. In insgesamt elf Gebäuden wurde ein Monitoring der Haus- und Anlagentechnik installiert und durchgeführt, in sechs Gebäuden ist dieses besonders detailliert und umfangreich (vgl. Brennenstuhl et al. 2019). Mit freundlicher Genehmigung der Projektverantwortlichen von EnVisaGe konnten die Gebäude- und Monitoringdaten für die Validierung von in EASyQuart erstellten Simulationsmodellen der Haus- und Gebäudetechnik genutzt werden. Die zur Verfügung gestellte Datenbank beinhaltet die detaillierte Messwertaufzeichnung zahlreicher hausseitiger Sensoren. Für die Modelle der Gebäudetechnik sind dabei vor allem die Temperaturen im Heizkreislauf sowie die Kenndaten der Wärmepumpe und des Wärmetauschers (im Kühlfall) von Interesse. Mithilfe einer vorgelagerten Datenanalyse konnten fehlerhafte und unplausible Messwertaufnahmen erkannt und daraus ein optimaler Validierungszeitraum bestimmt werden.
2.9 Sonstige
Der Verbundpartner geoENERGIE Konzept GmbH stellte Messdaten eines Einfamilienhauses am Standort Freiberg zur Verfügung. Insbesondere die detaillierten Geometrie- und Materialparameter waren wichtig, um das Gebäudemodell der Modelica Bibliothek GreenCity zu validieren. Entsprechende Wetterdaten des Standortes wurden dem Test Reference Year (TRY) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) entnommen.
Die Wetterstation am Standort Lindenberg hat Messwerte mit der geringsten Anzahl von Messfehlern aufgenommen, sodass tatsächliche Wetterdaten als Randbedingung für Langzeitanalysen der gekoppelten Simulation, bestehend aus Gebäude- und Anlagenmodell sowie Untergrundmodell, verwendet werden konnten. Andere Standorte beinhalten wesentlich mehr Messfehler in den Daten der solaren Einstrahlung, die den Simulationszeitraum auf kürzere Zeitintervalle beschränken.
Die bisher nicht einzeln aufgeführten Standorte Düsseldorf, Erfurt, Hamburg und München wurden mit den Standorten Leipzig und Berlin in Form von Umweltbedingungen des TRY als Randbedingungen der Quartierssimulation definiert. Ziel dieser Auswahl war das Abbilden eines möglichst breiten Spektrums von Umweltbedingungen, die ein Stadtquartier in Deutschland beeinflussen können.
Literatur
Brennenstuhl M, Zeh R, Otto R et al (2019) Report on a plus-energy district with low-temperature DHC network, novel agrothermal heat source, and applied demand response. Appl Sci 9(23):5059. https://doi.org/10.3390/app9235059
Klostermann J (1992) Das Quartär der Niederrheinischen Bucht: Ablagerungen der letzten Eiszeit am Niederrhein. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld
Losen H (1984) Grundwasserstände und Grundwasserbeschaffenheit im südlichen Teil der linksrheinischen Kölner Scholle. Eine hydrogeologische und statistische Analyse. PHD, RWTH Aachen
Meng B, Vienken T, Kolditz O et al (2019) Evaluating the thermal impacts and sustainability of intensive shallow geothermal utilization on a neighborhood scale: lessons learned from a case study. Energy Convers Manage 199(111):913. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.111913
Randow J, Chen S, Lubashevsky K et al (2022) Modeling neighborhood-scale shallow geothermal energy utilization: a case study in Berlin. Geotherm Energy 10(1):1. https://doi.org/10.1186/s40517-022-00211-9
Vienken T, Kreck M, Dietrich P (2019) Monitoring the impact of intensive shallow geothermal energy use on groundwater temperatures in a residential neighborhood. Geotherm Energy 7(1):8. https://doi.org/10.1186/s40517-019-0123-x
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2024 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Henker, S. et al. (2024). Standorte und Standortmodelle. In: Bucher, A., et al. EASyQuart - Energieeffiziente Auslegung und Planung dezentraler Versorgungsnetze von Stadtquartieren. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67140-5_2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-67140-5_2
Published:
Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-67139-9
Online ISBN: 978-3-662-67140-5
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)