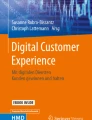Zusammenfassung
Die grundlegende Idee von internem Crowdsourcing (IC) ist, den innerbetrieblichen Wissensaustausch und die Interaktion im Unternehmen zu mobilisieren und zu stärken. Das Lösen von Problemstellungen durch bereichs- und fachübergreifendes Denken und kollaborative Handlungskompetenzen für die Zusammenarbeit sowohl zwischen den Beschäftigten untereinander als auch zwischen Unternehmensführung und Beschäftigten soll mit dem Verfahren auf direkte Weise gefördert werden. Vorhandenes explizites, aber vor allem auch personengebundenes implizites Fach- und Erfahrungswissen kann durch die Anwendung von internem Crowdsourcing schnell im Unternehmen abgerufen und für die Entwicklung von Lösungen, Prozessen und Entscheidungen genutzt werden. Insbesondere durch das niedrigschwellige Erproben neuer Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten kann internes Crowdsourcing einen wichtigen Beitrag zu einer veränderten, arbeitnehmerfreundlichen und agileren Unternehmenskultur für die digitalisierte Arbeitswelt leisten.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
1 Hintergrund, Vorgehen und Zielsetzung
“Internal Crowdsourcing refers to the firm extending its problem-solving to a large and diverse group of self-selected contributors beyond the formal internal boundaries of a large firm; across business divisions, bridging geographic locations, levelling hierarchical structures.” (Elin Byren [1], S. 4).
1.1 Hintergrund
Die grundlegende Idee von internem Crowdsourcing (IC) ist, den innerbetrieblichen Wissensaustausch und die Interaktion im Unternehmen zu mobilisieren und zu stärken. Das Lösen von Problemstellungen durch bereichs- und fachübergreifendes Denken und kollaborative Handlungskompetenzen für die Zusammenarbeit sowohl zwischen den Beschäftigten untereinander als auch zwischen Unternehmensführung und Beschäftigten soll mit dem Verfahren auf direkte Weise gefördert werden. Vorhandenes explizites, aber vor allem auch personengebundenes implizites Fach- und Erfahrungswissen kann durch die Anwendung von internem Crowdsourcing schnell im Unternehmen abgerufen und für die Entwicklung von Lösungen, Prozessen und Entscheidungen genutzt werden. Insbesondere durch das niedrigschwellige Erproben neuer Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten kann internes Crowdsourcing einen wichtigen Beitrag zu einer veränderten, arbeitnehmerfreundlichen und agileren Unternehmenskultur für die digitalisierte Arbeitswelt leisten. Adressiert werden hier u. a. Aspekte wie wachsende Partizipationsansprüche durch und an Mitarbeitenden, der Wunsch nach flacheren Hierarchien samt unternehmens- bzw. bereichsübergreifender Kommunikationswege, agile und zeitgemäße Arbeitsmethoden und -organisation, Ansprüche an eine stärkere Demokratisierung von Unternehmen sowie eine grundsätzliche Unternehmensbefähigung, um in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts (Industrie 4.0, Arbeit 4.0, Wirtschaft 4.0 etc.) bestehen zu können. Da durch IC in erster Linie die unternehmens- und bereichsübergreifenden Kommunikationsmöglichkeiten verändert bzw. ergänzt werden, neue Arbeits- und Interaktionsräume geschaffen und die digitale Einbindung der Mitarbeitenden ermöglicht werden, eröffnet sich hier ein Gestaltungs- und Experimentierraum für die Arbeitsorganisation der Zukunft.
Angesichts des hier beschriebenen Potenzials als ein Katalysator für die Etablierung einer digitalen Arbeitskultur zu fungieren, ist es erstaunlich, dass IC sowohl in der Forschung als auch in der Praxis fast ausschließlich als ein weiteres Instrument des Innovationsmanagements behandelt wird [4, 16, 17, 18]. Im Rahmen des Forschungsprojektes ‚ICU – Internes Crowdsourcing in Unternehmen‘ wurde daher erstmals die begründete Annahme getroffen, dass das Verfahren über den Innovationscharakter hinaus noch weitere Nutzungspotenziale birgt, nämlich zum einen für die Mitarbeiterbeteiligung und zum anderen für die Mitarbeiterqualifizierung.
1.2 Mitarbeiterbeteiligung
Als ein Instrument der digitalen Mitarbeiterbeteiligung kann internes Crowdsourcing Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit ermöglichen, auf unterschiedlichen Ebenen der Unternehmensprozesse teilzuhaben. Sie erhalten Gelegenheit, ihre persönlichen Erfahrungen und Wissensbestände in Form von Vorschlägen und Ideen in die Unternehmensabläufe mit einzubringen sowie Arbeitsverhältnisse mitverantwortlich zu gestalten. Durch die technische Vermittlung des Verfahrens erzielt internes Crowdsourcing mit geringem Aufwand eine hohe Reichweite im Mitarbeiterkontakt und eröffnet einen schnellen und direkten Kommunikationskanal zwischen Unternehmen und Angestellten. Grundsätzlich trägt Mitarbeiterbeteiligung neben anderen Faktoren zu einem Arbeitsklima bei, das auf Wertschätzung und Anerkennung für alle Beteiligten beruht.
1.3 Mitarbeiterqualifizierung
Um Beschäftigte auf die neue Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung im Arbeitsalltag vorzubereiten und für neue Tätigkeiten, die in diesem Zusammenhang entstehen, zu qualifizieren, müssen Unternehmen neue Wege und Maßnahmen finden, um interne berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Insbesondere seit der Einführung des „Europäischen Qualifikationsrahmens“ im Jahr 2008 ist in den einschlägigen wissenschaftlichen und praxisrelevanten Fachdebatten eine Verschiebung von den „harten“ Fakten der Qualifikationsnachweise hin zu den „weichen“ Indikatoren, den Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen, d. h. den Kompetenzen, erkennbar. Dabei haben Qualifikationen selbstverständlich nicht an aussagekräftiger Bedeutung verloren, da sie einen notwendigen Hinweis auf vorhandene berufliche Kompetenzen darstellen, doch geben sie keine Garantie für die Anwendung in der Praxis. Auch in der strategischen Personalentwicklung ist der Kompetenzansatz schon längst etabliert, z. B. im Zusammenhang mit internen Besetzungsverfahren von offenen Stellen. Um das tatsächliche „Können“ von bereits eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzuschätzen, sind die formalen Qualifikationen meist zweitrangig und ihr Kompetenzprofil aussagekräftiger. Weiterhin kann Kompetenzermittlung im Unternehmen das Ziel verfolgen Weiterbildungsbedarf oder die Lernausgangslage als Voraussetzung für selbstständige/selbstorganisierte Lernprozesse und für die erforderliche Lernbegleitung zu ermitteln. [5: S. 11 ff., 6: S. 10 ff., 15] Natürlich bleibt das Potenzial für Produkt-, Dienstleistungs- oder Prozessinnovationen durch IC sehr hoch und sollte als wichtige IC-Dimension nicht vernachlässigt werden.
1.4 Projektziele und Methodisches Vorgehen
Vor diesem Hintergrund war das Ziel des Forschungsprojektes ICU, in einem mehrstufigen, iterativen Verfahren ein branchenübergreifendes Modell zu entwickeln, das als Referenzfall guter Praxis für zukünftige Crowdsourcingaktivitäten dienen soll. Dieses sogenannte ICU-Modell besteht aus einem speziell für das interne Crowdsourcing konzipierten Prozess, der neben dem Innovationsmanagement die Dimensionen Mitarbeiterbeteiligung und Mitarbeiterqualifikation strategisch gleichermaßen adressiert, einem Prozessmanagementsystem und einer IC-Plattform. Auf der Grundlage von Analysen betrieblicher IC-Implementationen, wissenschaftlicher Forschung und Erfahrungswissen aus der Praxis wurde zuerst ein Grundmodell designt und dann beim Praxispartner, dem Energiedienstleister GASAG AG, in einer Pilotphase zur Anwendung gebracht (1. Iteration). Anschließend wurde das Modell optimiert und zum GASAG Good – Practice – Beispiel ausgeformt (2. Iteration). Von dem Good – Practice – Beispiel ausgehend wurde dann ein branchenübergreifendes Referenzmodell entwickelt. Im Fokus der Modellentwicklung stand die arbeitnehmergerechte Gestaltung der Anwendung von internem Crowdsourcing. Um die damit verbundenen, unterschiedlichen Ansprüchen zu berücksichtigen, wurde das ICU-Modell von Projektbeginn an partizipativ mit allen relevanten Stakeholdern (Beschäftigte/Unternehmensführung/Betriebsrat) und unter aktiver Begleitung der Gewerkschaft entwickelt, die die arbeitsrechtlichen/-politischen Rahmenbedingungen für das Verfahren sicherstellen sollte.
In diesem Artikel werden nun die Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitspaketen von den dafür verantwortlichen Projektpartnern vorgestellt.
2 TU Berlin – Institut für Technologie und Management/FG Innovationsökonomie: Internes Crowdsourcing erfolgreich managen
Im Rahmen des ICU – Projektes war es die Aufgabe des Instituts für Technologie und Management der Technischen Universität Berlin, die betrieblichen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Implementation von IC zu identifizieren. Dazu gehörte zunächst die Fragestellung, inwieweit das Phänomen Crowdsourcing bereits in der deutschen Wirtschaft verbreitet ist und ob dessen Verwendung, z. B. nach Branchen und Unternehmensgrößen, variiert. Als Datengrundlage für diese Analysen diente das Mannheimer Innovationspanel, eine seit 1993 jährlich durchgeführte und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung beauftragte Erhebung zum Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Auf Basis der Erhebungen der Jahre 2016 und 2017 wurde die Diffusion von verschiedensten Anwendungsgebieten der Digitalisierung, sowie die Nutzung von verschiedenen internen und externen Wissensquellen analysiert. Insbesondere die Verbreitung der Nutzung von Crowdsourcing wurde dabei berücksichtigt. Während etwa 15 % der befragten Unternehmen „Ideen/Rückmeldungen aus der breiten Öffentlichkeit“ und damit eine Kombination von externem und internem Crowdsourcing nutzen, stellt dies aktuell jedoch nur für etwa 6 % von ihnen eine wichtige Informationsquelle dar. Dabei ist die Nutzung von Crowdsourcing insbesondere in Großunternehmen und in den Branchengruppen Chemie-/Pharmaindustrie (23,98 %), Finanzdienstleistungen (22,22 %) und Maschinenbau (20,60 %) verbreitet. Weniger Bedeutung hat Crowdsourcing erwartungsgemäß in den eher nicht wissensintensiven Branchengruppen Ver-/Entsorgung, Bergbau (9,83 %) sowie Großhandel und Transport (10,76 %).
Anschließend wurde eine Fallstudie zu IC bei SAP, dem größten Softwarehersteller in Deutschland durchgeführt, um die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von IC zu dokumentieren und die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung der Technologie zu analysieren. Insgesamt konnten durch die Fallstudie fünf verschiedene Implementationen von IC beobachtet und detailliert beschrieben werden. Die Anwendungsgebiete reichen dabei vom Bereich des Personalwesens, über Wettbewerbe für neue Produkte und Geschäftsmodelle, bis hin zu verteilter Softwareentwicklungsarbeit und der Kompetenzentwicklung der eigenen Mitarbeiter. Die beobachteten IC Implementierungen wurden anschließend, basierend auf dem konzeptionellen Rahmenwerk von Zuchowski et al. [18], hinsichtlich der notwendigen Managementaufgaben analysiert. Auf Basis der geführten Interviews konnten sieben Erkenntnisse abgeleitet werden. Unternehmen, die IC erfolgreich einsetzen wollen, sollten die Leistungen und den Aufwand ihrer Mitarbeiter anerkennen, Bottom-Up-Ansätze erkennen und unterstützen, notwendige Ressourcen zur Verfügung stellen, für einen Höchstmaß an Kollaboration und Austausch sorgen, IC bestmöglich in das eigene Innovationssystem integrieren und eine höchstmöglich Transparenz im gesamten IC-Prozess garantieren. Die abgeleiteten Erkenntnisse stellen eine Ressource für Unternehmen dar, das Management von IC bestmöglich zu gestalten und so das Wissen der eigenen Mitarbeiter für eine Vielzahl von Anwendung effizient und effektiv nutzbar zu machen.
Zuletzt wurde eine strukturierte Literaturanalyse zu empirischen Studien über IC durchgeführt. Auf der Basis von 28 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, welche mehr als 100 Unternehmen berücksichtigen und sich auf über 100 Interviews, Umfragen und Daten interner Crowdsourcingwettbewerbe stützen, wurden die bisherigen Erkenntnisse zum Management von IC systematisch zusammengetragen, analysiert und ausgewertet. Die betrachteten Managementaufgaben umfassen dabei die Unternehmenskultur, das Veränderungsmanagement, das Anreizmodell, die Aufgabenstrukturierung, die Qualitätssicherung, das Community Management, die Regelsetzungen sowie rechtliche Fragestellungen und basieren erneut auf dem konzeptionellen Rahmenwerk von Zuchowski et al. [18]. All diese Aufgaben haben einen entscheidenden Einfluss auf die erfolgreiche Durchführung von IC und beeinflussen, welchen Nutzen ein Unternehmen aus dessen Implementierung ziehen kann. Die Ergebnisse der Studie helfen Managern in der Zukunft, IC Implementationen erfolgreich zu begleiten, zu steuern und deren Ergebnisse zielgerichtet in die Herstellungsprozesse des Unternehmens zu integrieren.
3 TU Berlin – Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre/FG Arbeitslehre, Technik und Partizipation: Erste Systematisierungsansätze für die Beschreibung eines modellhaften Crowdsourcing-Systems
In der aktuellen Forschungsdiskussion sind grundlegende Fragestellungen zur Steuerung von Crowdsourcing, hier auch internes Crowdsourcing (IC), in Verbindung mit einer systematischen IC-Beschreibung weitgehend unbeantwortet. Dies wurde im Verlauf des Forschungsvorhabens deutlich. Für eine verbindliche Beschreibung von IC-Systemen mit konsensfähigen, d. h. diskurs-verbindlichen Terminologien und Beschreibungen waren daher folgende Fragen zu beantworten: (Wie) Können die in der Wissenschaftsliteratur bereits beschriebenen Unterkategorien und Aspekte eines IC-Systems sinnvoll referenziert und in ein geordnetes Gesamtverhältnis gebracht werden? Welche Ergänzungen müssen, wenn nötig und möglich, bei Systembeschreibungen vorgenommen werden? Der primäre Forschungsansatz konzentrierte sich auf die Identifizierung vorhandener Beschreibungen und Definitionen im Zusammenhang mit Systematisierungsansätzen für die Entwicklung eines IC-Systems.
Im Ergebnis der Forschungsarbeiten, die von [10, 11] an andere Stelle ausführlich beschrieben stehen, lassen sich die Folgenden Vorschläge und Ergebnisse als Diskussionsgrundlage für diskurs-verbindliche Terminologien und Beschreibungen festhalten:
-
IC-Theorieannahmen werden von einem interdisziplinären, mehrstufigen Analysezugang geprägt, deren metatheoretischen Sprache von wirtschafts-, sozial- und informatikwissenschaftlichen Ansätzen geprägt ist.
-
Jedes IC-System besteht aus drei Komponenten: Prozess, Aktivität und Informationstechnologie. Alle zusätzlichen Aspekte, die in der IC-Literatur als Komponenten bezeichnet werden und weder Teil der Rahmenbedingungen noch Input oder Output zu und des Prozessablaufs sind, können innerhalb dieser drei Gesamtkomponenten subsumiert oder im Zusammenspiel dieser drei Komponenten verortet werden.
-
Jedes IC-System ist Rahmenbedingungen ausgesetzt: externen, internen und strategischen Rahmenbedingungen, wobei die beiden letzteren die übergreifenden unternehmensinternen Rahmenbedingungen beschreiben. Rahmenbedingungen beeinflussen zwar das Anwendungsdesign von IC, sie ändern jedoch weder die grundlegende Logik eines IC-Systems noch das IC-System an sich.
-
IC ist von einer Steuerungsintention geprägt, die auf die Erreichung gewünschter Lösungen ausgerichtet ist. Umgesetzt werden diese Intentionen durch ein hierarchisches Zusammenspiel zwischen Steuerungssubjekt („Crowdsourcer“) und Steuerungsobjekt („Crowdsourcee“) in Form von Managementprozessen.
-
Es gibt einen Unterschied zwischen internen und externen Anwendungen von Crowdsourcing und Crowdsourcing-Management.
-
Weder interne noch externe Crowdsourcing-Anwendungen lassen sich durch eine Governance-Perspektive beschreiben.
-
Potenzielle zukünftige mehrstufige Crowdsourcing-Systeme, innerhalb derer Richtungsabhängigkeiten (Crowdsourcer - > Crowdsourcee) nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können, sollten durch eine governancetheoretische Perspektive erfasst und beschrieben werden.
Für eine verbindliche Systembeschreibungen werden die Terminologien IC-Theorierahmen, IC-Rahmenbedingungen (extern, intern und strategisch) und IC-System (mit den Komponenten Prozess, Aktivität und Informationstechnologie) vorgeschlagen. Das eigentliche IC-System besteht aus „nur" drei Komponenten: Prozess, Aktivität und Informationstechnologie. Es wird dringend empfohlen eine terminologische Unterscheidung zwischen Governance und Management zu machen. Diese ersten Ansätze können nur als Diskussionsgrundlage angesehen werden.
4 TU Berlin – Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre/FG Arbeitslehre, Technik und Partizipation: ICU-Rollenmodel für Internes Crowdsourcing
Ein sinnvolles Rollenmodell ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für die gelingende Umsetzung von IC. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde ein solches Rollenmodell auf der Basis einer prototypischen Anwendung von internem Crowdsourcing realisiert. Das ICU-Rollenmodel orientiert sich an der Rollenkonzeption und –aufteilung von Scrum, da sich in der Pilotphase der IC-Anwendung zeigte, dass Teilaspekte des IC-Prozesses sowie notwendige Aktivitäten der Prozesssteuerung und die darin eingeschriebenen Prinzipien eindeutige Parallelen zum Vorgehen, zu den Prinzipien und den Aufgabenbeschreibungen der agilen Methode Scrum aufweisen (ausführlich siehe [10, 11]. Weiterhin beschreibt es die Aufteilung der Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Prozessebenen und Prozesskomponenten der einzelnen Prozessphasen sowie die damit verbundenen Steuerungsaufgaben. Darüber hinaus definiert es die Verbindungen zu anderen Unternehmensbereichen, die als Unterstützung für die Durchführung von IC benötigt werden. Auch wenn sich das ICU–Rollenmodel in seinen Grundzügen an Scrum orientiert, umfasst es insgesamt wesentlich mehr Akteure, die in primäre, sekundäre und tertiäre Rollen kategorisiert werden.
4.1 Primäre Rollen
Für die erfolgreiche Implementierung von IC braucht es im Wesentlichen drei Hauptverantwortliche: (1) Crowd Master (Prozessverantwortung), (2) Campaign Owner (Kampagnenverantwortung) und (3) Crowd Technology Manager (IT-Verantwortung). Zusammen bilden sie das sogenannte Crowd-Team. Als Ansprechpartner für das Thema im Unternehmen sind sie verantwortlich für die Koordination, Umsetzung und Kommunikation des gesamten Prozesses.
4.2 Sekundäre Rollen
Die Planung und Durchführung von Kampagnen erfordern die Unterstützung von Mitarbeiter*innen aus anderen Abteilungen des Unternehmens, die zu den so genannten sekundären Einheiten gehören. Um die Zusammenarbeit zu koordinieren, wird ein sogenanntes Kampagnenteam gebildet, das neben dem Campaign Owner (Leitung) und dem Crowd Technology Manager aus dem (4) Content Owner (Verantwortung für die Ergebnisverwertung), den einzelnen (5) Vertretern der Sekundäreinheiten (Personal, Marketing, IT, Eventmanagement) und der (6) Crowd besteht.
4.3 Tertiäre Rollen
Der Erfolg von IC hängt im Wesentlichen vom Engagement des (7) Vorstands/Geschäftsleitung und der Unterstützung der (8) Arbeitnehmervertreter/des Betriebsrats ab. Gemeinsam mit dem Crowd Master müssen diese beiden Interessengruppen die Rahmenbedingungen für internes Crowdsourcing im Unternehmen aushandeln und definieren sowie deutlich machen, dass sie hinter dem Prozess stehen und einen Nutzen für das Unternehmen darin sehen (Commitment).
5 Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung: Qualifizierung und Kompetenzentwicklung durch den Einsatz von internem Crowdsourcing
Im Zuge des ICU-Projektes wurde der Frage nachgegangen, wie internes Crowdsourcing als Instrument zur Unterstützung der Qualifikation und Kompetenzentwicklung von Mitarbeiter*innen eingesetzt werden kann. Wie sollte ein Konzept zur Kompetenzentwicklung durch internes Crowdsourcing gestaltet werden, um sowohl für die einzelnen Mitarbeiter*innen als auch für die gesamte Organisation einen Fortschritt zu bringen und Mehrwert zu schaffen?
Um diese Fragen zu beantworten wurden der aktuelle Forschungsstand herausgearbeitet und entsprechende Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Beispiele herangezogen. Dies wurde empirisch ergänzt, durch Interviews und unterschiedliche Workshopformate. In den Workshops mit Experten aus sehr diversen Organisationen, darunter Groß- und Kleinunternehmen, Verbände sowie Forschungs- und Beratungseinrichtungen, stellte sich schnell heraus, dass der IC-Ansatz bisher wenig verbreitet ist und sich gerade auch für den Einsatzbereich der Kompetenzentwicklung in einer Experimentierphase befindet. Es wurde festgestellt, dass Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung durch internes Crowdsourcing die laufenden Qualifizierungsmaßnahmen nicht ersetzen, wohl aber ergänzen können und Ansatzpunkte für eine Überprüfung der bisherigen Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramme bieten.
Der Aufbau eines unternehmensinternen Netzwerkes, der Wissenstransfer sowie der Austausch zwischen Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen und Bereiche sind zentrale Elemente des neuen Konzeptes. Durch dessen Anwendung sollen die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit erhalten, ihre individuellen Interessen zu entdecken sowie ihre Fähigkeiten anzuwenden und diese weiterzuentwickeln. Darüber hinaus soll die Entwicklung digitaler Kompetenzen, insbesondere der Umgang mit digitaler Anwendungssoftware, eine besondere Rolle bei der Entwicklung von Maßnahmen spielen.
Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Rahmenbedingungen, die je nach Unternehmenstyp und Branche sehr unterschiedlich sein können, werden drei Ansätze vorgeschlagen, die jeweils die Bearbeitung einer Aufgabe in der digitalen Crowdsourcing-Anwendung, der sog. Kampagne, beinhalten. Sie können auch als Phasen der Entwicklung und Implementierung dienen:
-
1.
Crowdvoting zur kollaborativen Bewertung und Priorisierung von künftig erforderlichen Kompetenzen. Dies ermöglicht einen niedrigschwelligen Einstieg in das interne Crowdsourcing.
-
2.
Ein Multiple-Choice-Test zur Bewertung von vorhandenem Wissen und Know-how. Dies dient einerseits der Weiterbildung der Mitarbeiter, andererseits dazu, vonseiten der Personalentwicklung einen Überblick über den aktuellen Qualifikationsstand zu erhalten.
-
3.
Die Nutzung von Crowdsolving- und Crowdcreation-Prozessen zur Kompetenzentwicklung und als Ausgangspunkt für die Förderung von Wissenstransfer und eines unternehmensinternen Netzwerks. Nahe am Arbeitsalltag werden kollaborativ konkrete Aufgaben bearbeitet, wobei sich Kompetenzen zeigen und entwickeln lassen.
Diese drei Schritte sollen sowohl die Mitarbeiter*innen als auch das Management in die Lage versetzen, einen selbstreflexiven, arbeits- und aufgabennahen Lernprozess zu entwickeln.
6 TU Berlin – Institut für Softwaretechnik und Theoretische Informatik/Quality and Usability Lab: Empirische Analyse einer IC-Plattform – IT-Implikationen für Aufgabengestaltung und Beteiligung
Im Rahmen des Projekts wurde eine Crowdsourcing-Plattform für interne Anwendungen für den Praxispartner Gasag AG implementiert. Da die Datenschutzbedenken des Betriebsrats und der Mitarbeiter*innen selbst eine der wichtigsten Barrieren für die Nutzung der Plattform waren, wurden bei ihrer Inbetriebnahme spezielle Vorschriften in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat festgelegt. Dabei wurden auch neue technische Rollen zur aktiven Verwaltung der Plattform und neue technische Aufgabentypologien implementiert. Die demographischen Daten der Nutzer*innen zeigen, dass vor allem junge Beschäftigte ohne Führungsrolle bevorzugt an IC teilnehmen, was üblich für neue Technologien ist, da die Technologieaffinität im Generellen mit dem Alter abnimmt. Außerdem besteht ein allgemeines Interesse an der Nutzung der Plattform, was durch die relativ hohe Registrierungsquote für eine freiwillige Plattform belegt wird. Ein wichtiger Motivationsfaktor an IC teilzunehmen ist vor allem die Freude an der Aktivität oder Freude an der Gestaltung von Produkten nach eigenen Ideen. Dies legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Themenauswahl, die zusätzlich als interne Crowdsourcing-Aufgabe auf der Plattform für jeden Nutzer hinterlegt wurde, die die intrinsische Motivation der Mitarbeiter*innen steigern soll.
Um die Beziehung zwischen den technischen Merkmalen der Plattform und der Mitarbeiterbeteiligung herauszufinden, wurden auf der Plattform insgesamt elf verschiedene Kampagnen mit sechs verschiedenen Aufgabentypologien durch die Unterstützung von 535 unterschiedlichen Beschäftigten realisiert. Dabei spielte die Aufgabentypologie bei der Vorhersage der Teilnehmerzahl eine wichtige Rolle (die Regressionsanalyse ergab sich einen R2-Wert von 0.895), denn indirekt kann vermutet werden, dass die Aufgabentypologie mit einer gewissen Erwartungshaltung zur erwartenden Arbeitsdauer einhergeht. Je komplexer die Aufgabenstellung, desto geringer die Teilnehmendenzahl. Ein Grund für die gewünschte niedrige Arbeitsdauer könnte die (gelebte) Unternehmenskultur sein, z. B. wenn die für das interne Crowdsourcing aufgewendete Zeit nicht als Arbeitszeit akzeptiert wird oder andere Aufgaben höherer priorisiert werden. Falls Leitlinien die Arbeitsdauer der Nutzung einer internen Crowdsourcing-Plattform begrenzen, könnten spezielle Zeitrahmen für die Plattform definiert werden. Bei einem der erfolgreichsten Aufgabentypen, der sog. Crowd Creation mit anschließendem Crowd Voting über den Namen eines neuen Firmensitzes zeigte sich, dass die richtig gewählte Aufgabengestaltung und Themenauswahl erfolgsversprechend für die Beteiligungsquote sind. Im Falle der Namensfindung schien (a) diese für viele Mitarbeiter im Unternehmen relevant zu sein; (b) die Aufgabe in weniger als drei Minuten leicht zu erledigen; und (c) die Prämisse, das neuen Unternehmensstandort zu benennen, die Mitarbeiter*innen stark zu motivieren. Hier wurden drei wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen internen Crowdsourcing Kampagne für interne Anwendung gleichzeitig erfüllt: (1) optimale Dauer, (2) geringe Komplexität und (3) Wahl eines interessanten Themas.
Da die empirische Erhebung der Beteiligung auf einem Einzelfall beruht, können die Ergebnisse nicht direkt generalisiert werden. Dennoch liefert das Projekt erste Einblicke in die Gestaltung der Regeln in Bezug auf Datenschutz-, und Sicherheitsbedenken sowie Richtlinien für die technische Implementierung einer Plattform für IC und deren täglichen Betrieb.
7 Forum Soziale Technikgestaltung beim DGB Baden-Württemberg: „Lebende Konzernbetriebsvereinbarung“ als soziale Innovation
Eines der wesentlichen Projektergebnisse ist die Erarbeitung einer Musterbetriebsvereinbarung, die sich speziell an Betriebsräte und Gewerkschaften richtet. Kurz nach dem Start des Projektes setzte sich der Konzernbetriebsrat (KBR) des GASAG-Konzerns mit dem gewerkschaftlichen Projektpartner, dem Netzwerk „Forum Soziale Technikgestaltung“ (FST) zusammen, um im Hinblick auf das Thema „Internes Crowdsourcing“ eine eigenständige Handlungsinitiative zu starten. Die Kolleg*innen legten ein eigenes Innovationskonzept vor. Sie übernahmen eine Vorreiterrolle. Das proaktive Konzept soll beschäftigungssichernde Wirkung nicht gegen neue digitale Anwendungen sondern auf der Basis der aktiven Nutzung neuer IT-Technik ermöglichen. Nach fünfmonatiger interner Kompetenzentwicklung und drei Monaten Verhandlung mit der Geschäftsleitung wurde die „Konzernbetriebsvereinbarung (KBV) Internes Crowdsourcing in der GASAG-Gruppe (,Lebende KBV‘)“ [9] unterschrieben. Diese Konzernbetriebsvereinbarung verfügt über mehrere Alleinstellungsmerkmale, die sie im bundesweiten arbeitsweltlichen Prozess der digitalen Transformation in besonderer Weise unverkennbar heraushebt. Als praktische Einführung wird vor allem ein beteiligungsorientiertes, freiwilliges, unternehmensinternes Innovationsmanagement über eine elektronische Plattform innerhalb der GASAG Gruppe angelegt.
Die genannte KBV wurde Teil der Handlungsempfehlungen der INQA-Initiative „Offensive Mittelstand“ in der „Umsetzungshilfe Arbeit 4.0. 4.0-Prozesse und agiles kooperatives Change Management (2.1.4) [9] als auch Bestandteil der „Potenzialanalyse Arbeit 4.0“, ebenfalls im Rahmen der „Offensive Mittelstand“ [8].
8 GASAG AG: Good-Practice in der GASAG-Gruppe – Empfehlungen für die Anwendung von internen Crowdsourcing aus der Unternehmensperspektive
Im Rahmen des Forschungsprojekts konnten mehrere Erfolgsfaktoren für die Implementierung von internem Crowdsourcing in einem Unternehmensumfeld identifiziert werden. Diese Erfolgsfaktoren sind hier in Form einer Checkliste zusammengefasst worden.
Auch wenn diese Liste nicht den Anspruch erhebt vollständig zu sein, können Unternehmen, die die Implementierung von IC in ihrem Geschäftsumfeld planen, die aufgelisteten Erfolgsfaktoren genauer untersuchen, um die Wahrscheinlichkeit einer gelingenden Projektumsetzung zu erhöhen.
8.1 Checkliste „Kritische Erfolgsfaktoren für die Implementierung von internem Crowdsourcing“
-
1.
Verpflichtung des Managements (Commitment)
-
Stellen Sie sicher, dass die Unternehmensleitung die Initiierung des Projektes aktiv unterstützt.
-
Stellen Sie sicher, dass die Unternehmensleitung das Projekt während seiner Laufzeit aktiv unterstützt.
-
Stellen Sie sicher, dass Zielvereinbarungen mit den Führungskräften für den Einsatz von internem Crowdsourcing umgesetzt werden.
-
-
2.
Klare und präzise Zielsetzung
-
Stellen Sie sicher, dass der interne Crowdsourcing-Ansatz klare und präzise Ziele hat, die mit der strategischen Gesamtausrichtung des Unternehmens übereinstimmen.
-
Stellen Sie sicher, dass Internes Crowdsourcing die aktuellen strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt.
-
Stellen Sie sicher, dass interne Stakeholder, Mitarbeiter und Führungskräfte im Einsatz von internen Crowdsourcing-Lösungen einen klaren Nutzen oder Mehrwert für ihre Arbeit erkennen.
-
-
3.
Betriebsvereinbarungen
-
Stellen Sie sicher, dass eine Betriebsvereinbarung mit transparenten unternehmensweiten Richtlinien und Arbeitsvorschriften für internes Crowdsourcing umgesetzt wird.
-
-
4.
Unternehmens- und Führungskultur
-
Stellen Sie sicher, dass größere Investitionen in Maßnahmen für das Change-Management im Projektbudget eingeplant werden.
-
Stellen Sie sicher, dass im Projekt genügend Zeit vorgesehen ist, damit sich Mitarbeiter und Führungskräfte mit dem Internen Crowdsourcing vertraut machen können.
-
Stellen Sie sicher, dass der Vorstand die Notwendigkeit der Investitionen in das Change-Management und die Einarbeitungszeit versteht.
-
-
5.
Projektzeitplan
-
Stellen Sie sicher, dass während des Projektzeitraums keine konkurrierenden Projekte gestartet werden, die die erfolgreiche Implementierung von internem Crowdsourcing gefährden.
-
Identifizieren Sie einen günstigen Zeitraum für den Start von internen Crowdsourcing-Projekten oder -kampagnen wählen, indem Sie Ferienzeiten, den Jahresabschluss oder Hochsaisonen umgehen.
-
Projektpartner und Aufgaben
-
TU Berlin – Institut für Technologie und Management/FG Innovationsökonomie
TU Berlin – Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre/FG Arbeitslehre, Technik und Partizipation (Projektleitung)
Entwicklung des IC-Modells: Strategie, IC-Plattform & Analyse betrieblicher Rahmenbedingungen von IC-Implementationen
Konzeptgestaltung für Mitarbeiterbeteiligung durch IC und Erarbeitung arbeitsrechtlicher IC-Verfahrensstandards
-
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gGmbH (IZT)
Konzeptgestaltung für Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durch IC
-
Forum Soziale Technikgestaltung beim DGB Baden-Württemberg (FST)
Erarbeitung einer Musterbetriebsvereinbarung, die sich speziell an Betriebsräte und Gewerkschaften richtet
-
GASAG AG (Praxispartner)
Entwicklung eines Good-Practice-Modells für IC im Dienstleistungssektor
Literatur
Byrèn E (2013) Internal crowdsourcing for innovation development – How multi-national companies can obtain the advantages of crowdsourcing utilising internal resources. Department of Technology Management and Economics, Sweden. https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/181969/181969.pdf
Europäische Kommission (2008) Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR). Luxemburg
Howe J (2006) The rise of crowdsourcing. Wired Mag 14(6):1–4
Keinz P (2015) Auf den Schultern von … Vielen! Crowdsourcing als neue Methode in der Neuproduktentwicklung. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 67(1):35–69. https://doi.org/10.1007/BF03372915
Melzer A, Heim Y, Sanders T, Bullinger-Hoffmann AC (2019) Zur Zukunft des Kompetenzmanagements. In: Bullinger-Hoffmann AC (Hrsg) 2019. Zukunftstechnologien und Kompetenzbedarfe. Kompetenzentwicklung in der Arbeitswelt 4.0. Springer Nature, S 11–26
Metzger M (2016) Organisationsentwicklungsmaßnahmen in der strategischen Personalplanung von Schlüsselkompetenzen. Igel Verlag RWS, Hamburg
Otte A, Schröter W (2019) Lebende Konzernbetriebsvereinbarung als soziale Innovation. Internes Crowdsourcing in der GASAG-Gruppe. In: Schröter W (Hrsg) Der mitbestimmte Algorithmus. Gestaltungskompetenz für den Wandel der Arbeit. Mössingen 2019, S 185–212
Schröter W (2018) Einführung der 4.0-Prozesse. In: „Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland“. Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verantwortung“ (Hrsg) Potenzialanalyse Arbeit 4.0. Künstliche Intelligenz für die produktive und präventive Arbeitsgestaltung nutzen: Ein Selbstbewertungscheck zur Einführung der neuen 4.0-Technologien. Heidelberg 2018, S 20
Schröter W (2019) „Offensive Mittelstand“ in der „Umsetzungshilfe Arbeit 4.0. 4.0-Prozesse und agiles kooperatives Change Management (2.1.4), https://www.offensive-mittelstand.de/fileadmin/user_upload/pdf/uh40_2019/2_1_4_kooperatives_changemanagement.pdf.
Ulbrich H, Wedel M (2020a) Entwurf eines Prozess- und Rollenmodells für internes Crowdsourcing. In: Daum M, Wedel M, Zinke-Wehlmann C, Ulbrich H (Hrsg) Gestaltung vernetzt-flexibler Arbeit. Beiträge aus Theorie und Praxis für die digitale Arbeitswelt. Springer Vieweg, Berlin
Ulbrich H, Wedel M (2020b) Design of a process and role model for internal crowdsourcing. In: Ulbrich H, Wedel M, Dienel H-L (Hrsg) Internal crowdsourcing in companies. Theoretical foundations and practical applications. Springer Nature, Berlin
Wedel M (2016) The European integration of res-e promotion: the case of Germany and Poland. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden
Wedel M, Ulbrich H (2020a) Erste Systematisierungsansätze für die Beschreibung eines modellhaften Crowdsourcing-Systems im Zusammenhang mit der Steuerung von Crowdsourcing. In: Daum M, Wedel M, Zinke-Wehlmann C, Ulbrich H (Hrsg) Gestaltung vernetzt-flexibler Arbeit. Beiträge aus Theorie und Praxis für die digitale Arbeitswelt. Springer Vieweg, Berlin
Wedel M, Ulbrich H (2020b) Systematization approach for the development and description of an internal crowdsourcing system. In: Ulbrich H, Wedel M, Dienel H-L (Hrsg) Internal crowdsourcing in companies. Theoretical foundations and practical applications. Springer Nature, Berlin
Wegerich C (2015) Strategische Personalentwicklung in der Praxis. Instrumente, Erfolgsmodelle, Checklisten, Praxisbeispiele. 3rd Edition. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43699-8
Zhu H, Djurjagina K, Leker J (2014) Innovative behaviour types and their influence on individual crowdsourcing performances. Int J Innov Manage 18(06):1–18. https://doi.org/10.1142/S1363919614400155
Zhu H, Nathalie S, Jens L (2016) How to use crowdsourcing for innovation?: A comparative case study of internal and external idea sourcing in the chemical industry. In: Kocaoglu DF (Hrsg) Technology management for social innovation: PICMET’16: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology : proceedings. IEEE , Piscataway, NJ
Zuchowski O, Posegga O, Schlagwein D, Fischbach K (2016) Internal crowdsourcing: conceptual framework, structured review, and research agenda. J Inf Technol 31(2):166–184. https://doi.org/10.1057/jit.2016.14
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2021 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Wedel, M. et al. (2021). Internes Crowdsourcing in Unternehmen. In: Bauer, W., Mütze-Niewöhner, S., Stowasser, S., Zanker, C., Müller, N. (eds) Arbeit in der digitalisierten Welt. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62215-5_22
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62215-5_22
Published:
Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-62214-8
Online ISBN: 978-3-662-62215-5
eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)