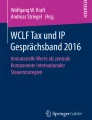Zusammenfassung
Lange Zeit galt der Schadensersatz bei Verletzung von Immaterialgüterrechten als Schwachstelle im Rechtsschutzsystem des italienischen Immaterialgüterrechts. Der Aufsatz zeichnet vor dem Hintergrund der geltenden Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung den Weg zur ausführlichen Regelung des Schadensersatz- und Gewinnabschöpfungsanspruchs des Rechtsinhabers bei Verletzung von gewerblichen Schutzrechten nach. Der Beitrag weist auf praktische Probleme bei der Durchsetzung des bereicherungsrechtlich konzipierten Anspruchs auf Gewinnabschöpfung hin, die den Rechtsinhaber weiterhin vor eine Reihe von Herausforderungen stellen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Lange Zeit galt der Schadensersatz bei Verletzung von Immaterialgüterrechten als Schwachstelle im Rechtsschutzsystem des italienischen Immaterialgüterrechts. Der Aufsatz zeichnet vor dem Hintergrund der geltenden Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung den Weg zur ausführlichen Regelung des Schadensersatz- und Gewinnabschöpfungsanspruchs des Rechtsinhabers bei Verletzung von gewerblichen Schutzrechten nach. Der Beitrag weist auf praktische Probleme bei der Durchsetzung des bereicherungsrechtlich konzipierten Anspruchs auf Gewinnabschöpfung hin, die den Rechtsinhaber weiterhin vor eine Reihe von Herausforderungen stellen.
1 Grundsätze
1.1 Rechtsgrundlagen
Im italienischen Recht galt der Ersatz von Schäden bei Verletzung von Immaterialgüterrechten über lange Zeit als dunkle und wenig rationale Seite,Footnote 1 auch als punctum dolens oder gar als „schwarzes Loch“Footnote 2 des Rechtsschutzes im Immaterialgüterrecht. Dies änderte sich erst im Jahr 2005, als mit D. lgs. vom 10.02.2005, Nr. 30 der Codice della proprietà industrialeFootnote 3 (kurz: c.p.i.) erlassen wurde. Mit der Umsetzung des Art. 13 der sog. Durchsetzungs-RL der EG (Enforcement-RL, 2004/48/EG) gibt es seit 2006 in Art. 125 c.p.i. eine ausführliche Regelung des Schadensersatz- und Gewinnabschöpfungsanspruchs des Rechtsinhabers bei Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten (proprietà industriale). Im Urheberrechtsgesetz (L. 22.04.1941, Nr. 633, kurz. l.a.), das im Gegensatz zum Marken- und Patentrechtsgesetz nicht im Codice della proprietà industriale aufgegangen ist, wurde Art. 158 l.a. entsprechend angepasst.
1.2 Entwicklung der Rechtsprechung bis 2005
In der Zeit bis 2005 bzw. vor der Umsetzung der Durchsetzungs-RL im Jahr 2006 gab es in Italien lediglich rudimentäre, auf das allgemeine Schadensersatzrecht verweisendeFootnote 4 Vorschriften im Urhebergesetz,Footnote 5 PatentgesetzFootnote 6 und Markengesetz.Footnote 7 Sehr rasch erkannte man allerdings, dass in vielen Fällen der zu leistende Schadensersatz weit unter dem vom Verletzer erzielten Gewinn lag. Dies war nicht nur der äußerst schwierigen Beweisführung geschuldet, sondern lag auch daran, dass nach der im Schadensrecht geltenden Differenztheorie nur Vermögensnachteile des Geschädigten auszugleichen sind. Nun kann es aber vorkommen, dass ein solcher Nachteil entweder gar nicht beweisbar ist, weil der Rechtsinhaber keine Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat oder die Umsatzeinbußen nur geringfügig ausfallen, sodass der Rechtsverletzer den erzielten Gewinn im Wesentlichen behalten kann. Im Ergebnis bedeutet dies freilich, dass sich die Rechtsverletzung für den Verletzer in vielen Fällen wirtschaftlich lohnte, sodass von der Schadensersatzpflicht kein effektiver negativer Anreiz zur Verhinderung von künftigen Rechtsverletzungen ausgehen konnte.
Nun kann man diesem misslichen Umstand entgegenhalten, dass das Schadensersatzrecht, anders als etwa das Strafrecht, eben nicht das Ziel verfolgt, den Verletzer vor Wiederholungshandlungen abzuschrecken, sondern in erster Linie den Geschädigten schadensfrei stellen will.Footnote 8 Dies bedeutet, dass im Rahmen der sog. Ausgleichungsfunktion (funzione compensativa) der durch die Verletzungshandlung verursachte Vermögensnachteil beim Geschädigten mit einer Schadensersatzleistung auszugleichen ist. Für eine Abschöpfung des Gewinns beim Verletzer bleibt damit im klassischen Schadensersatzrecht kein Raum.
Ungeachtet dieses systematischen Arguments gegen eine Gewinnabschöpfung im Rahmen des Schadensersatzrechts hat die Rechtsprechung schon vor 2005 die Notwendigkeit erkannt, auch vom Verletzer erzielte Gewinne bei der Berechnung des Schadensersatzes einzubeziehen. Dass damit die Systematik des allgemeinen Schadensersatzrechts verzerrt wurde, nahm man in Kauf.Footnote 9 Dafür bediente man sich einer Reihe von Fiktionen. So hat etwa die Corte d’Appello di Milano entschieden, dass der bei der Bemessung des Schadensersatzes zu berücksichtigende entgangene Gewinn (lost profits) den gesamten Gewinn des Verletzers umfasse. Hierfür wurde fingiert, dass der Rechtsinhaber den Gewinn des Rechtsverletzers vollständig auch selbst erzielt hätte.Footnote 10 In anderen Entscheidungen, besonders im Urheberrecht aber auch im Markenrecht, wurde das Kriterium eines angemessenen Entgelts (giusto prezzo del consenso) für die Nutzung im Wege der sog. Lizenzanalogie als Kriterium für die Berechnung des entgangenen Gewinns herangezogen. Damit berechnete man den entgangenen Gewinn des Geschädigten auf der Grundlage des Betrages, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte zahlen müssen, um mit Erlaubnis des Rechtsinhabers das Recht nutzen zu können (royalties).Footnote 11 In einer weiteren Gruppe von Fällen wurde der entgangene Gewinn des Geschädigten im Rahmen des nach Billigkeit zu bemessenden Schadens jedenfalls mit dem vom Verletzer erzielten Gewinn gleichgesetzt.Footnote 12 Die Grenzen dieser Auslegung lassen sich allerdings anhand eines einfachen Beispiels aufzeigen: Wenn die Rechtsverletzung durch einen großen Konzern erfolgt, der über viel bedeutendere Verkaufs- und Vermarktungswege verfügt als der Rechtsinhaber, läuft die Behauptung, der Rechtsinhaber hätte denselben Gewinn erzielen können, ins Leere.Footnote 13 Man denke etwa an einen multinationalen Konzern, der das Patent eines kleinen Unternehmens verwendet, um es weltweit zu vermarkten, während das kleine Unternehmen selbst niemals die Kapazität gehabt hätte, einen so großen Markt zu bedienen.Footnote 14
1.3 Gewinnabschöpfung als Bereicherungsanspruch
In der Lehre wurde daher der Versuch unternommen, die Gewinnabschöpfung auf eine überzeugendere Grundlage zu stellen, indem man sie als besonderen Bereicherungsanspruch außerhalb des Schadensersatzrechts gemäß Art. 2041, 2042 c.c. qualifizierte.Footnote 15 Diese Systematisierung der Gewinnabschöpfung als vom Schadensersatzrecht zu trennender Bereicherungsanspruch gewann vor allem bei der Ausarbeitung der im Jahr 2005 in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Regelung an Bedeutung,Footnote 16 während sie von der Rechtsprechung kaum rezipiert wurde.
1.4 Zwischenergebnis
Das bis 2005 nach den Grundsätzen des Schadensersatzrechts operierende System führte jedenfalls zu keinem befriedigenden Ergebnis, denn trotz der systematischen Verzerrungen, die das Schadensersatzrecht über sich ergehen lassen musste, scheiterte der Anspruch auf Gewinnabschöpfung häufig an der Beweisproblematik. Es war schlicht unmöglich nachzuweisen, ob und in welchem Ausmaß der Verletzer durch die Verletzungshandlung Gewinn erzielt hatte und selbst wenn in den wenigen Entscheidungen ein Schadensersatzanspruch zuerkannt wurde, blieb er häufig sehr gering,Footnote 17 sodass das italienische Rechtssystem auch als „Paradies“ für Verletzer von Immaterialgüterrechten bezeichnet wurde.
2 Schadensersatz und Gewinnherausgabe gem. Art. 125 c.p.i.
2.1 Rechtsrahmen
Das unterschiedliche Schutzniveau des geistigen Eigentums in den Mitgliedstaaten der EU veranlasste die Europäische Gemeinschaft, auch in Anbetracht der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), in diesen Bereich mit der Durchsetzungs-RL einzugreifen. Die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde nämlich als zentral für den Erfolg des Binnenmarkts angesehen.Footnote 18
Die für die Ausarbeitung des c.p.i. beauftragte Expertenkommission beschloss zunächst eine Formulierung des Art. 125 c.p.i., wonach neben dem Schadensersatzanspruch auch ein eigenständiger Bereicherungsanspruch für die Herausgabe des Verletzergewinns gesetzlich verankert werden sollte.Footnote 19 Im Laufe der Gesetzwerdung wurde dieser Anspruch allerdings wieder gestrichen und der Verletzergewinn lediglich zu einem für die Bestimmung des entgangenen Gewinns relevanten Element herabgestuft.
Ein Jahr später erfolgte dann mit der Umsetzung der Durchsetzungs-RL in ItalienFootnote 20 eine Novellierung des Art. 125 c.p.i. (nicht jedoch des Art. 158 l.a.), wonach vom Verletzer erzielte Gewinne alternativ zum Ersatz des entgangenen Gewinns oder jedenfalls in dem darüber hinausgehenden Teil zurückgefordert werden können (Art. 125 Abs. 3 c.p.i.).Footnote 21 Auch die Überschrift des Art. 125 c.p.i. wurde angepasst und bezieht sich nunmehr ausdrücklich auf den Schadensersatz und die Rückerstattung der Gewinne.Footnote 22 Der italienische Gesetzgeber entfernte sich damit insofern von der Systematik der Durchsetzungs-RL und selbst von Art. 45 TRIPS, als er für die Rückerstattung der Gewinne nicht darauf abstellt, ob die Rechtsverletzung wissentlich oder unwissentlich erfolgt ist.Footnote 23
2.2 Systematik der Anspruchsgrundlagen in Art. 125 c.p.i.
Art. 125 c.p.i. enthält zwei voneinander zu unterscheidende Anspruchsgrundlagen.Footnote 24 Abs. 1 räumt dem Rechtsinhaber einen Schadensersatzanspruch nach den Haftungsvoraussetzungen des allgemeinen Zivilrechts ein (Art. 2043 ff c.c.).Footnote 25 Der Rechtsinhaber hat somit zu beweisen, dass der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat (Verschulden) und dass er durch die Verletzungshandlung einen Schaden erlitten hat (rechtswidrige Verletzung, Kausalität und Schaden).
Bei der Schadensberechnung sind gemäß Art. 1223 c.c. sowohl der positive Schaden (perdita subita) als auch der entgangene Gewinn (mancato guadagno) zu berücksichtigen. Im Rahmen des positiven Schadens sind ersatzfähig: die vom Rechtsinhaber aufgewendeten Kosten für die Entdeckung und den Beweis der VerletzungFootnote 26 sowie die Rechtsverfolgungskosten, durch die Rechtsverletzung frustrierte Aufwendungen (Werbung, Einrichtung von Geschäften, Abteilungen etc.); Verletzungsbeseitigungskosten (Werbung (pubblicità ricostruttiva), Kosten für Aussendungen und Broschüren). Als entgangener Gewinn sind auch jene Gewinnverluste zu berücksichtigen, die durch den Verkaufsrückgang von Nebenprodukten zum Hauptprodukt eingetreten sind,Footnote 27 sowie Verluste durch price erosion (Preisverfall durch das gefälschte Produkt am Markt) und bridge head sales (Gewinnrückgang durch die vom Rechtsverletzer durch die Rechtsverletzung errungene Marktposition).
Bei der Berechnung der Schadenshöhe sollen alle relevanten Umstände berücksichtigt werden, so etwa die negativen wirtschaftlichen Folgen einschließlich des entgangenen Gewinns des Rechtsinhabers, die vom Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielten Vorteile sowie unter Umständen der Nichtvermögensschaden des Rechtsinhabers. In Bezug auf die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ist allerdings unklar, worin dieser immaterielle Schaden bestehen soll, denn auch eine Beeinträchtigung des guten RufsFootnote 28 oder Bildes eines Unternehmens am Markt oder einer Marke wird sich letztlich auf den Umsatz niederschlagen und somit als Vermögensschaden zu qualifizieren sein.Footnote 29 Indes spielt der Schadensersatz für immaterielle Schäden wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten nach Auskunft von Praktikern in der Anwendungspraxis eine große Rolle, wohl in erster Linie deshalb, weil diesbezüglich die im Übrigen geltenden hohen beweisrechtlichen Hürden hinsichtlich der Existenz und Höhe des geltend gemachten Schadens leichter überwunden werden können. Bei Urheberrechtsverletzungen sind Nichtvermögensschäden dagegen leichter von den Vermögensschäden zu trennen. Ihr Ersatz ist ebenso ausdrücklich vorgesehen (Art. 158 Abs. 3 l.a.).Footnote 30
Art. 125 Abs. 3 c.p.i. räumt dem Rechtsinhaber dagegen einen eigenständigenFootnote 31 Anspruch ein, der zum Zweck der Gewinnabschöpfung gegen den Verletzer gerichtet ist und zwar entweder alternativ zum Schadensersatzanspruch oder gemeinsam mit dem Schadensersatzanspruch für jenen Teil der vom Verletzer erzielten Gewinne, die über den Ersatz für den entgangenen Gewinn hinausgehen. Dabei handelt es sich jedenfalls um einen vom Schadensersatzanspruch getrennten und somit autonomen Anspruch,Footnote 32 der nicht auf den Ausgleich eines erlittenen Schadens gerichtet ist, sondern auf Herausgabe eines Gewinns, der aus der Verletzung des Rechts stammt und aus diesem Grund dem Rechtsinhaber zuzuordnen ist.Footnote 33 In der Lehre wird der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns als sondergesetzlich geregelter BereicherungsanspruchFootnote 34 oder, nach überzeugender Ansicht, als ein Fall der Abschöpfung von Vermögensvorteilen wegen unrechtmäßiger Bereicherung (rimedio speciale per arricchimento ingiusto) qualifiziert.Footnote 35
2.3 Schadensbemessung: Billigkeit und Lizenzanalogie
Nachdem der Schaden aufgrund der schwierigen Beweisführung häufig in seiner Höhe nicht genau bestimmbar ist, kann das Gericht die Schadenshöhe auch nach Billigkeit bemessen (Art. 1226 c.c., Verweis in Art. 125 Abs. 1 c.p.i.). Indes ist darauf hinzuweisen, dass der Rechtsinhaber nach ganz herrschender Ansicht dadurch nicht von seiner Beweislast bezüglich der Existenz des Schadens und der Kriterien für die Billigkeitsbemessung befreit wird.Footnote 36 Aus diesem Grund kann das Schadensersatzbegehren des Rechtsinhabers scheitern, wenn nicht zumindest die Voraussetzung (nämlich das Bestehen eines Schadens) für eine Schadensbemessung nach Billigkeit bewiesen wird.Footnote 37 Als derartige Grundlage wurde allerdings auch schon der Beweis angesehen, dass die mittels Rechtsverletzung hergestellten Erzeugnisse vermarktet wurden, womit der Schaden bereits durch den Beweis der Rechtsverletzung in seinem Bestand implizit (in re ipsa) belegt ist.Footnote 38
Alternativ besteht in Fällen, in denen ein höherer Schaden nicht bewiesen werden kann, die Möglichkeit gemäß Art. 125 Abs. 2 c.p.i. eine Globalbemessung des Schadens (lump sum) zu verlangen. Demnach kann neben einer Pauschalsumme für den aus den Verfahrensakten resultierenden positiven Schaden auch ein Betrag für den entgangenen Gewinn zugesprochen werden. Der entgangene Gewinn ist im Wege der Lizenzanalogie (royalty virtuale) zu bemessen, d. h. er ist so zu berechnen, dass er nicht unter dem Betrag liegt, den der Verletzer als Lizenzgebühr für die Rechtsnutzung zahlen hätte müssen.Footnote 39 Problematisch an dieser Berechnungsmethode ist jedoch, dass sie den Rechtsverletzer tendenziell begünstigt, denn eine nach Marktkriterien berechnete Lizenzgebühr wird den Lizenznehmer nie zur Herausgabe des gesamten Gewinns zwingen.Footnote 40 Eine Lizenzgebühr wird zu Marktbedingungen nämlich vernünftigerweise immer nur so hoch sein können, dass der Lizenznehmer nach Abzug der Produktionskosten und Lizenzgebühr auch noch einen Gewinn erzielen kann. Darüber hinaus bewirkt dieses Kriterium eine AushöhlungFootnote 41 des ausschließlichen Nutzungsrechts des Rechtsinhabers, weil sich jeder auch gegen den Willen des Rechtsinhabers die Möglichkeit der Rechtsnutzung durch Zahlung einer fiktiv zu berechnenden Lizenzgebühr verschaffen kann.Footnote 42
Bei der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr wenden die Gerichte unterschiedliche Kriterien an. Während einzelne Gerichte nach Billigkeit und ohne weitere Begründung eine bestimmte Summe als Prozentsatz des rechtswidrig erzielten Umsatzes (z. B. 5 oder 10 %) festsetzen,Footnote 43 ziehen andere Gerichte Sachverständige heran, um die am Markt üblichen Lizenzgebühren zu ermitteln.Footnote 44 Diese Summe wird sodann, ohne dass das Gesetz dies ausdrücklich erlaubt, fallweise noch weiter angehoben, um zu vermeiden, das der Rechtsverletzer aus dieser für ihn jedenfalls günstigen Berechnungsmethode Vorteile ziehen kann.Footnote 45 So verdoppelte etwa das Landesgericht Mailand die mit 5 % bezifferte marktübliche Lizenzgebühr auf 10 %, um dem Verletzer nicht dieselbe Behandlung zukommen zu lassen, wie demjenigen, der auf rechtmäßige Weise eine Lizenz zu marktüblichen Preisen erwirbt.Footnote 46 Das Landesgericht Turin erhöhte die Lizenzgebühr von 5 % auf 7 %, weil der Verletzer trotz Unterlassungsaufforderung durch den Rechtsinhaber die Rechtsverletzung fortgesetzt hatte. Ein einheitliches Bemessungsschema für die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr hat sich bisher allerdings nicht durchsetzen können. Im Jahr 2017 hat der EuGH in einem Vorabentscheidungsverfahren festgehalten, dass eine nationale Regelung, die bei der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr einen Aufschlag von 100 % auf die marktübliche Lizenzgebühr vorsieht, mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.Footnote 47 Vor diesem Hintergrund ist diese italienische Rechtsprechung als richtlinienkonform anzusehen, wenngleich sie im italienischen Recht keine gesetzliche Grundlage hat und somit Ergebnis richterlicher Rechtsfortbildung ist.
2.4 Gewinnabschöpfung: disgorgement of profits
Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns hängt anders als in Art. 13 Abs. 2 Durchsetzungs-RL in Art. 125 c.p.i. nicht davon ab, ob der Verletzer von seiner Verletzungshandlung nicht wusste oder nicht vernünftigerweise wissen hätte müssen. Die Durchsetzungs-RL wurde insofern in Italien überschießend umgesetzt, was wegen einer möglichen Überschreitung des Ermächtigungsgesetzes auch verfassungsrechtliche Bedenken ausgelöst hat.Footnote 48 Der Anspruch kann alternativFootnote 49 zum Schadensersatzanspruch für entgangenen Gewinn bzw. in Ergänzung zum Schadensersatzanspruch für entgangenen Gewinn geltend gemacht werden, sofern der Ersatz für den entgangenen Gewinn unter dem Verletzergewinn bleibt. Der Anspruch auf Gewinnabschöpfung lässt den Anspruch auf Ersatz des positiven Schadens jedenfalls unberührt.
Während das Gesetz lediglich von Rückerstattung der Gewinne spricht und somit offen lässt, ob damit alle Gewinne gemeint sind oder nur jene, die unmittelbar aus der Rechtsverletzung folgen, geht die herrschende Lehre davon aus, dass nur jener Gewinn herausverlangt werden kann, der in unmittelbar kausalem Zusammenhang mit der Rechtsverletzung steht.Footnote 50 In der Rechtsprechung wird dies aufgrund einer insgesamt unterkomplexen Diskussion der Problematik häufig nicht hinreichend berücksichtigt.Footnote 51
Im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen ist die Gewinnabschöpfung als eigenständiger Anspruch nicht explizit vorgesehen (Art. 158 l.a.). Sehr wohl sieht Art. 158 l.a. aber die Berücksichtigung des Verletzergewinns bei der Bestimmung der Höhe des entgangenen Gewinns im Rahmen der Schadensberechnung vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass somit der Verletzergewinn in die Berechnung der Schadenshöhe nur dann einfließen kann, wenn die Rechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde und alle weiteren Voraussetzungen für die Verschuldenshaftung vorliegen.Footnote 52 Ein autonomer, verschuldensunabhängiger Anspruch auf Gewinnabschöpfung lässt sich aus dieser Bestimmung nicht ableiten und könnte nur aufgrund der allgemeinen bereicherungsrechtlichen Vorschriften konstruiert werden.Footnote 53
2.5 Praktische Probleme bei der Durchsetzung dieser Ansprüche
Die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen im Falle einer Rechtsverletzung stellt den Rechtsinhaber in jedem Fall vor große Herausforderungen. Dies hat sich auch mit der neuen Rechtsgrundlage nicht wesentlich geändert. Nach der allgemeinen Regel der Beweislastverteilung obliegt es dem Rechtsinhaber als Kläger zu beweisen, dass er einen Schaden erlitten hat und dass dieser Schaden durch die Rechtsverletzung verursacht wurde. Somit genügt es nicht zu beweisen, dass ein Umsatzrückgang stattgefunden hat, sondern es muss darüber hinaus glaubhaft dargelegt werden, dass der Umsatzrückgang auf die Rechtsverletzung zurückzuführen ist.Footnote 54 Selbst wenn bewiesen werden kann, dass der Umsatzrückgang des Rechtsinhabers durch die Rechtsverletzung verursacht wurde, ist eine weitere Hürde zu nehmen, die darin besteht, die genaue Schadenshöhe zu ermitteln. Der Umsatzrückgang beim Rechtsinhaber entspricht nämlich in aller Regel nicht den Umsatzzuwächsen des Verletzers. Dies wäre nur dann der Fall, wenn es für das Produkt nur zwei Anbieter (den Rechtsinhaber und den Verletzer) am Markt gäbe und im Übrigen die Nachfrage konstant bliebe.Footnote 55 Indes liegen diese Voraussetzungen in der Realität fast nie vor, weil meist mehrere Anbieter unterschiedlicher, ersetzbarer Produkte am Markt miteinander konkurrieren und somit zu viele verschiedene Faktoren den Umsatz beeinflussen können. Zudem ist nicht die Umsatzeinbuße selbst, sondern der Bruttogewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) zu ermitteln, denn nur dieser könnte als entgangener Gewinn ersetzt werden. Footnote 56 Selbst der Ersatz des positiven Schadens, wie etwa der Kosten für die Aufdeckung der Rechtsverletzung, könnte sich bei verschiedenen, unabhängig voneinander agierenden Verletzern schwierig gestalten. Sie haften nämlich nicht solidarisch, sodass jedem getrennt ein Teil dieser Kosten zuzurechnen wäre, wobei sich fragt, nach welchen Kriterien hier eine Aufteilung der entstandenen Kosten erfolgen soll. Besonders komplex, aber in der Praxis häufig, ist auch der Fall, dass die Rechtsverletzung lediglich einen Teil eines Produkts betrifft.Footnote 57 In diesem Fall ist für die Ermittlung der Gewinneinbuße des Rechtsinhabers auf die Bedeutung dieses Produktteils für den Umsatz abzustellen. Bei alledem erweist sich nicht nur die Ermittlung der Umsatzdaten, insbesondere jener des Rechtsverletzers, sondern auch die Interpretation und Ergänzung derselben zur Ermittlung des entgangenen Gewinns als besonders diffizil und macht somit jedenfalls die Beiziehung von Sachverständigen notwendig. Die Gerichte können sich dabei zwar mit einer Billigkeitsbemessung des Schadens gemäß Art. 125 Abs. 1 c.p.i. behelfen, indes ist auch dafür der Beweis zumindest eines durch die Rechtsverletzung verursachten Schadens erforderlich.
Auch im Zusammenhang mit der Ermittlung des unrechtmäßig erwirtschafteten Gewinns des Verletzers sieht sich der Rechtsinhaber mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Denn hierfür wäre ein freier Zugang zu den Buchhaltungsunterlagen des Verletzers erforderlich und selbst dieser Zugang könnte unzureichend sein, wenn etwa versucht wurde, den aufgrund der Rechtsverletzung erzielten Umsatz zu verschleiern. Die entsprechenden prozessrechtlichen Erleichterungen (Art. 121, 121-bis c.p.i. sowie allgemein Art. 210 c.p.c) sehen zwar die Möglichkeit vor, dass die Vorlage von Beweisurkunden der beklagten Partei gerichtlich angeordnet werden kann. Allerdings erfordern sie stets die Angabe schwerer Indizien sowie die genaue Bezeichnung der vorzulegenden Unterlagen, sodass die notwendige Beweiserleichterung für den Rechtsinhaber nicht die erhofften Wirkungen zeigen kann.Footnote 58
3 Fazit
Der italienische Gesetzgeber hat mit einer überschießenden Umsetzung der Durchsetzungs-RL versucht, den Schutz der Immaterialgüterrechte zu stärken. Indes hat dies angesichts der erheblichen Beweisschwierigkeiten in diesen Verfahren bisher nicht den erhofften Erfolg gezeigt. Das italienische Recht kennt nun zwar einen verschuldensunabhängigen Gewinnabschöpfungsanspruch, dessen Durchsetzung erweist sich aber in der Praxis mitunter als besonders steinig und hürdenreich. Prozessrechtliche Erleichterungen, die über die bereits vorgesehenen Maßnahmen hinausgehen, könnten diesbezüglich eine Wende herbeiführen.Footnote 59 So lange aber wird es für den Rechtsinhaber stets mit einem großen Kostenrisiko verbunden sein, sich auf einen Prozess gegen Rechtsverletzer einzulassen. Hinzu kommt die insgesamt lange Verfahrensdauer, sodass eine effiziente Abschreckung der Rechtsverletzer durch Schadensersatz- oder Gewinnabschöpfungsansprüche nicht bewirkt werden kann und das Kostenrisiko für Rechtsverletzer somit sehr überschaubar bleibt. Im Gegenzug dazu erweist sich aber gerade für kleinere und mittlere Unternehmen das Prozesskostenrisiko als eine wahre Hürde für die gerichtliche Durchsetzung ihrer Ansprüche. Wenn die Rechtsprechung in einzelnen Fällen und zuletzt wieder vermehrt den Beweis des Schadens bereits mit der Feststellung der Rechtsverletzung als erbracht ansieht,Footnote 60 ergibt sich daraus freilich eine Erleichterung für die Rechtsdurchsetzung des Rechtsinhabers. Indes handelt es sich dabei um eine mit der Systematik und Funktion des Schadensersatzrechts nicht vereinbare Konstruktion, weil sie auch unabhängig von einem konkret eingetretenen wirtschaftlichen oder immateriellen Nachteil zu einem systemfremden Schadensersatzanspruch führt und diesem damit eine gesetzlich nicht vorgesehene Straffunktion zuweist.
Notes
- 1.
Schiesaro (2012), Danni e restituzioni nella violazione della proprietà intellettuale. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, S. 799.
- 2.
Rapisardi (2004), Il risarcimento del danno da contraffazione brevettuale. In: Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale, Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà industriale. Atti del convegno organizzato dalla SISPI 20.-22. Marzo 2003. Giuffrè, Milano, S. 213.
- 3.
Dabei handelt es sich freilich nicht um eine Kodifikation im klassischen Sinne, sondern vielmehr um eine Kompilation, d. h. eine Gesetzessammlung zur Systematisierung und Verbesserung der Übersichtlichkeit der Rechtsquellen einer bestimmten Materie (codice di settore). Zu dieser neuen Form von Kodifikation vgl. Zaccaria (2005), Dall’„età della decodificazione“ all’„età della ricodificazione“: a proposito della legge n. 229 del 2003. Studium Iuris, S. 697 ff.
- 4.
Floridia (2012), Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale. Il Diritto Industriale, S. 6.
- 5.
Art. 158 a.F. l.a.: „Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.“
- 6.
Art. 66 Abs. 2 L. 21.06.1942, Nr. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d’impresa): „La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.“
- 7.
Art. 86 Abs. 1 R.D. 29.06.1939, Nr. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali): „La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.“
- 8.
Dazu zuletzt Cass. sez. un. 05.07.2017, Nr. 16601, in Resp.civ.prev. 2017, 1198 ff., wonach der Schadensersatz im Zivilrecht in erster Linie Ausgleichsfunktion erfüllt, ausnahmsweise aber in den gesetzlich vorgesehenen Fällen auch Strafcharakter annehmen kann, sodass im Ausland zugesprochene punitive damages in Italien im Wege der Anerkennung ausländischer Entscheidungen nicht gegen den ordre public verstoßen und daher anerkannt werden können. Dazu ausführlich Christandl, Punitive damages und ordre public in Italien. Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Europarecht und Internationales Privatrecht 2018, S. 123 ff.
- 9.
Für einen Überblick vgl. Schiesaro 2012, S. 800 ff.
- 10.
C. App. Milano 01.02.1994, in Riv. dir. ind. 1994, II, 224; C. App. Milano 24.01.1997, in Giur.ann.dir.ind. 1997, n. 3647.
- 11.
Vgl. z. B. Trib. Roma 10.05.2005, in Dir. autore 2005, 517; C. App. Milano 28.05.1999, in Dir. autore 1999, 594.
- 12.
Trib. Milano 15.04.2002, in Dir. autore 2002, 472.
- 13.
Castronovo, La nuova responsabilità civile. Giuffrè 2006, S. 637.
- 14.
Floridia 2012, S. 8.
- 15.
Vgl. Plaia (2002), Proprietà intellettuale e risarcimento del danno. G. Giappichelli, Torino 2005; Nicolussi, Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell‘art. 45 TRIPS. Europa e diritto privato, S. 1003 ff.; Castronovo 2003, La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricchimento. Il Diritto Industriale, S. 7; Sirena (2003), L’efficienza dei rimedi civilistici a tutela del diritto d’autore: prospettive di una ridefinizione sistematica. Annali Italiani del Diritto d’Autore, della Cultura e dello Spettacolo, S. 520 ff.; Sirena 2006, S. 305 ff.; kritisch, weil damit die wesentlichen Probleme (insbesondere das Beweisproblem) ungelöst bleiben: Ponzarelli, La quantificazione dei danni nel caso di violazione del brevetto. In: Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale, Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà industriale. Atti del convegno organizzato dalla SISPI 20.–22. Marzo 2003. Giuffrè, Milano 2004, S. 240 f.
- 16.
Floridia 2012, S. 7 f.
- 17.
Schiesaro 2012, S. 804.
- 18.
Vgl. Erwägungsgründe 1 und 3 RL 2004/48/EG.
- 19.
Floridia 2012, S. 8.
- 20.
D. lgs. 16.03.2006, Nr. 140.
- 21.
Art. 125 Abs. 3 c.p.i.: „In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall‘autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.“ „In jedem Fall kann der Rechtsinhaber die Rückerstattung der vom Verletzer erzielten Gewinne alternativ zum Ersatz des entgangenen Gewinns verlangen oder in jenem Maß, in dem diese den Schadensersatz überschreiten.“ (eigene Übersetzung)
- 22.
„Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell‘autore della violazione“.
- 23.
Spolidoro (2009), Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 c.p.i. Rivista di Diritto Industriale, S. 153. Gemäß Art. 13 Durchsetzungs-RL kann die Herausgabe des Gewinns von den Mitgliedstaaten bei unwissentlichen Rechtsverletzungen vorgesehen werden.
- 24.
So ausdrücklich auch der begleitende Ministerialbericht zum D. lgs. 16.03.2006, Nr. 140: „Così facendo, la nuova norma dell’art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello – ben diverso – dell’arricchimento senza causa.“ Zitiert von Spolidoro 2009, S. 188.
- 25.
Cass. civ. 01.03.2016, Nr. 4048, in Resp.civ.prev. 2017, 175; Vanzetti und Di Cataldo (2009), Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale. Giurisprudenza Commerciale, S. 552. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten auch: Spolidoro 2009, S. 165 ff. Nach anderer, von Teilen der Lehre vertretener Ansicht handelt es sich um einen Fall der Haftung für gefährliche Tätigkeiten (Art. 2050 c.c.), die verschuldensunabhängig ist, weshalb ein Verschulden nicht bewiesen werden muss. Vgl. Für einen Überblick: Rovati (2016), Art. 125 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. In: Marchetti P, Ubertazzi LC, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. Wolters Kluwer, Milano, S. 696. Vgl. auch Romanato (2013), Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell’art 125 c.p.i. Rivista di Diritto Industriale, S. 26 f.
- 26.
Dazu zählen zum Beispiel die Kosten für Nachforschungen, Aufsicht und Dokumentation der Verletzung (Trib. Milano 26.02.2009, in Giur.ann.dir.ind. 2010, 112); Kosten für Rechtsberatung und Fachberatung (Trib. Milano 29.04.2014, n. 5518, dejure.it; Kosten für Marktforschungen, Kosten für Beweiserhebungen, interne Kosten im Zusammenhang mit der Rechtsdurchsetzung (Trib. Genova 01.07.2010, www.iusexplorer.it).
- 27.
Danno da vendite convogliate (convoyed sales): Trib. Milano 17.09.2009, in Giur.ann.dir.ind. 2009, 1156.
- 28.
Vgl. z. B. Cass. civ. 11.08.2009, Nr. 18218, in Riv. dir. ind. 2010, II, 147.
- 29.
Spolidoro 2009, S. 180.
- 30.
Der Ersatz von Nichtvermögensschäden wird von der Durchsetzungs-RL nicht ausgeschlossen, weshalb die nationalen Rechtsordnungen auch Nichtvermögensschäden im Falle der Verletzung geistigen Eigentums vorsehen können. EuGH 17.03.2016 (Liffers), C-99/15. Dazu Venanzoni (2018), Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d’autore: riflessioni a margine del caso Liffers. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, S. 587 ff.
- 31.
Gegen eine Qualifikation dieses Anspruchs als Unterfall des allgemeinen Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung mit bedeutenden Argumenten: Romanato 2013, S. 33 ff.
- 32.
In diesem Sinn auch Cass. civ. 01.03.2016, Nr. 4048, in Resp.civ.prev. 2017, 176.
- 33.
Zur Eigenständigkeit dieses Anspruchs vgl. Floridia 2012, S. 10; Schiesaro 2012, S. 806 ff.; Vanzetti und Di Cataldo 2009, S. 553; Di Cataldo 2008, S. 214; Romanato 2013, S. 32.
- 34.
Spolidoro 2009, S. 187 f.; Di Cataldo 2008, S. 214.
- 35.
Romanato 2013, S. 47.
- 36.
Rovati 2016, S. 699 f. Cass. civ. 16.06.2008, Nr. 16647, in Giur.ann.dir.ind. 2008, 202; Cass. civ. 08.07.2004, Nr. 12545, in Giust. civ. Mass. 2004, 7 f.; Trib. Milano 20.02.2009, in Riv. dir. ind. 2009, I, 375. Vgl. allerdings zuletzt Cass. civ. 20.05.2016, Nr. 10519, in Guida al diritto 2016, 40, 66, wonach es Aufgabe des Gerichts sei, nach Billigkeit den Schaden zu bemessen und im Übrigen der Schaden bei einer Markenverletzung auch in der Verletzung selbst (in re ipsa) bestehen könne.
- 37.
Cass. civ. 19.06.2008, Nr. 16647, in Foro it. 2008, I, 3181; Cass. civ. 08.07.2004, Nr. 12545, in Giur. it. 2005, 1436; Trib. Catania 11.03.2014, in Giur.ann.dir.ind. 2016, 890; Trib. Catania 24.07.2013, in Giur.ann.dir.ind. 2016, 456; Trib. Bologna 04.02.2011, in Giur.ann.dir.ind. 2011, 687; Trib. Torino 07.12.2007, in Sez. spec. P.I. 2008, 1, 352; Vanzetti und Di Cataldo 2009, S. 551.
- 38.
Cass. civ. 04.09.2017, Nr. 20716, in Riv. dir. ind. 2018, II, 238.
- 39.
Im Detail zu den unterschiedlichen Berechnungsmöglichkeiten: Casonato 2017, S. 304 ff. Wenn eine Lizenzgebühr nicht berechnet werden kann, weil zu Marktbedingungen niemals eine Lizenz vergeben worden wäre (z. B. bei direkten Konkurrenten auf demselben Markt), dann ist diese Bemessungsmethode nach Ansicht von C. App. Milano 06.12.2010, in Giur.ann.dir.ind. 2010, 912 nicht anwendbar und es solle auf den unrechtmäßig erzielen Gewinn des Rechtsverletzers abgestellt werden.
- 40.
Vanzetti und Di Cataldo 2009, S. 551.
- 41.
Im Sinne einer Verwandlung einer property rule in eine liability rule: dazu Calabresi und Melamed, Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review 1972, S. 1089 ff.
- 42.
Vanzetti und Di Cataldo 2009, S. 551 f.
- 43.
Vgl. z. B. Trib. Bologna 03.06.2013, in Giur.ann.dir.ind. 2016, 1, 416; Trib. Milano 24.07.2013, in Giur.ann.dir.ind. 2013, 1, 1155.
- 44.
Trib. Roma 30.03.2012, in Giur.ann.dir.ind. 2013, I 463. Dabei werden von einzelnen Sachverständigen bei der Berechnung ganz oder teilweise die Georgia Pacific Criteria (entwickelt in der US-amerikanischen Entscheidung Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)) herangezogen. Dabei handelte es sich um einen Rechtsinhaber, der bereits Lizenzen vergeben hatte. Studio Trevisan&Cuonzo (2017), Proprietà industriale, intellettuale e IT. Wolters Kluwer, Milano, S. 837 f.
- 45.
Zustimmend Di Cataldo 2008, S. 210; Spolidoro 2009, S. 185 f.
- 46.
Trib. Milano 09.01.2014, in Giur.ann.dir.ind. 2016, 1, 666.
- 47.
EuGH 25.1.2017 (Stowarzyszenie), C-367/15.
- 48.
Di Cataldo 2008, S. 212.
- 49.
Vgl. dagegen im Sinne eines subsidiären Anspruchs (nur wenn der Schadensersatz für entgangenen Gewinn zu einem unbefriedigenden Ergebnis führt und wenn der Rechtsinhaber beweist, dass der Gewinn des Verletzers die Summe des Ersatzes für entgangenen Gewinn übersteigt): Trib. Milano 16.07.2011, Giur.ann.dir.ind. 2011, 1, 1230.
- 50.
Vanzetti und Di Cataldo (2009), Manuale di diritto industriale. Giuffrè, Milano, S. 553; Di Cataldo 2008, S. 216; Casonato, Criteri di determinazione del danno da contraffazione. Contratto e Impresa 2017, S. 323; Romanato 2013, S. 52; Spolidoro 2009, S. 201 m.w.H.
- 51.
Vgl. z. B. Trib. Bologna, 20.10.2015, unveröffentlicht, abrufbar unter: http://www.studiolegale.leggiditalia.it, wo der gesamte Umsatz des Rechtsverletzers ohne weitere Begründung auf die Markenverletzung zurückgeführt wurde und somit herauszugeben war.
- 52.
Di Sabatino, Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto. La Responsabilità Civile 2009, S. 442 ff.
- 53.
Dazu allgemein Sirena (2006), La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano). Rivista di Diritto Civile, S. 305 ff.; im Überblick: Rovati (2016), Art 158 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore). In Marchetti P, Ubertazzi LC, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. Wolters Kluwer, Milano, S. 2105 f.
- 54.
Casonato 2017, S. 297; Rovati 2016a, S. 2104 f.; Trib. Napoli 24.07.2012, in Giur.ann.dir.ind. 2013, 1, 635; C. App. Milano 16.2.2012, in Sez. spec. P.I. 2012, 1, 316.
- 55.
Di Cataldo 2008, S. 206.
- 56.
Für eine ausführliche Diskussion der Berechnungskriterien: Casonato 2017, S. 299 ff.
- 57.
Di Cataldo 2008, S. 207. Für ein Beispiel aus der Praxis vgl. Cass. civ. 04.09.2017, Nr. 20716, in Riv. dir. ind. 2018, II, 238 (Verletzung eines Patents auf einen besonderen Aufhängmechanismus von Schiebetüren).
- 58.
Zu dieser Problematik vgl. Di Cataldo 2008, S. 217 f.
- 59.
Di Cataldo 2008, S. 217.
- 60.
Vgl. z. B. Cass. civ. 20.05.2016, Nr. 10519, in Guida al diritto 2016, 40, 66; Cass. civ. 04.09.2017, Nr. 20716, in Riv. dir. ind. 2018, II, 238.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2021 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Christandl, G. (2021). Schadensersatz und Gewinnherausgabe bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nach italienischem Recht. In: Laimer, S., Perathoner, C. (eds) Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht. Bibliothek des Wirtschaftsrechts, vol 1. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_9
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_9
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-62178-3
Online ISBN: 978-3-662-62179-0
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)