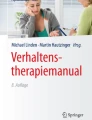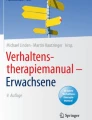Zusammenfassung
Euthym bedeutet wörtlich übersetzt: »was der Seele gut tut«. Euthymes Erleben ist durch Freude, Lust oder Wohlbefinden geprägt. Euthymes Verhalten kann individuell sehr unterschiedlich sein (z. B. Gespräch unter Freunden, Fensterputzen, Joggen, gutes Essen etc.). Genießen ist die euthyme Verhaltensweise schlechthin. Genuss wird durch drei Aspekte definiert: Genuss ist lustvoll, Genuss ist sinnlich, Genuss ist reflexiv. Genießen wird durch Sinne vermittelt, die blitzschnell eine positive Emotion auslösen können. Genuss muss insofern erlaubt sein, als eine Person euthymes Erleben und Verhalten als ein Bestandteil eines »guten Lebens« sieht und anstrebt. Die euthyme Therapie (e.t.) gründet auf dem Therapieprogramm »Kleine Schule des Genießens« (KSdG; zuerst Lutz und Koppenhöfer 1983). Ziel des kognitiven Aspekts der KSdG ist es, dass Patienten sich Genuss und letztendlich ein gutes Leben zugestehen
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Griechischer Philosoph, der missverständlich zitiert wird.
- 2.
Vorsicht: Selbst tugendhafte Werte können doppelbödig sein. Al Capone wird sein Leben als durchaus sinnerfüllt bezeichnet haben, und seine Mitarbeiter hatten aus ihrer Sicht ein überaus engagiertes Leben.
- 3.
Die Anmerkung einer Patientin bringt es auf den Punkt: »Man sollte mit einem Kurzsichtigen nicht über ein Gemälde diskutieren, solange der noch keine Brille hat.«
- 4.
S. Stichwort »Rosinenübung« im Internet.
- 5.
Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx, rechnete vor, dass 3 Stunden Arbeit zur Erzeugung der lebensnotwendigen Güter ausreichen. Die Erträge aus der »Mehr«-Arbeit flössen zum Kapitalisten; er forderte daher »Das Recht auf Faulheit« (Lafargue 1887)! Karl Marx (Theorien über den Mehrwert) empfiehlt, die freie Zeit solle zum Genuss, zur Muße und zur freien Entwicklung verwendet werden!
- 6.
Die Auswahl der Studien und weitere Befunde sind einzusehen unter http://www.rainerlutz.com
- 7.
Eine ausführliche Schilderung unter http://www.rainerlutz.com
Literatur
Zitierte Literatur
Antonovsky, A. (1993). Gesundheitsforschung versus Krankheitsforschung. In A. Franke & M. Broda (Hrsg.), Psychosomatische Gesundheit. 3–14. Tübingen: dgvt-Verlag.
Auhagen, A. E. (Hrsg.) (2008). Positive Psychologie. Weinheim: Beltz.
Bargh, J. A., Chen, M. & Burrows, L. (1996). Automaticity of social behavior: direct effects of trait construct and stereotype-activation on action. Journal of Personality and Social Psychology, 71(2), 230–244.
Bernhard, P., Kupka, U. & Lutz, R. (2001). Katamnese-Effekte stationärer Verhaltenstherapie. In M. Bassler (Hrsg.), Störungsspezifische Ansätze in der stationären Psychotherapie. 11–31. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. Oxford, GB: Pergamon.
Brummelman, E., Thomaes, S., Overbeck, G., Orobia de Castro, O., van den Hout, M. A. & Bushman, B. J. (2014). On feeding those hungry for praise: Person praise backfires in children with low self-esteem. Journal of Experimental Psychology: General 143, 9–14.
Gutberlet, S. (2008). Unterschiede von GenußgruppentherapeutInnen und anderen GruppentherapeutInnen in verhaltens- und personenzentrierten Merkmalen. Diplomarbeit, Philipps-Universität Marburg
Hagger, M. S., Wood, C., Stiff. C. & Chatzisarantis, N. L. (2010). Ego depletion and the strength model of self-control: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(4), 495–525.
Haupt, H. J., Lutz, R., Lebershausen, L. & Czegalla, U. (1991). Euthyme Behandlungsstrategie bei Schizophrenen. Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 16, 300–303.
Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2007). Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK. Weinheim: Beltz.
Jaramillo, J., Schmidt, R. & Kempter, R. (2014). Modeling inheritance of phase precession in the hippocampal formation. The Journal of Neuroscience, 34, 7715–7731.
Jürgens, B. & Lübben, K. (2014). Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche (GSK-KJ). Weinheim: Beltz.
Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M.,Siegelbaum, S. A. & Hudspeth, A.J. (2012). Principles of neural science. New York: McGrawhill.
Kanitschneider, B. (2011). Das hedonistische Manifest. Stuttgart: Hirtzel.
Keller, H. (2011). Kinderalltag. Kulturen der Kindheit und ihre Bedeutung für Bindung, Bildung und Erziehung. Berlin: Springer.
Lafargue, P. (1887). Das Recht auf Faulheit. Hottingen, Zürich, CH: Verlag der Volksbuchhandlungen.
LeDoux, J. E. (2009). Neural architecture of emotion. In D. Sander & K. R. Scherer (Hrsg.), The Oxford companion to emotion and the affective sciences (S. 276–279). Oxford, GB: University Press.
Lütgerhorst, H.-J. (1981). Kognitives Selbstsicherheitstraining als psychologische Behandlung im psychiatrischen Landeskrankenhaus: Die Veränderung von Verhalten, Gedanken und Gefühlen. In M. Hockel & F.-J. Feldhege (Hrsg.), Handbuch der angewandten Psychologie (S. 945–971). Landsberg: Moderne Industrie.
Lutz, R. (1998). Indikatoren von Gesundheit und Krankheit: zur Bedeutung des Itemformats. In J. Margraf, J. Siegrist & S. Neumer (Hrsg.), Gesundheits- oder Krankheitstheorie? Saluto- versus pathogenetische Ansätze im Gesundheitswesen (S. 85–99). Berlin: Springer.
Lutz, R. & Koppenhöfer, E. (1983). Kleine Schule des Genießens. In R. Lutz (Hrsg.), Genuß und Genießen (S. 112–125). Weinheim: Beltz.
Lutz, R. & Mark, N. (1995). Wie gesund sind Kranke? Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie.
Maltby, J., Day, L. & Macaskill, A. (2011). Differentielle Psychologie, Persönlichkeit und Intelligenz. München: Pearson.
Morgenroth, O. (2007). Zeit und Handeln. Psychologie der Zeitbewältigung. Stuttgart: Kohlhammer.
Paris, R. (2015). Der Wille des Einen ist das Tun des Anderen. Weilerswist: Velbrück.
Sani, F., Madhok, V., Norbury, M., Dugard, P. & Wakefield, J. R. H. (2014). Greater number of group identifications is associated with healthier behaviour: Evidence from a Scottish community sample. The British Psychological Society. DOI: 10.1111/bjhp.12119
Schwarz, N. (2011). Feelings-as-information theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski & E.T. Higgins (Hrsg.), Handbook of theories of social psychology. (S. 289–308). London, GB: Sage.
Seligman, M. E. P. (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon & Schuster.
Siegrist, J. (2015). Arbeitswelt und stressbedingte Erkrankungen. Forschungsevidenz und präventive Maßnahmen. München: Elsevier.
Sinha, C., Da Silva Sinha, V., Zinken, J. & Sampaio, W. (2011). When time is not space: The social and linguistic construction of time intervals and temporal event relations in an Amazonian culture. Language and Cognition 3(1), 137–169.
Solomon, R. L. (1980). The opponent-process theory of acquired motivation. The costs of pleasure and the benefits of pain. American Psychologist, 35, 691–712.
Stanovich, K. E. (2004). Balance in psychological research: The dual process perspective. Behavioral and Brain, Sciences, 27, 357–358.
Stanovich, K. E. (2011). Rationality and the reflective mind. Oxford, GB: University Press.
Stiftung für Zukunftsfragen (2014). Freizeitmonitor 2014. http://www.stiftungfuerzukunftfragen.de. Zugegriffen: 1. April 2015.
Stöhr, K. W., Kunze-Bechstätt, I. & Hoepfel-Reinhard, M. (1999). Darf Therapie Spaß machen? Genußgruppe mit schizophrenen Patienten auf einer soziotherapeutischen Station. In R. Lutz; N. Mark; U. Bartmann; E. Hoch; F.-M. Stark (Hrsg.), Beiträge zur Euthymen Therapie. (S. 137–147). Freiburg: Lambertus.
Strack, F., Schwarz, N. & Gschneidinger, E. (1985). Happiness and reminiscing: The role of time perspective, affect, and mode of thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 49(6), 1460–1469.
Walter, M. (2013). Funktionelle Magnetresonanztomographie in Ruhe. In O. Gruber & P. Falkai (Hrsg.) Systemische Neurowissenschaften in der Psychiatrie. (S. 75–87). Stuttgart: Kohlhammer.
Wolf, H. (2008). Interventionen auf dem Prüfstand. Psychiatriepatienten bewerten ihre Therapie. Diplomarbeit, Philipps-Universität Marburg.
Zok, K. (2010). Gesundheitliche Beschwerden und Belastungen am Arbeitsplatz. Ergebnisse aus Beschäftigtenbefragungen. Berlin: KomPart.
Weiterführende Literatur
Ansorge, U., Leder, H. (2017). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Heidelberg: Springer.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. Pedrotti, J. (Hrsg.). (2015). Handbook of positive psychology (3. Aufl.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer-Verlag GmbH Deutschland
About this chapter
Cite this chapter
Lutz, R. (2018). Euthyme Grundlagen der Verhaltenstherapie. In: Margraf, J., Schneider, S. (eds) Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 1. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54911-7_11
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-54911-7_11
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-54910-0
Online ISBN: 978-3-662-54911-7
eBook Packages: Medicine (German Language)