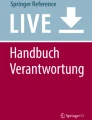Zusammenfassung
Dieser Beitrag befasst sich mit den Akteuren sowie den Inhalten und Schwerpunkten von Forschung und Lehre über die Außenpolitik Österreichs, die diesbezügliche Entwicklung nach 1945, und welchen Einfluss Forschung, Lehre und Vermittlung auf die Prozesse der Außenpolitik haben. Als eines der wesentlichen Ergebnisse wird dargestellt, dass die in Österreich erst in den 1970er Jahren etablierte politikwissenschaftliche Forschung mit ihren Analysen oft bewusst Einfluss auf die Ziele und Prozesse der Außenpolitik (z. B. humanitäre Außenpolitik, Europapolitik, Abrüstungsfragen) nehmen möchte und damit eine politische Agenda zumindest in Kauf nimmt, während völkerrechtliche und zeithistorische Analysen überwiegend außenpolitisches Handeln wissenschaftlich einordnen ohne einen Anspruch auf politische Einflussnahme zu stellen. Ein insgesamt geringer Einfluss von Forschung und Lehre auf außenpolitisches Handeln entspricht dem geringen Stellenwert von politischer Bildung im staatlichen Bildungskanon und den wenigen demokratischen Partizipationsmöglichkeiten an außenpolitischen Prozessen.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
1 Einleitung
Es gibt umfangreiche wissenschaftliche Literatur zur Außenpolitik Österreichs, die aus den unterschiedlichen Perspektiven der außenpolitischen Praxis, der Staats- und Rechtswissenschaften, der Geschichtsforschung und der Politikwissenschaft die außenpolitischen Prozesse beleuchtet. Zu den Theorien der Außenpolitikanalyse und zu der auf Österreich bezogenen wissenschaftlichen Literatur verweise ich auf den einführenden Beitrag der Herausgeber dieses Handbuches und auf den Abschnitt „Außenpolitik“ in dem 2006 erschienen Sammelband über „Politik in Österreich“ (Kramer 2006). In meinem Beitrag werden Spezifika zu Forschung und Lehre in Österreich dargestellt (von wem, wo und was wird in Österreich geforscht und gelehrt) und dabei die Frage gestellt, ob und gegebenenfalls welche Wirkungen diese wissenschaftlichen Aktivitäten auf die Außenpolitik Österreichs haben.
Tatsächlich zählt der Bereich „Außenpolitik“ zu den ältesten staatlichen Aktivitäten, aber eine gezielte wissenschaftliche Ausbildung zur Diplomatie als Beruf existierte erst in Ansätzen ab dem frühen 18. Jahrhundert (zunächst an französischen Universitäten und im Vatikan). Es war die Habsburgermonarchie, die 1754 als erster Staat eine „Orientalische Akademie“ (heute Diplomatische Akademie Wien) zur Ausbildung von Diplomaten errichtete. Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse, dass bei der Diskussion über die Wiedereröffnung der Diplomatischen Akademie 1963 vom damaligen österreichischen Außenminister Bruno Kreisky (SPÖ) ausdrücklich gefordert wurde, dass an dieser postgradualen Einrichtung nur Themen behandelt werden sollten, die nicht bereits an österreichischen Universitäten gelehrt werden. Eines dieser Themen, die vor der Eröffnung in einem Arbeitspapier über das Curriculum der Diplomatischen Akademie festgehalten wurden, lautete: „Die Grundlagen der österreichischen Außenpolitik“ (zitiert in Stourzh 2004, 188).
2 Erkenntnisleitende Fragestellungen
Das Thema dieses Beitrages besitzt traditionell in Österreich weder für die Wissenschafts- noch für die Außenpolitik Priorität. Zu den dafür in der Literatur zumeist genannten Gründen zählen neben der Kleinstaatlichkeit vor allem die Wahrnehmung von Außenpolitik als Politikbereich, in dem lange Zeit parteienübergreifende („bi-partisan“) Positionen vorherrschten, das mangelnde öffentliche bzw. mediale Interesse an Außenpolitik, die inhaltliche Konzentration auf wenige spezifische Aspekte und die disziplinären Dynamiken zwischen Jurist*innen, Historiker*innen und Politikwissenschaftler*innen.
Eine Analyse von Forschung und Lehre zu Außenpolitik in Österreich seit 1945 muss sich mit den Strukturen der wissenschaftlichen Einrichtungen und ihren Wandlungen als auch mit den Entwicklungen Österreichs im internationalen System befassen. Erkennbare Ausnahmen von der oben genannten fehlenden Priorität hängen mit historischen Wandlungsprozessen zusammen: Staatsvertrag und Neutralität (und Neutralitätspolitik) (Sturz und Mueller 2020), Etablierung der Politikwissenschaft in der Wissenschaftsstruktur (Höll 2004), Mitgliedschaft in der Europäischen Union (Müller und Maurer 2016; Jaeger 2020). Ich würde daher der vor allem von Helmut Kramer (2013, 2016) vertretenen These, dass erst in den letzten Jahrzehnten innenpolitische Überlegungen zum bestimmenden Faktor – und damit zur entscheidenden Beschränkung – der österreichischen Außenpolitik wurden, nur bedingt zustimmen. Die Dominanz innenpolitischer Faktoren besitzt eine Kontinuität, die zumindest bis in das Jahr 1955 und damit zu den Diskussionen über „Staatsvertrag“ und „Neutralität“ zurückreicht. In Forschung und Lehre wird dies am langen innerösterreichischen Kampf der Disziplinen – und auch Weltanschauungen – um die Analysekompetenz in der Außenpolitik deutlich.
Mit diesen Fragen beschäftigen sich die folgenden Hauptteile dieses Beitrages. Nach einer historischen Übersicht über die Entwicklung von Außenpolitikforschung und -lehre in Österreich werden die derzeitigen Strukturen und Inhalte beschrieben sowie Veränderungen seit 1945 analysiert. Nach einem kurzen Abschnitt über die derzeit und auch in diesem Buch etablierten Forschungs- und Lehrperspektiven wird die Frage des Einflusses auf die österreichische Außenpolitik untersucht sowie in einem Exkurs der Frage nach den Beratungsaufgaben und -möglichkeiten von außenpolitischen Think-Tanks nachgegangen.
3 Die historische Entwicklung. Vom Kampf wissenschaftlicher Disziplinen um Erklärungshoheit zur komplexen Außenpolitikanalyse
Dieser Beitrag orientiert sich an den vier Perspektiven, die von den Herausgebern dieses Handbuches für die Analyse der bestehenden Literatur zur Außenpolitik Österreichs seit 1945 vorgeschlagen werden: die außenpolitische Praxis, rechtswissenschaftliche Perspektiven, zeitgeschichtliche Arbeiten, Perspektiven der Politikwissenschaft.
Bereits die Tatsache, dass bisher kein Handbuch der österreichischen Außenpolitik existiert, ist ein anekdotischer Beleg für Besonderheiten in der historischen Entwicklung von Forschung und Lehre über Außenpolitik.
An den Universitäten wurden bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Fragen der Außenpolitik fast ausschließlich von Jurist*innen und Historiker*innen behandelt. Erst die Erkenntnis, dass nationalökonomische und sozialwissenschaftliche Fragestellungen in internationalen Beziehungen Berücksichtigung finden müssen, führte im Rahmen der juristischen Fakultäten zur Gründung eines Institutes für Staatswissenschaft an der Universität Wien (ab 1919 in Wien ein eigenes staatswissenschaftliches Studium, das soziologische und ökonomische Themen berücksichtigte) und der Einrichtung eines staatswissenschaftlichen Doktoratsstudiums an der Universität Graz (ab 1919). Die Dominanz der Rechtswissenschaften prägte bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts die universitäre Beschäftigung mit Außenpolitik. Dies beruhte wohl auch auf der starken josephinischen Tradition, dass Universitäten ausschließlich staatliche Bildungseinrichtungen sein sollten und dass eine ihrer wichtigsten Aufgaben die Ausbildung von „Staatsdienern“ ist. Die doppelte Dominanz der Jurist*innen bestand darin, dass sozialwissenschaftliche Fächer in juristische Fakultäten aufgenommen wurden und für eine akademische Berufslaufbahn in der öffentlichen Verwaltung (A-Laufbahn) ein „Juristenmonopol“ bestand (Hummer 2015, 275).
Erst die gesellschaftspolitischen Modernisierungsimpulse der späten 1960er-Jahre brachten mit einer institutionellen Etablierung der Politikwissenschaften und des Faches „Zeitgeschichte“ neue Perspektiven in die universitäre Außenpolitikforschung und stellten die Dominanz der Rechtswissenschaften infrage. Allerdings bestehen bis heute nur an den Universitäten Wien (1971 und 1974), Salzburg (1969) und Innsbruck (1976) eigenständige politikwissenschaftliche Institute. Eine öffentliche Diskussion über diese zunächst von den politischen Parteien und den universitären Hierarchien als „Weltanschaungsfach“ gesehene akademische Disziplin fand bei den Gründungen nicht statt. Ohne eine öffentliche Diskussion wurde aber nicht klar, dass diese institutionellen Änderungen wichtige Beiträge zur gesellschaftspolitischen Modernisierung in Österreich und zur Demokratisierung von Außenpolitik leisten konnten. Anton Pelinka (2004, 100) schreibt dazu: „Bis in die frühen 1970er-Jahre hinein war Politikwissenschaft für die österreichische Öffentlichkeit jedenfalls ‚terra incognita‘“. Kennzeichnend ist auch der Umstand, dass sich die Politikwissenschaft als akademische Disziplin zuerst im Rahmen des 1963 in Wien eingerichteten außeruniversitären „Institut für Höhere Studien und wissenschaftliche Forschung“ (IHS) und gegen den Widerstand der Universität Wien etablierte (Hummer 2015, 110–120), bevor sie in den Fächerkanon österreichischer Universitäten aufgenommen wurdeFootnote 1.
Die universitätspolitisch ausgetragene Auseinandersetzung zwischen „konservativen“ Rechtswissenschaften und „progressiven“ Politikwissenschaften führten zu einer faktischen Aufteilung der in Forschung und Lehre behandelten Themenfelder der Außenpolitik. Die zunächst sehr österreichzentrierte Schwerpunktsetzung im neuen Fach Zeitgeschichte leistete wenig Beiträge zur Stärkung der Außenpolitikforschung und suchte in den ersten Jahrzehnten vor allem ihren akademischen Platz im Bereich der österreichischen Geschichtsforschung. Dies änderte sich erst in den letzten Jahrzehnten mit einer an außenpolitischen Fragen interessierten Generation von österreichischen Zeitgeschichtsforschern (z. B. Oliver Rathkolb, Günther Bischof, Michael Gehler). Es ist interessant zu beobachten, dass heute Zeitgeschichtsforschung als ein Beitrag zur „Versachlichung“ akademischer Diskurse über die „gegenwärtige Lebenswelt“ formuliert werden kann, wie dies in der folgenden Kurzbeschreibung eines Schwerpunktes des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien geschieht. Die folgende Selbstdarstellung könnte als indirekte Kritik an einzelnen politikwissenschaftlichen Arbeiten zum Thema verstanden werden, die ohne klare Trennung zwischen Analyse und Meinung politisch motiviert und emotionalisiert erscheinen:
Schließlich gilt es, eine selbstreflexive Perspektive auf die Geschichtswissenschaft als einer Akteurin auf dem Feld von Wissensproduktion und Wissensvermittlung zu richten. Gerade die Geschichte des 20. Jahrhunderts erscheint noch immer als Schlachtfeld geschichtspolitscher und erinnerungskultureller Auseinandersetzungen. Die Aufgabe einer innovativen Zeitgeschichte besteht darin, durch reflektierte Forschung zu Versachlichung dieser Debatten beizutragen, aber zugleich sich als Teil dieser diskursiven Ordnungen zu verstehen und sich selbstkritisch darin zu verorten. Dazu gehört auch, die Grenzen der Zeitgeschichte permanent zu verschieben und auch historische Prozesse, die noch nicht abgeschlossen sind bzw. spürbar in unsere gegenwärtige Lebenswelt hineinragen, einer Historisierung zuzuführen. Die Beschäftigung mit gegenwärtigen Phänomen wie Populismus, Identitätspolitiken oder neuen Subjektivierungspraktiken im Zeitalter des Neoliberalismus soll dazu beitragen, aktuelle gesellschaftliche Konflikte in ihrer historischen Gewordenheit zu verstehen und zeithistorisch zu kontextualisieren (Institut für Zeitgeschichte 2020).
Für eine komplexe Außenpolitikanalyse sind derzeit alle aktuellen akademischen Lehrangebote methodisch und thematisch Disziplinen übergreifend ausgerichtet. Aufgrund starker Diskontinuitäten bei den Umfeldbedingungen (von der alliierten Besetzung über den Kalten Krieg und das Ende des Eisernen Vorhanges bis zur EU-Integration) und innerstaatlichen Interessensgruppen (im Zuge der „Demokratisierung“ von Außenpolitik starke Zunahme von Anzahl und Bedeutung von NGOs und Medien) bei gleichzeitig hoher Kontinuität in den bürokratischen Organisationen und bei den Strukturen außenpolitischer Entscheidungsfindung ist die Disziplinen übergreifende Organisation der Lehrangebote positiv zu bewerten. Aus dem Kampf um akademische Deutungshoheit in der akademischen Außenpolitikanalyse zwischen den Rechts- und Politikwissenschaften wurde im Laufe der Geschichte der Zweiten Republik ein immer größer werdendes gemeinsames Forschungsfeld, das zumeist zeithistorisch kontextualisiert wird.
4 Wo findet in Österreich Forschung und Lehre zu Außenpolitik statt?
4.1 Lehre
Lehre über österreichische Außenpolitik wird überwiegend von staatlichen universitären Institutionen in den Disziplinen Politikwissenschaft, Staatswissenschaft, Völkerrecht, Europarecht und Europapolitik, und Zeitgeschichte angeboten. Eigene akademische Kursprogramme über Außenpolitik gibt es nur im Fach Politikwissenschaft. Das Lehrangebot ist zumeist in Kursen über internationale Beziehungen, österreichische Politik, Völkerrecht oder österreichische Zeitgeschichte integriertFootnote 2. An der diesbezüglichen universitären Lehre sind auch Mitarbeiter*innen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie dem Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip), den Boltzmann Instituten für Grund- und Menschenrechte und für Kriegsfolgenforschung und anderer Think-Tanks beteiligt.
Das größte Angebot an Lehrveranstaltungen zur österreichischen Außenpolitik seit 1945 bzw. das einzige, das Lehrveranstaltungen ausschließlich zu dem Thema bietet, ist das Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. In den letzten Semestern wurden vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien beispielsweise folgende Lehrveranstaltungen angebotenFootnote 3:
Bachelor Politikwissenschaft:
-
SE Internationale Politik und Entwicklung: Internationalisierung des Staates (Armin Lorenz Puller, Hanna Lichtenberger) (WS2021)
-
SE Internationale Politik und Entwicklung: Außen- und Sicherheitspolitik Österreichs in der 2. Republik im Vergleich (Otmar Höll) (SS2021)
-
SE Österreichische Politik: Austrian Foreign Policy between tradition and innovation (Heidrun Maurer) (SS2021)
-
LK Internationale Politik (Thomas Roithner) (SS2020)
-
LK Internationale Politik (Andreas Stadler) (SS2020)
-
SE Europäische Union und Europäisierung: Die Außenpolitik der EU und (De)Europäisierung (Patrick Müller) (WS2019)
-
SpezVO Österreichische Politik: Österreichische Außenpolitik: Grundlagen, Trends und aktuelle Entwicklungen (Vedran Dzihic) (WS2019)
-
LK Internationale Politik (Bettina Köhler, Jun Saito) (SS2019)
-
LK Internationale Politik (Isabella Radhuber, Johannes Maerk) (SS2019)
-
LK Theorie und Empirie Internationaler Politik (Otmar Höll, Jun Saito) (SS2018)
-
SE Europäische Union und Europäisierung: Austrian Political Discourse on Key EU Topics (Lola Raich) (SS2018)
Master Politikwissenschaft:
-
SE Österreichische Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik (Thomas Roithner) (WS2018)
-
SE Österreichische Politik – Austria and global challenges (Heidrun Maurer) (SS2021)
Darüber hinaus gibt es in Österreich zwar eine Reihe von Studienangeboten zu Politik oder politischer Bildung, die aber keine außenpolitischen Lehrveranstaltungen beinhalten. Vereinzelt finden sich Lehrveranstaltungen, die auch Aspekte der österreichischen Außenpolitik betrachten.
So bietet das Master-Programm „International Relations and Urban Policy“ (berufsbegleitend, 4 Semester) der FH Campus Wien ein Seminar mit dem Titel „Austrian Politics in a Central European Context“, das neben anderen Themen auch Grundelemente der österreichischen Außenpolitik umfasst.
Einige Studienangebote beinhalten Module zu Internationalen Beziehungen (so die KMU Akademie für Fernstudien in den Master-Lehrgängen „Political Management“ und „Public Administration“(KMU Akademie n.d.). Wie diverse Curricula (beispielsweise des Studiums „Global Studies“ oder rechtswissenschaftliche Module an der Universität Graz, die Einführung in die Internationalen Beziehungen an der Universität Salzburg oder des Master-Programms „International Relations“ an der Donau Universität Krems) zeigen, ist nicht durchgängig davon auszugehen, dass (Einführungs-)Module zu „Internationalen Beziehungen“ auch österreichische Außenpolitik zum Thema haben.
An der Universität Graz bietet der österreichische Diplomat Helmut Tichy ein Seminar zu „Österreich und das Völkerrecht“ an, das im Diplom- sowie Doktoratsstudium der Rechtswissenschaft verpflichtend ist und in den Masterstudien Global Studies als Wahlpflichtfach belegt werden kann. Weiters ist davon auszugehen, dass die Vorlesung Hedwig Ungers „Das politische System Österreichs im europäischen Kontext“ in den Bereich Außenpolitik einzuordnen ist.
An der Universität Salzburg behandelt der Politikwissenschaftler Reinhard C. Heinisch in seiner Einführung in die Österreichische Politik auch Österreichs internationale Rolle.
Lehrveranstaltungen zu „Foreign Policy Analysis“, die aber großteils theoriegeleitet sind und sich nicht spezifisch österreichischer Außenpolitik widmen, bieten beispielsweise die Universität Innsbruck, die Webster Vienna Private University, die Central European University Private University und die IMC FH Krems.
Für Studierende des Fachs Geschichte bietet die Universität Innsbruck ein Wahlseminar zur Zweiten Republik an (Klaus Eisterer), das auch außenpolitische Aspekte betrachtet. An der Universität Salzburg lehrt die Zeithistorikerin Helga Embacher „Österreich von 1945 bis zur Gegenwart“ bzw. „Österreich vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart im Kontext globaler Entwicklungen“. Außerdem bietet dort Alexander Jost eine Lehrveranstaltung zum Verhältnis Chinas und Österreichs im 20. Jahrhundert. An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wird die Vorlesung „Österreichische Geschichte II: Von den Koalitionskriegen und der Reaktion bis zur europäischen Integration“ (Werner Drobesch) angeboten, bei der es u. a. um die außenpolitische Positionierung Österreich geht. Die Universität Wien bietet für Geschichtsstudent*innen regelmäßig eine Vorlesung zu den Grundfragen der Politikgeschichte, die auch eine Einheit zur Außenpolitik beinhaltet. Am dortigen Institut für Zeitgeschichte hält Oliver Rathkolb regelmäßig Vorlesungen zur Österreichischen Geschichte (1815 bis zur Gegenwart), die auch außenpolitische Themen umfassen. Dort beschäftigt sich auch Lucile Dreidemy in Übungen und Seminaren regelmäßig mit Themen der österreichischen Entwicklungspolitik sowie österreichischer Außenpolitik gegenüber dem Globalen Süden.
Außenpolitische Aspekte behandeln wohl auch die Lehrveranstaltungen „Verfassungsgeschichte der Zweiten Republik“ (Diplomstudium Rechtswissenschaft, Universität Wien), „Recht der Entwicklungszusammenarbeit“ (Diplomstudium Rechtswissenschaft, Universität Wien) sowie „Die transatlantischen Beziehungen“ (International Relations Master, Donau Universität Krems).
Einiges wird an österreichischen Universitäten zur EU-Außenpolitik angeboten. Interessant ist außerdem, dass es beispielsweise an den Universitäten Salzburg (Politikwissenschaft) und Innsbruck (Politikwissenschaft), der Webster University in Wien und der Central European University in Wien Lehrveranstaltungen zur amerikanischen und teilweise auch zur russischen Außenpolitik gibt, aber nicht zu österreichischer Außenpolitik.
Im Sektor der Fachhochschulen gibt es Angebote, die in Hochschullehrgängen internationale Beziehungen und die Ausbildung für Karrieren im internationalen Bereich zum Thema haben. Mangels näherer Informationen zu den Inhalten der Module bzw. Lehrveranstaltungen über internationale Politik oder auch Völkerrecht, ist es bei einigen Universitäten, Fachhochschulen, Akademien und deren Lehrgängen nicht eindeutig, ob Themen der österreichischen Außenpolitik gelehrt werden.
Der Großteil der österreichischen Think-Tanks hat selbst keinen Lehrbetrieb im Bereich Außenpolitik. Allerdings weisen einige derer Webseiten ausdrücklich darauf hin, dass ihre Wissenschaftler*innen an österreichischen Universitäten, Fachhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen unterrichten (oiipFootnote 4, Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte, sowie das Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement/IFK und das Institut für Strategie und Sicherheitspolitik/ISS der Landesverteidigungsakademie). Das Center für Strategische Analysen (CSA) bietet Trainings im Bereich Führung, „geopolitische, regionale und nationale Fragestellungen und sicherheitsrelevante Aspekte“ für Organisationen und Unternehmen an.
Aus der „Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen“ (ÖGAVN) hervorgegangen ist das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA), das unter anderem einen einjährigen Diplomlehrgang (Global Advancement Programme/GAP) zu „Politik und Diplomatie“ anbietet. Als Redner*innen eingeladen werden Personen aus der Praxis, allerdings ist dem Programm nicht zu entnehmen, wieviel davon österreichische Außenpolitik betrifft.
Eigene außeruniversitäre Lehrangebote stellen die Ausnahme dar und sind meist Teil von Fachausbildungen und Fortbildungslehrgängen, die dem Bereich der öffentlichen Verwaltung zugeordnet werden können. Dies gilt insbesondere für außen-, sicherheits- und europapolitische Lehrangebote der Theresianischen Militärakademie (2021), der Landesverteidigungsakademie (Bundesministerium für Landesverteidigung n.d.) und der Verwaltungsakademie des BundesFootnote 5.
Mit dem Schwerpunkt auf Friedenserziehung werden Fragen der österreichischen Außenpolitik in den Lehrangeboten des als überparteilicher Verein organisierten und seit 1982 bestehenden Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ASPR) behandelt. Den Schwerpunkt des Bildungsbereichs bilden die Friedenspädagogik und vielfältige Trainingsprogramme für zivile Fachkräfte, die in Krisenregionen zum Einsatz kommen (ASPR n.d.).
Eine organisatorische Sonderform stellt die „Diplomatische Akademie Wien/Vienna School of International Studies“ dar, die nach dem Zweiten Weltkrieg erst 1964 wiedereröffnet wurde, seit 1996 mit einem eigenen Gesetz als Anstalt öffentlichen Rechts eingerichtet ist und zu deren Auftrag es zählt, Lehre und Forschung über internationale Fragen gemeinsam mit anerkannten in- oder ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen durchzuführen. Sie bietet neben einem eigenständig durchgeführten einjährigen Diplomlehrgang in zwei Masterprogrammen mit der Universität Wien und der Technischen Universität Wien auch Lehrangebote zu Fragen der Außenpolitik Österreichs anFootnote 6. Ein eigener Kurs zur Außenpolitik Österreichs wird nicht angeboten. In den „Executive Programmes“ für junge internationale Führungskräfte werden allerdings oft Lehrangebote über Diplomatie und Außenpolitik in Österreich eingebaut. Als Plattform für internationalen Dialog und auch zur Diskussion über Fragen der österreichischen Außenpolitik organisiert und betreut die Diplomatische Akademie Wien an ihrem Standort jährlich mehr als zweihundert öffentliche Veranstaltungen.
Zum weiten Bereich der „politischen Bildung“ an österreichischen Schulen (Lehrpläne, Schulbücher, Lehreraus- und -fortbildung) verwies Herbert Dachs bereits 1983 in einer mit empirisch erhobenen Daten unterlegten Studie über die Rolle der Außenpolitik auf deren besonders geringen Stellenwert. Der von Dachs insgesamt als „blamabel“ beschriebene Zustand, dass politische Bildung in Österreich nur ein „Unterrichtsprinzip“ sei, hat sich in den folgenden Jahrzehnten deutlich verändert. Aktuell ist es in mehreren Schulstufen auch ein eigenständiger Gegenstand und es wurde ein „Österreichisches Kompetenzmodell für Politische Bildung“ entwickeltFootnote 7. Für die Außenpolitik gilt allerdings weiterhin die seinerzeitige Forderung von Dachs (1983, 233): „Das Ausmaß der systematischen und intensiven Beschäftigung mit außenpolitischen Fragen und Inhalten muß also insgesamt angehoben werden“.
Auch Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die in Österreich in ihren Veranstaltungen und Kursen „politische Bildung“ anbieten – und dies reicht von sozialpartnerschaftlichen Bildungseinrichtungen über Parteiakademien bis zu Volkshochschulen, Europahäusern und der „Demokratiewerkstatt“ des Parlaments – behandeln fallweise Themen der österreichischen Außen-, Sicherheits- und Europapolitik. Vortragende sind dabei überwiegend Absolvent*innen politikwissenschaftlicher Studien, die meist auch an Universitäten oder Fachhochschulen lehren und schwerpunktmäßig Themen wie Friedenspolitik, Entwicklungspolitik, Abrüstung und Europapolitik behandelnFootnote 8. Die große Zahl an Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung verstärkt noch den Eindruck, dass trotz der Aufwertung des Bereiches politische Bildung in den Sekundarstufen der österreichischen Schulen, außenpolitische Fragestellungen dabei zu wenig berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist positiv anzumerken, dass Information und Vermittlung von außenpolitischen Inhalten inzwischen eine wesentliche Aufgabe der Erwachsenenbildung darstellen.
4.2 Forschung
In Österreich gibt es weder universitär noch außeruniversitär eine Forschungseinrichtung, die sich ausschließlich mit der Außenpolitik Österreichs beschäftigt. An den im Abschnitt über Lehre (Abschn. 4.1) genannten Einrichtungen wird mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zu den verschiedenen Aspekten der Außenpolitik geforscht. Diese Forschungstätigkeit orientiert sich überwiegend an traditionellen und aktuellen Schwerpunkten der außenpolitischen Prozesse in Österreich (z. B. Geschichte der Außenpolitik, Neutralitätspolitik, Entwicklungspolitik, österreichische Europapolitik, Mitteleuropapolitik, Sicherheitspolitik, Migrationspolitik, Balkan, Kulturaußenpolitik) und an den strukturellen Voraussetzungen (Akteure, Institutionen).
Außeruniversitär besteht eine große Zahl außenpolitischer Think-Tanks, die Politik-Analysen erstellen und auch in den österreichischen Medien (zunehmend auch online auf eigenen Plattformen) mit Beiträgen präsent sind. Ein Ende 2017 von der Diplomatischen Akademie Wien initiiertes und betreutes Netzwerk zur Diskussion außerpolitischer Fragen „Forum außenpolitischer Think-Tanks“ (FaTT) umfasst mehr als 30 Think-Tanks (FaTT 2021).
Trotz zahlreicher Versuche in der Zweiten Republik eine österreichische Fachzeitschrift zur Außenpolitik längerfristig zu veröffentlichen, lassen sich mit Stand Ende 2021 nur folgende Zeitschriften anführen, die sich zumindest teilweise dieser Kategorie zuordnen lassen: „Österreichische Militärische Zeitschrift“ (ÖMZ), „International. Die Zeitschrift für internationale Politik“, „DIPLOMACY. Austrian Journal of International Studies“, „Der Donauraum“. Die mehr als vier Jahrzehnte lang bestehende und wohl wichtigste Zeitschrift mit regelmäßigen Beiträgen zur österreichischen Außenpolitik war die von Paul Lendvai gegründete und bis zu ihrer Einstellung 2020 geleitete „Europäische Rundschau“Footnote 9. Analysen zur Außenpolitik finden sich auch in einigen anderen wissenschaftlichen Zeitschriften und Jahrbüchern, vor allem in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (OZP), Österreichisches Jahrbuch für Politik, Contemporary Austrian Studies (CAS)Footnote 10.
Im außeruniversitären Bereich können auch Forschungsarbeiten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), in den wissenschaftlichen Österreichzentren, Österreich-Lehrstühlen und Österreich-Bibliotheken im Ausland sowie den bilateralen Historikerkommissionen und Boltzmann-Instituten erwähnt werden. Dies verdeutlicht die Entwicklung, dass Forschungseinrichtungen im In- und im Ausland, die sich mit der Analyse Österreichs aus politik-, rechts- oder geschichtswissenschaftlicher Perspektive beschäftigen, vermehrt außenpolitische Themen in ihr Forschungsfeld aufnehmen.
5 Wie und warum hat sich das Angebot in Forschung und Lehre seit 1945 verändert?
Die entscheidenden Faktoren für eine deutliche qualitative und quantitative Ausweitung des Forschungs- und Lehrangebotes nach 1945 liegen zunächst in den erfolgreichen Initiativen emigrierter österreichischer Sozialwissenschaftler*innen und Ökonom*innen moderne Methoden und Strukturen US-amerikanischer Universitäten in Österreich zu unterstützen (1962 Gründung des Instituts für Höhere Studien (IHS)). Dies führte auch nach und nach zu wesentlichen strukturellen Neuerungen in der Wissenschaftsorganisation an den Universitäten: ab Ende der 1960er-Jahre die Etablierung der Politikwissenschaft und der Zeitgeschichte in Österreich, ab den 1980er-Jahren die Etablierung von Europarecht/EuropapolitikFootnote 11. Einen frühen Beitrag zu einem international orientierten Wissenschaftsdialog leisteten bereits die unmittelbar nach Kriegsende 1945 von Otto Molden initiierten jährlichen „Internationalen Hochschulwochen“ in Alpbach (heute „Europäisches Forum Alpbach“) sowie die nach ihrer Neugründung 1964 von dem austro-amerikanischen Historiker und Politikwissenschaftler Ernst Florian Winter (Diplomatische Akademie Wien 2014) geleitete Diplomatische Akademie in Wien. Seit 1967 finden (organisiert von der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN)) jährlich „Außenpolitische Gespräche“ auf Schloss Hernstein in Niederösterreich statt, die laut Definition der Veranstalter „jedes Jahr einem speziellen Thema von Bedeutung für die österreichische Außenpolitik gewidmet“ sind.
Seit Mitte der 1980er-Jahre wurden von Regierungsseite deutliche Bemühungen unternommen, um an den Universitäten Lehrangebote für Europarecht und Europapolitik zu etablieren, die nach dem österreichischen Antrag zum Beitritt zur späteren Europäischen Union zunehmend einerseits „Integrationsforschung“ betreiben und andererseits in der Lehre fundierte Information als Vorbereitung auf den Beitritt vermitteln solltenFootnote 12.
Die Ausdifferenzierung neuer akademischer Fachdisziplinen (Politikwissenschaft, Zeitgeschichte, Europastudien) schuf zusätzliche akademische Karrieremöglichkeiten und erhöhte damit generell den Forschungsoutput. Gleichzeitig erhöhten sich politisch kontinuierlich die Interdependenz zwischen innen- und außenpolitischen Prozessen und damit das Interesse an außenpolitischen Themen. Es ist aus heutiger Sicht selbstverständlich, dass sich entsprechend den teilweise fundamentalen Veränderungen im internationalen Umfeld – und „nationaler Interessen“ (Sonnleitner 2018)Footnote 13 – die Themenfelder für Forschung und Lehre ausdifferenzierten (siehe in diesem Band neben den klassischen österreichischen außenpolitischen Themenfeldern Neutralität, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Europäische Integration, Friedenspolitik, Entwicklungspolitik, Menschenrechtspolitik, Institutionenanalysen und geografischen Schwerpunkten auch Beiträge über Umwelt- und Klimapolitik, Gesundheitspolitik, Gleichstellungspolitik). Ein wesentlicher Grund für diese auffallende Ausdifferenzierung liegt auch in der Entwicklung der österreichischen Politikwissenschaft, die sich inzwischen durch Internationalisierung und Professionalisierung als akademische „Leitdisziplin“ für Fragen der Außenpolitik etabliert hat (Senn und Eder 2018).
6 Welches sind die vorherrschenden Forschungs- und Lehrperspektiven?
Die auffallende Vielfalt an Forschungs- und Lehrperspektiven zur österreichischen Außenpolitik kann trotz der deutlichen Ausweitung der politikwissenschaftlichen Perspektiven folgendermaßen als Ergebnis unterschiedlicher disziplinärer Zugänge (Forschungsinteressen und Forschungsmethoden) kategorisiert werden:
-
Die Befassung mit außenpolitischer Praxis (Memoiren, Dokumentationen des Außenministeriums, auch Zeitschriften wie „Europäische Rundschau“, „International“ sowie außenpolitische Analysen von PraktikernFootnote 14);
-
Rechtswissenschaftliche Perspektiven (mit den Schwerpunkten Völkerrecht, Neutralität, Menschenrechte, Europarecht, Staatswissenschaft);
-
Zeitgeschichtliche Arbeiten zu den historischen Entwicklungen der Außenpolitik sowie ihrer Einbettung in innenpolitische und internationale Prozesse (Akteure, Strukturen, historischer Wandel/Wendepunkte);
-
Perspektiven der Politikwissenschaft (Analyse der entscheidenden Bestimmungsfaktoren für außenpolitische Prozesse und Entscheidungen, große thematische Breite: Neutralität, Kleinstaatlichkeit, Dependenzforschung, Friedensforschung, Föderalismus, EU-Mitgliedschaft, Europapolitik, bilaterale Beziehungen und Nachbarschaftspolitik).
Diese Ausdifferenzierung seit der universitären Etablierung der Politikwissenschaft hat Disziplinen übergreifende Ansätze gefördertFootnote 15. Dies gilt beispielsweise für Publikationsreihen wie „Contemporary Austrian Studies“ und „Der Donauraum“. Dennoch wurden bisher kaum Überblickswerke veröffentlicht. Unter den wenigen Beispielen sind zu nennen: „Außenpolitik und Demokratie in Österreich“ (Kicker et al. 1983), „Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik“ (Gehler 2005), der von Helmut Kramer herausgegebene Abschnitt „Außenpolitik“ in „Politik in Österreich. Das Handbuch“ (Dachs et al. 2006) und „Politikwissenschaft in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Europapolitik“ (Hummer 2015).
7 Welchen Einfluss hat Forschung und Lehre auf die österreichische Außenpolitik?
Im Beitrag von Raoul F. Kneucker über „Verwaltungsebenen der österreichischen Außenpolitik“ in diesem Handbuch wird ausgeführt, dass der traditionelle institutionelle staatliche Apparat der Außenpolitik zu jenen Verwaltungsbereichen zählt, der seit 1945 am stärksten von internen und externen Veränderungen betroffen ist. Dennoch werden in diesem Bereich inhaltliche Positionen weiterhin oft ohne Beiziehung externer Beratung erarbeitet. Selbst im Bereich des juristisch erforderlichen völkerrechtlichen Handelns wird die inhaltliche Vorbereitung überwiegend „hausintern“ von den Mitarbeiter*innen des „Völkerrechtsbüros“ im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) erarbeitet. Allerdings sind diese Diplomat*innen vielfach auch in Forschung und Lehre an Universitäten tätig.
Mit Ausnahme völkerrechtlicher Beratung besteht kein direkter Einfluss von Forschung und Lehre auf außenpolitische Entscheidungsprozesse. Durch Themenwahl, öffentliche Kritik an außenpolitischen Handlungen der Regierungen und Zusammenarbeit mit NGOs besteht aber ein zunehmender indirekter Einfluss auf die Außenpolitik, der insgesamt der stärkeren Anerkennung demokratischer Legitimierung (auch Transparenz) staatlichen Handelns entspricht. In einem ersten Resümee über die politikwissenschaftliche Außenpolitikforschung in Österreich stellte Kramer 1989 (32–33) ernüchternd fest: „Ich habe…munter wissenschaftliche Außenpolitik-Analysen an mir politisch nahestehende Außenminister und Bundeskanzler abgeschickt, das Ergebnis war nicht besonders aufbauend: Von 3 Sendungen wurden 2 überhaupt nicht beantwortet, die Antwort auf die dritte Sendung war eine in vornehmes Büttenpapierkuvert verpackte vorgedruckte Karte mit der Aufschrift ‚Der Bundesminister dankt für die Gratulation‘“.
Ein indirekter, aber empirisch schwer zu erhebender Einfluss auf die österreichische Außenpolitik besteht durch die Tatsache, dass die Zahl österreichischer Diplomat*innen mit politikwissenschaftlicher Ausbildung (seit 1993 Zulassung zum L’Examén Prealable ohne zusätzliche akademische Ausbildung) in den letzten Jahrzehnten tendenziell zugenommen hat (zuletzt auch eine Änderung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme in den höheren auswärtigen Dienst in Form einer gleichberechtigten Zulassung von Absolvent*innen aller Studienrichtungen (BMeiA n.d.)).
Exkurs: Beratungsaufgaben von Think-Tanks
Der Bedarf außenpolitisch Handelnder im staatlichen und staatsnahen Bereich (Regierung, Parlament, Bundesländer, Städte, Interessensvertretungen, etc.) an wissenschaftlich fundierter Beratung wird in der Regel weiterhin direkt oder indirekt durch die jeweiligen Verwaltungen abgedeckt. Am deutlichsten ist dies in internationalen Rechtsfragen sichtbar, wo die Beurteilung und Beratung überwiegend seitens der Rechtsabteilungen der Außenministerien erfolgt (in Österreich durch das Völkerrechtsbüro des BMeiA). In anderen inhaltlichen Fragen versuchen die Verwaltungen durch organisatorische Maßnahmen innerhalb der Organisation Beratungskapazitäten neu zu schaffen bzw. besser zu koordinieren (Planungsstäbe, Sonderbeauftragte, „roving ambassadors“, Projektteams, „task forces“, interministerielle Kommissionen, Krisenstäbe) und sie ziehen meist nur punktuell externe Beratung durch politiknahe Forschungsinstitute („Think-Tanks“) und Universitäten oder Einzelpersonen (Journalist*innen, Intellektuelle, ehemalige Militärs und Diplomat*innen) heran. In Österreich gibt es im europäischen Vergleich wenige „externe“ Denkfabriken zur Schaffung von wissenschaftlichen Grundlagen für außenpolitische Planungen und Entscheidungen (z. B. Österreichisches Institut für Internationale Politik, Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, Diplomatische Akademie Wien, Institut für den Donauraum und MitteleuropaFootnote 16) und diese werden im internationalen Vergleich gering gefördert. Insgesamt ist die Außenpolitik unter allen Politikbereichen das letzte noch hochgehaltene Paradebeispiel für den Glauben an das „bürokratische Verwaltungsmodell“. Bei ihr ist noch am deutlichsten sichtbar, was Max Weber für alle Bürokratien idealtypisch beschrieben hat, dass sie „unabhängig von oder vielmehr trotz der einzelnen unterschiedlichen Organisationsziele oder politischen Absichten und Ideologien“ effizient handeln können (Kneucker 1983, 54).
Größere Staaten verfügen meist über ein höheres Maß an Institutionalisierung in ihrer außen- und sicherheitspolitischen Beratungsstruktur. Nationale außenpolitische und sicherheitspolitische Beratungsgremien mit eigenen Analyseabteilungen sind je nach der politischen Organisation der jeweiligen Staaten bei Präsident, Regierung oder Parlament eingerichtet. Diese Gremien befinden sich meist an der Schnittstelle zwischen Politikberatung und politischer Gestaltung.
Allerdings ist insgesamt die gängige Definition der politischen Beratung als Instrument der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an politische Entscheidungsträger*innen in außenpolitischen Fragen nur bedingt anwendbar. Für eine systematische und effektive Außenpolitikberatung seitens der Wissenschaften scheint es zu viele Unbekannte in der Gleichung für eine erfolgreiche Außenpolitik zu geben. Die gängige Definition für Politikberatung deutet das Problem bereits an: „Politikberatung ist das institutionalisierte oder punktuelle Liefern wissenschaftlich erhobener und aufbereiteter Information an politisch Handelnde“ (Thunert 2007, 336). Dabei bleiben viele Fragen offen, die aber in der politischen Beratung in außenpolitischen Fragen zentral sind:
Welchen Stellenwert besitzen ethisch-moralische Aspekte, wenn die gleichen Argumente sowohl die Rechtfertigung für militärische Interventionen wie für Entwicklungszusammenarbeit abgeben können? Wieweit und in welcher Form sollen jeweils innenpolitische Aspekte bei außenpolitischen (auch europapolitischen) Entscheidungsfindungen berücksichtigt werden, wenn Außenpolitik zwar international operiert, aber die Vertretung nationaler Interessen ihr Sinn und Zweck ist (Kirt 2006)Footnote 17? Wie kann der offensichtlich von einer Vielzahl an „Machtfaktoren“ bestimmte außenpolitische Spielraum eines Staates im Gefüge von kleinen, mittleren und großen Staaten, armen und reichen Ländern, Beinahe- und Noch-Supermächten, tatsächlich abgeschätzt werden? Welche Rolle spielen emotionale Faktoren und die Persönlichkeit der politisch Handelnden? Wie kann Außenpolitik auf die Vervielfachung der Akteure, die nicht unmittelbar dem Staat zugeordnet werden können (Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Medien) reagieren, wie lässt sich „Netzwerkdiplomatie“ charakterisieren und nutzen? Wie sollen Aspekte des Marketings (Anholt 2010) („nation branding“, Aufmerksamkeitskapital, Reputation) berücksichtigt werden? Für die spezifische Situation der außenpolitischen Beratung in Österreich liegt bisher nur eine nichtrepräsentative Studie vor, die auch Empfehlungen abgibt, wie ein stärkerer Einfluss auf den politischen Prozess erzielt werden könnte (Seidenader 2021).
8 Konklusion
Für die Vielfalt an neuen außenpolitischen Bestimmungsfaktoren und Herausforderungen und trotz der großen Zahl an Forschern, die zu politikwissenschaftlichen, zeithistorischen und juristischen Themen arbeiten, ist der derzeitige Stand der Forschung und Lehre zu Außenpolitik in Österreich nicht befriedigend. Der wesentliche Grund dafür ist, dass das Thema der Außenpolitikforschung weder in Theorie noch Praxis und weder von den Universitäten noch von den außenpolitisch Handelnden als prioritär gesehen wird. Dies spiegelt sich auch bis heute in der geringen Bedeutung von außenpolitischen Fragen im demokratiepolitisch erfreulicherweise wachsenden Sektor der politischen Bildung.
Weiterführende Quellen
Außen- und europapolitische Berichte des BMeiA (erscheinen jährlich seit 1975). Elektronisch abrufbar auf der Website des Ministeriums: https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/aussen-und-europapolitischer-bericht/.
Die Berichte geben eine gute Übersicht über das offizielle außenpolitische Handeln Österreichs und enthalten teilweise auch statistisches Material. Im Vergleich der jährlich erscheinenden Berichte lassen sich Veränderungen in den Schwerpunkten der Außenpolitik sehr klar nachvollziehen.
Kicker, Renate, Andreas Khol, und Hanspeter Neuhold, Hrsg. 1983. Außenpolitik und Demokratie in Österreich: Strukturen-Strategien-Stellungnahmen. Ein Handbuch. Salzburg: Neugebauer Verlag.
Dieser Sammelband ist als erster Versuch eines Handbuchs der Außenpolitik Österreichs zu bewerten. Von Interesse ist besonders die Schwerpunktsetzung auf eine Stärkung der Transparenz und einer Demokratisierung außenpolitischen Handelns.
Hummer, Waldemar. 2015. Politikwissenschaft in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Europapolitik: Institutionelle und materielle Rahmenbedingungen. Innsbruck: StudienVerlag.
Das Buch ist mit seiner Auflistung und Einordnung aller Studienangebote an postsekundären Bildungseinrichtungen eine ergiebige Sekundärquelle und gibt einen wertvollen Überblick über die institutionelle Entwicklung europapolitischer Angebote.
Sandra Sonnleitner, Bilateral Diplomacy and EU Membership. Case Study on Austria (Nomos, Baden-Baden 2018).
Das Buch konzentriert sich auf die Frage, wie die bilaterale Diplomatie durch die EU-Mitgliedschaft beeinflusst und verändert wurde. Es enthält grundlegende empirische Nachweise über die Art des Einflusses und die Auswirkungen dieses Prozesses.
Jaeger, Thomas, Hrsg. 2020. 25 Jahre EU-Volksabstimmung. Wien: Jan Sramek Verlag.
Dieser Sammelband untersucht Großteils transdiziplinär wesentliche Fragestellungen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Österreichs in der EU und beleuchtet aktuelle forschungsleitende Fragestellungen österreichischer Europapolitik.
Notes
- 1.
Als Beispiel für das lange Fortbestehen starrer Disziplinengrenzen mag eine Publikation des Institutes für Österreichkunde über Diplomatie und Außenpolitik Österreichs aus dem Jahr 1977 dienen, an dem nur Historiker*innen und ein Völkerrechtslehrer mitwirkten und in dessen Vorwort es dennoch heißt, dass „…ein plastisches Bild wesentlicher Elemente der Entwicklung österreichischer Außenpolitik und Diplomatie…geboten werden soll…“ (Zöllner 1977, 4).
- 2.
Umfasst Vorlesungen (VO), Lektürekurse (LK), Übungen (UE), Proseminare (PS) und Seminare (SE) zu österreichischer Außenpolitik seit 1945 allgemein sowie zu diversen Teilaspekten, u. a. wirtschaftliche Dimensionen, Sicherheitspolitik, Friedensforschung, Akteure, Internationale Organisationen, Vergangenheitspolitik, Kulturdiplomatie oder Balkanpolitik.
- 3.
Lehrveranstaltungen mit dem Übertitel „Internationale Politik“ wurden in die Liste aufgenommen, wenn aus der Beschreibung ein eindeutiger Teil zu österreichischer Außenpolitik erkennbar war. Für die Erstellung der Übersicht über einschlägige Studienangebote in Österreich auf Grundlage öffentlich zugänglicher Unterlagen danke ich Frau Nadja Wozonig/Diplomatische Akademie Wien.
- 4.
Das Österreichische Institut für Internationale Politik (oiip) hat Öffnungszeiten für die Abgabe von Uni-Arbeiten angegeben und fordert Studierende aktiv dazu auf, an den Veranstaltungen des Instituts teilzunehmen.
- 5.
Die Verwaltungsakademie bietet in einem Fachbereich „Europa und Internationales“ für Bundesbedienstete Fortbildungsseminare mit dem Schwerpunkt EU an (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport n.d.).
- 6.
Zu den bei der Neugründung der Diplomatischen Akademie 1963 über die Forschungs- und Lehrziele diskutierten Schwerpunkte siehe den Zeitzeugenbericht von Stourzh (2004). Für das aktuelle Kursangebot in den akademischen Programmen und im Bereich „Executive Programmes“ siehe: https://www.da-vienna.ac.at/de/Programme.
- 7.
Für eine Übersicht der Vorschriften und Materialien siehe die Webseite des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/prinz/politische_bildung.html.
- 8.
Als Beispiel verweise ich auf den Friedensforscher und Privatdozent für Politikwissenschaft an der Universität Wien Thomas Roithner: http://thomasroithner.at/cms/index.php.
- 9.
Alle Ausgaben der von 1973 bis 2020 erschienenen Vierteljahresschrift sind online auf den Internetseiten der Österreichischen Nationalbibliothek verfügbar: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=eur.
- 10.
Für eine gute Übersicht der Beiträge bis zum 25. Jahrgang 2016 siehe: Bischof und Karlhofer (2016).
- 11.
Ausführliche Darstellung der Entwicklung europapolitischer Studienangebote in Österreich in: Hummer (2015).
- 12.
Nach Einschätzung von Hummer (2015, 105) haben in den 1980er Jahren rechtswissenschaftliche Studien die österreichische Integrationsdebatte „deblockiert“. Einschlägige Arbeiten von Wirtschaftswissenschaftlern seien später gefolgt. Grundlegende Arbeiten von Politikwissenschaftlern seien erst noch später gefolgt.
- 13.
Zu den in der Forschung unterschiedlichen Periodisierungen der österreichischen Außenpolitik seit 1945 siehe Sonnleitner (2018, 82‒104).
- 14.
- 15.
In der österreichischen Politikwissenschaft ist die Diskussion über Methoden und Konzepte innerhalb der Disziplin nicht abgeschlossen. Siehe als Beispiel: König (2012).
- 16.
Auf die Ende 2017 gegründete Plattform „Forum außenpolitische Think-Tanks“ (FaTT), die mehr als dreißig Institutionen umfasst (www.fatt.at), und dem Informationsaustausch zwischen diesen außeruniversitären Einrichtungen und mit außenpolitischen Entscheidungsträgern dient, wurde bereits im Abschnitt über Forschung hingewiesen.
- 17.
Kirt (2006, 255): „Those authorized and in charge of dealing with a state’s external affairs – be it the head of government or the foreign minister – collect information, evaluate it against the background of their domestic interests, weigh different replies or courses of action against each other, eventually make a decision, and implement this decision in a second step.“
Literatur
Anholt, Simon. 2010. Places. Identity, Image and Reputation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bischof, Günter, und Ferdinand Karlhofer, Hrsg. 2016. Austrian Studies Today, Contemporary Austrian Studies, Bd. 25. Innsbruck: innsbruck university press.
Brix, Emil, und Erhard Busek. 2018. Mitteleuropa Revisited: Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird. Wien: Kremayr & Scheriau.
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. n.d. Der höhere auswärtige Dienst. https://www.bmeia.gv.at/ministerium/karrieremoeglichkeiten/laufbahn-im-bmeia/hoeherer-auswaertiger-dienst/.
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. n.d. Europa und Internationales 2021. https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/in_verwaltung_arbeiten/europa_und_internationales_2021.html.
Bundesministerium für Landesverteidigung. n.d. Landesverteidigungsakademie. https://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/lvak/akademie/index.shtml.
Dachs, Herbert. 1983. Die Rolle der politischen Bildung in der Außenpolitik. In Außenpolitik und Demokratie in Österreich: Strukturen-Strategien-Stellungnahmen. Ein Handbuch, Hrsg. von Renate Kicker, Andreas Khol, und Hanspeter Neuhold, 202–234. Salzburg: Wolfgang Neugebauer Verlag.
Dachs, Herbert, et al. Hrsg. 2006. Politik in Österreich: Das Handbuch. Wien: Manz.
Diplomatische Akademie Wien. 2014. Diplomatische Akademie Wien trauert um Gründungsdirektor Prof. Ernst Florian Winter. https://www.da-vienna.ac.at/en/The-Academy/News-and-Media/MoreInformation/Id/69/Diplomatische-Akademie-Wien-trauert-um-Grundungsdirektor-Prof-Ernst-Florian-Winter.
FaTT. 2021. Forum außenpolitische Think-Tanks (FaTT). https://www.fatt.at/de-de/About-FaTT.
Gehler, Michael. 2005. Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik: Von der alliierten Besatzung bis zum Europa des 21. Jahrhunderts. Innsbruck: StudienVerlag.
Höll, Otmar. 2004. Politikwissenschaft in Österreich und Internationale Politik. In Demokratie und Kritik: 40 Jahre Politikwissenschaft in Österreich, Hrsg. von Helmut Kramer, 227‒246. Frankfurt a. M.: Lang.
Hummer, Waldemar. 2015. Politikwissenschaft in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Europapolitik: Institutionelle und materielle Rahmenbedingungen. Innsbruck: StudienVerlag.
Institut für Zeitgeschichte. 2020. Zeitgeschichte als Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. Universität Wien. https://zeitgeschichte.univie.ac.at/forschung/forschungsschwerpunkte/zeitgeschichte-als-wissens-und-wissenschaftsgeschichte/.
Jaeger, Thomas, Hrsg. 2020. 25 Jahre EU-Volksabstimmung. Wien: Jan Sramek Verlag.
Kicker, Renate, Andreas Khol, und Hanspeter Neuhold, Hrsg. 1983. Außenpolitik und Demokratie in Österreich: Strukturen-Strategien-Stellungnahmen. Ein Handbuch. Salzburg: Wolfgang Neugebauer Verlag.
Kirt, Romain. 2006. Foreign Policy in the Age of Globalization: Does Globalization Constrain Nation States’ Sovereignty in Conceiving and Maintaining their Foreign Policy? In Austrian Foreign Policy in Historical Context, Hrsg. von Günter Bischof, Anton Pelinka, und Michael Gehler, 14:246–263. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
KMU Akademie und Management AG. n.d. Master of Science (MSC). KMU Akademie. https://www.kmuakademie.ac.at/.
Kneissl, Karin. 2020. Diplomatie Macht Geschichte: Die Kunst des Dialogs in unsicheren Zeiten. Hildesheim: Olms.
Kneucker, Raoul F. 1983. Die Rolle der Bundesverwaltung. In Außenpolitik und Demokratie in Österreich: Strukturen-Strategien-Stellungnahmen. Ein Handbuch, Hrsg. von Renate Kicker, Andreas Khol, und Hanspeter Neuhold, 31–110. Salzburg: Wolfgang Neugebauer Verlag.
König, Thomas. 2012. Vom Naturrecht zum Behavioralismus und darüber hinaus: Konzeptionelle Grundlagen der Disziplin Politikwissenschaft in Österreich. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 41(4):419–438.
Kramer, Helmut. 1989. Außenpolitikforschung in Österreich: zur politischen Kultur im Verhältnis Politikwissenschaft und Politik. In Politische Kultur in Österreich, Hrsg. von Hans-Georg Heinrich, Alfred Klose, und Eduard Ploier, 28–36. Linz: VERITAS.
Kramer, Helmut, Hrsg. 2004. Demokratie und Kritik: 40 Jahre Politikwissenschaft in Österreich. Wien: Lang.
Kramer, Helmut. 2006. Außenpolitik. In Politik in Österreich: Das Handbuch, Hrsg. von Herbert Dachs, Peter Gerlich, Herbert Gottweis, Helmut Kramer, Volkmar Lauber, Wolfgang C. Müller, und Emmerich Tálos, 807–939. Wien: Manz.
Kramer, Helmut. 2010. Strukturentwicklung der Außenpolitik (1945–2005). In Politik in Österreich: Das Handbuch, Hrsg. von Herbert Dachs, Peter Gerlich, Herbert Gottweis, Helmut Kramer, Volkmar Lauber, Wolfgang C. Müller, und Emmerich Tálos, 807–837, Wien: Manz.
Kramer, Helmut. 2013. Bleibt Österreichs Außenpolitik eine ‚Draussenpolitik‘? International 4:45–50.
Kramer, Helmut. 2016. Austrian Foreign Policy 1995–2015. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 45(2):49–57.
Müller, Patrick, und Heidi Maurer. 2016. Austrian Foreign Policy and 20 Years of EU Membership: Opportunities and Constraints. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 45(2):1–47.
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung. n.d. „Building und Training“ ASPR. https://www.aspr.ac.at/bildung-training/.
Pelinka, Anton. 2004. Politikwissenschaft, kritische Öffentlichkeit und Politik. In Demokratie und Kritik: 40 Jahre Politikwissenschaft in Österreich, hrsg. von Helmut Kramer 99–112. Wien: Lang.
Seidenader, Julian. 2021. „Die Think Tank-Landschaft Österreichs: Eine Umfrage unter den Mitgliedern des Foreign-Affairs Think Tank Netzwerk“. Policy Brief, Ponto – Grassroots Think Tank für Europa- und Außenpolitik, Juni 2021. https://www.pontothinktank.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Brief-3_4.pdf.
Senn, Martin, und Franz Eder. 2018. Cui Bono Scientia Politica? A multi-dimensional concept of relevance and the case of political science in Austria. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 47(3):1–17.
Sonnleitner, Sandra. 2018. Bilateral Diplomacy and EU Membership: Case Study on Austria. Baden-Baden: Nomos.
Stourzh, Gerald. 2004. Eine Besprechung in der Armbrustergasse. In 250 Jahre: Von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien, Hrsg. von Oliver Rathkolb, 183–196. Innsbruck: StudienVerlag.
Stourzh, Gerald, und Wolfgang Mueller. 2020. Der Kampf um den Staatsvertrag 1945–1955: Ost-West-Besetzung, Staatsvertrag und Neutralität Österreichs. Wien: Böhlau.
Thunert, Martin. 2007. Politikberatung. In Handbuch zur deutschen Außenpolitik, Hrsg. von Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, und Reinhard Wolf, 336–352. Wiesbaden: VS Verlag.
Zöllner, Erich, Hrsg. 1977. Diplomatie und Außenpolitik Österreichs: Elf Beiträge zu ihrer Geschichte. Wien: Bundesverlag.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2023 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Brix, E. (2023). Forschung und Lehre zu Außenpolitik. In: Senn, M., Eder, F., Kornprobst, M. (eds) Handbuch Außenpolitik Österreichs. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37274-3_10
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-37274-3_10
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-37273-6
Online ISBN: 978-3-658-37274-3
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)