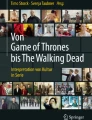Zusammenfassung
Ein soziologischer Blick auf den Publikumserfolg von Game of Thrones legt nahe, dass dieser nicht an einer Widerspiegelung aktueller gesellschaftlicher Realitäten liegt, sondern in der spezifischen Form der literarischen Fiktion und filmischen Inszenierung. Die Ästhetik der Macht als künstlerische Gestaltung oder, im ursprünglichen Wortsinn, Versinnlichung eines der bedeutendsten und wirkmächtigsten sozialen Phänomene in der Form einer Fantasy Fiction stellt das eigentliche Faszinosum der Serie dar. Gewalt oder Nacktheit entfalten erst in diesem Kontext ihre Wirkungen. Einen wesentlichen Anteil an der Erzeugung von Spannung hat die Darstellung der Vielschichtigkeit der Macht als soziales Phänomen. Die Serie greift dabei auf Metaphern wie die von Drachen zurück, die kulturgeschichtlich mit Unzähmbarkeit und Übermacht fundamentaler Kräfte verbunden sind. Drachen und Ungeheuer aller Art in Träumen, Märchen, in Literatur und Filmen stellen ein Faszinosum dar, gerade weil sie die in der Sphäre der Wirklichkeit verdrängten Kräfte ästhetisch appräsentieren und damit eine „erlösende“ Wirkung erzielen. Die gelungene Gestaltung des Spannungsfeldes von Chaos und Ordnung mit Stilmitteln tief verwurzelter kultureller Metaphern ist ein entscheidender Faktor der faszinierenden Wirkung auf ein weltweites Publikum.
„You may say‚ ‚Well‘ dragons don‘t exist.‘ It‘s, like‚ yes, they do – the category ‚predator‘ and the category ‚dragon‘ are the same category. It absolutely exists. It’s a superordinate category. It exists absolutely more than anything else.“
Jordan B. Peterson (2018a)
„You don’t get the gold without the dragon.“
Jordan B. Peterson (2019)
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
Schlüsselwörter
1 Fantasy Fiction und soziale Realität
Sowohl die Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer (Originaltitel A Song of Ice and Fire) als auch die Filmserie Game of Thrones haben seit ihrem Erscheinen eine enorme gesellschaftliche Resonanz erfahren. Die Serie gilt als eine der populärsten Produktionen der TV-Geschichte. Ein großer Teil der Fangemeinde im Internet berichtet über ein graduelles Hineingezogen-Werden in die komplexe Handlungsstruktur, das in eine Faszination mündet, der man sich kaum wieder entziehen kann. All dies sind Voraussetzungen, die dazu prädestinieren, zu einem Studienobjekt der Soziologie zu werden. Das war aber bislang nicht oder nur in einem marginalen Ausmaß der Fall. Die auffallende „soziologische Abstinenz“ zu Game of Thrones mag damit zusammenhängen, dass der In-Beziehung-Setzung der fiktiven Welt von Game of Thrones mit der gesellschaftlichen Realität im Rahmen der dominanten soziologischen Paradigmen Schranken gesetzt sind. Die sogenannte Cultural Sociology und die Kulturproduktion und -rezeption, die sie analysiert, haben sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzenten quasi co-evolutionär entwickelt. Beide legen ihren Schwerpunkt auf einen sozio-politischen Symbolismus bzw. dessen sozialwissenschaftliche Interpretation. Game of Thrones lässt sich schwer in diese Tradition einordnen. Der Publikumserfolg liegt nicht an einer Widerspiegelung aktueller gesellschaftlicher Realitäten, sondern in der spezifischen Form der Fiktion selbst, in der es um die Ästhetisierung fundamentaler menschlicher Kräfte geht und die in dieser Weise eine Wirkung durch eine effektvolle Metaphorik erzielt.
In einem Interview wurde dem Autor der Serie, George R. R. Martin, die Frage gestellt, ob er zustimmen würde, dass es in seinen Büchern um Macht gehe. Und Martin antwortete, ja, gewiss, es gehe um Macht, den Gebrauch von Macht, es gehe um die Art, wie die Sehnsucht nach Macht und die Lust zur Macht uns korrumpiert, so wie uns auch der Mangel an Macht korrumpieren könne. All dies bringe Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten (George R. R. Martin 2019a). Soweit die Sichtweise des Autors selbst. Also, Geschichten über machtlüsterne Menschen, die dazu gebracht werden, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten, das ist in jedem Fall etwas, wo man gerne hinhört oder hinsieht, und etwas, was jede Menge Spannung verspricht. Hier liegt ein Ausgangspunkt für die Erklärung des Erfolges der Serie: Die Ästhetik der Macht als künstlerische Gestaltung oder, im ursprünglichen Wortsinn, Versinnlichung eines der bedeutendsten und wirkmächtigsten sozialen Phänomene in der Form einer Fantasy Fiction. Die Attraktivität von Game of Thrones basiert demnach nicht auf einem inhaltlich-thematischen oder soziopolitischen Realismus, sondern auf formal-ästhetischen Qualitäten.
Zu den Themen der Geschichten und Verfilmungen, die im gängigen Verständnis nicht den Normen entsprechen, zählen wohl die exzessive Gewalt und ebenso exzessive Sexualität. Eine Studie des Institutes für Soziologie der Universität Wien ging zunächst von der Hypothese aus, dass dies die Hauptmotive für den Konsum der Serie sind. Die Hypothese wurde jedoch im Zuge der empirischen Erhebung falsifiziert. Es konnte klar belegt werden, dass diese Inhalte als solche nicht zu den zentralen Motiven des Konsums der Serie zählen. „Vorkommen von sexuellen Handlungen und Nacktheit“ wurden nur von 18 % der Befragten als Motiv genannt, und Gewaltszenen wie Folter und Hinrichtung von 20 %. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn in einer Zeit des Überangebotes von Sexualität und von Gewalt im Internet hier noch Bedarf nach einer im Vergleich dazu trotz alledem moderaten Filmserie eine wichtige Rolle spielen würde. Die Studie berichtet zwar von signifikanten Unterschieden in den entsprechenden Antworten von Männern und Frauen, aber das ist analog bei Umfragen zur Häufigkeit von Geschlechtsverkehr der Fall, den Männer den Umfragen zufolge signifikant häufiger haben als Frauen, was aber das bislang ungelöste Rätsel nach sich zieht, mit wem eigentlich, wenn es tatsächlich so wäre. Dass bei solchen Antworten Stereotype bzw. Selbststereotype eine Rolle spielen, dürfte also klar sein. Ausschlaggebend für Game of Thrones-Rezipient*innen waren vielmehr die Aspekte „Interesse am Verlauf und Ausgang der Intrigen“ (87,6 %) und „mehrere parallellaufende Handlungsstränge“ (66,7 %)“ (Dietrich et al. 2015, S. 34). Ähnlich war das Ergebnis bei der Erhebung der Rezipient*innen-Meinungen über die Gründe der Beliebtheit der Serie: Gewalt und Sex sind nachrangig gegenüber Story/Handlung, Unvorhersehbarem und den spezifischen Figuren der Handlung eingestuft (Dietrich et al. 2015, S. 41). Es ist also, kurz zusammengefasst, nicht der Realismus der Sexualität oder der Gewalt, der die Attraktivität von Game of Thrones darstellt, sondern die Einbindung dieser Inhalte in eine spezifische Form der Fiktionalität.
Ähnlich verhält es sich mit Versuchen, politische und soziale Inhalte als Widerspiegelung gesellschaftlicher Realitäten zu dekodieren. Auf soziologischen Internetseiten finden sich durchwegs Aussagen wie, die Popularität von Game of Thrones basiere darauf, dass sie die Realität der Gesellschaft reflektiere, die Korruption in der Gesellschaft darstelle etc. Selbst wenn diese Analysen zutreffend wären, ist daraus nicht der immense Publikumserfolg zu begründen. Wenn jemand an Korruption in der Gesellschaft interessiert ist, dann würden sich einfach die Nachrichten im Hauptabendprogramm empfehlen, die stehen Game of Thrones ja um nichts nach.
George R. R. Martin, der es ja wissen muss, hat einmal gemeint, er wolle nichts über reale Politik schreiben, und er habe nicht vor, Lektionen zu erteilen (teaching lessons), sondern Geschichten zu erzählen (telling stories)Footnote 1. Und es sind gerade diese Geschichten, die das Faszinosum ausmachen. Die Leitthemen der zeitgenössischen Soziologie wie Gender, soziale Ungleichheit oder neoliberal agierende Machteliten mögen zwar als Inhalte zu erkennen oder hineinzuinterpretieren sein, aber sie bestimmen nicht als solche den Verlauf der Handlung und stellen auch keine Attraktoren für das Publikum dar. Die Handlungs- und Inszenierungslogik in Game of Thrones entwickelt sich quasi aus sich heraus. Sie stellt eine fiktive Welt im eigentlichen Sinne dar. Es ist die Formenlogik der Fantasy Fiction, die die Spannung erzeugt und damit ihr Publikum begeistert. Sie entfaltet ihre Wirkung durch die ästhetische Konstruktion von Metaphern. Sehr abstrakt und theoretisch ausgedrückt, findet sich in gelungener Fantasy Fiction keine homomorphe Widerspiegelung, sondern eine funktionale Ästhetisierung von Gesellschaft und Lebenswelt der Rezipient*innen. Das soll im Folgenden am Beispiel des spezifischen Machtbegriffes in Game of Thrones und der Metapher von Drachen ausgeführt werden.
2 „Power is a Curious Thing My Lord“
Diese Aussage versuche ich sinngemäß den Studierenden in meinen Soziologie-Lehrveranstaltungen zu vermitteln, wenn es um das Thema der Macht geht. In dieser wunderbaren Formulierung findet sich der Satz in einem Dialog zwischen Tyrion Lannister und Lord Varys (beide sind in der Handlung Berater des Königs Joffrey). Dieser Dialog enthält in gewisser Weise den Geist der gesamten Serie.
„Power is a curious thing“, beginnt Varys in der Szene und gibt Tyrion ein Rätsel auf: „Three great men sit in a room, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other twoFootnote 2. Who lives, who dies?“ Die unmittelbare Anwort von Tyrion: „It depends on the sellsword“. Varys fragt nach: „Does it? He has neither crown nor gold nor favor with the gods.“ Tyrion insistiert: „He has a sword, the power of life and death.“ Varys: „But if it’s swordsmen who rule why do we pretend kings hold all the power. When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey, the executioner or something else?“ Tyrion, überfordert von der Sache, gibt auf. Varys sieht die Lösung so: „Power resides where men believe it resides. It’s a trick, a shadow. And a very small man can cast a very large shadow.“ (Game of Thrones, „What Is Dead May Never Die“). Im Buch findet sich eine Fortsetzung: „A shadow on the wall, yet shadows can kill“ (Martin 2003, S. 113).
Der Punkt in diesem Dialog ist wohl der, dass ein Verständnis von Macht als Möglichkeit zur Durchsetzung von Eigeninteressen mithilfe von überlegenen Mitteln, in der Regel sind es Waffen, zu kurz greift. Ein solcher individualistischer oder utilitaristischer Machtbegriff geht auf Thomas Hobbes und dessen berühmte Schrift Leviathan (2017 [1651]) zurück. Hobbes hat es in einer chaotischen Zeit des englischen Bürgerkrieges des 17. Jahrhunderts, eines „Naturzustandes“ des Krieges aller gegen alle, verfasst. Das Gewaltmonopol eines „absoluten“ Herrschers erscheint als die Grundlage der Überwindung des Naturzustandes. Die Ästhetisierung eines solchen utilitaristischen Machtverständnisses würde bald langweilig werden, vielleicht mit Ausnahme für einfach gestrickte und sadistisch veranlagte Personen. Aus dem angeführten Dialog und in der Entfaltung des Plots der Serie wird klar, dass in Game of Thrones ein viel differenzierterer Machtbegriff literarisch und filmisch in Szene gesetzt wird. Genau dies hat einen wesentlichen Anteil an der Erzeugung von Spannung. Game of Thrones ästhetisiert die Vielschichtigkeit der Macht als soziales Phänomen.
Soziologisch betrachtet ergibt sich aus der Tatsache, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, eine Grundspannung oder, sagen wir, eine Grundangst, nämlich die des Ausgeschlossen-Werdens. Das hat gewiss phylogenetische Ursprünge, da über den längsten Zeitraum der Menschheitsgeschichte ein sozialer Ausschluss auch den Tod bedeutete. Aber auch die modernen Formen eines Ausschlusses können dramatische Konsequenzen haben. Das ist der quasi anthropologisch-soziologische Ausgangspunkt einer Reihe von grundlegenden Handlungsmotiven wie das Streben nach Status oder Prestige oder eben das Streben nach Macht, weil sie das Grundbedürfnis des Dazugehörens absichern. Darauf basieren aber auch scheinbar gegenteilige Motive wie das der Submissivität von Sykophanten (also schmierige Kriecher, Speichellecker) und des Flagellantentums, um ein Beispiel aus den mittelalteraffinen Game of Thrones-Inszenierungen zu nennen, da all dies ebenfalls die Zugehörigkeit sichert. Dies ist wunderbar im berühmten „Walk of Atonement“ Cerseis in Szene gesetzt. Cersei ist die Königinmutter und wird von einer religiösen Sekte dazu gezwungen, geschoren und nackt in beschämender Weise durch die Hauptstadt zu gehen. Der „Walk of Atonement“ dient der Absolution ihrer Sünden durch diese erniedrigende Bloßstellung.
Scham und Beschämung sind genuin soziale Gefühle. Beschämt zu werden durch Nacktheit, geschorenes Haar, kurz vulnerabel zu sein, um ein heute geläufiges Wort zu verwenden, wurde nach einer Aussage des Autors in der Absicht inszeniert, Cersei die beeindruckende und Macht verleihende Schönheit einer Majestät zu entziehen und damit der Öffentlichkeit ihre Machtlosigkeit zu zeigen, um sie am Ende dieser Szene gebrochen und zerstört zu sehen. Cerseis „Walk of Atonement“ ist ein Beispiel, dass die Ästhetisierung der Macht in Game of Thrones auf dieser grundlegenden sozialen Dimension der conditio humana aufbaut. Und dies hat wiederum einen wesentlichen Anteil an der Erzeugung von Spannung, wie auch an der affektiven Aufgeladenheit bei der Identifikation mit einzelnen Figuren. Gewaltdarstellungen oder Nacktheit, wie in jener Szene, entfalten erst dadurch ihre Wirkungen.
3 Die Metaphorik von Drachen
George R. R. Martin antwortete auf die Frage nach der Bedeutung der Drachen in seinen Erzählungen: „I love dragons … I loved dragons initially in the work of other people…. And it is interesting how many societies have dragons in their mythology. … They represent power of course in the books.“ (Martin 2019b) Es ist gerade die Macht in der Differenziertheit und sozialen Dimension, die diese Repräsentation zur Voraussetzung hat. Die Komplexität und Unberechenbarkeit von Macht, das Kippen von Macht in Ohnmacht, von Loyalität in Illoyalität – also ihre „Schattenhaftigkeit“ in der Sprache von Varys – sind ein durchgehendes Stilmittel des Spannungsaufbaus. Treue und Verrat, Morde im Kontext von Liebe und Freundschaft illustrieren das Phänomen. Eine Schlüsselszene dazu findet sich in der letzten Episode der letzten Staffel. Die vermeintlich legitime Erbin des Eisernen Throns Daenerys wird zunächst als die strahlende Siegerin dargestellt, nachdem sie sich mit übergroßer Grausamkeit gegen ihre Feinde durchgesetzt hat. Sie trifft auf Jon Snow, der sie als Tyrannin wahrnimmt und zur Rede stellt, ihr aber in Folge eines Gespräches dann doch die Treue schwört. Ein passionierter Kuss scheint ihre Vereinigung in Macht und Liebe zu besiegeln, „jetzt und für immer“, wie Jon Daenerys bei romantischer Hintergrundmusik ins Ohr flüstert, um ihr kurz danach einen Dolch in die Brust zu drücken. Und gerade in diesem Moment chaotisch-anarchischen Zusammenbruchs einer idyllischen Ordnung erscheint im Hintergrund ein Drache. (Game of Thrones, „The Iron Throne“).
Wie in dieser Szene sind Unzähmbarkeit und Übermacht fundamentaler Kräfte kulturgeschichtlich mit der Metapher des Drachen verbunden. Es sind Ungeheuer in archaisch furchteinflößender Form. Der kanadische Psychologe Jordan B. Peterson verwendet den Ausdruck „Dragon of Chaos“ für die Urangst von Menschen gegenüber dem Unkontrollierbaren, dem undurchschaubar Dunklen, dem Hobbesschen „Naturzustand“ des Kampfes Aller gegen Alle. Der größte Drachen von allen, meint Peterson, existiere im eigenen Herzen. „…That malevolence also exists in your heart, and that is the greatest dragon of all – just as mastering that malevolence constitutes the greatest and unlikeliest of individual achievements.“ (2021, S. 415). Man müsse sich mit ihm konfrontieren, um Ordnung in das eigene Leben zu bringen, und solle ihm nicht ausweichen und ihn nicht verdrängen. Drachen und Ungeheuer aller Art in Träumen, Märchen, in Literatur und Filmen stellen ein Faszinosum dar, gerade weil sie den in der Sphäre der Wirklichkeit verdrängten Drachen ästhetisch appräsentieren und uns damit von ihm „erlösen“.
Der Sieg über den „Dragon of Chaos“ hat aber eine Kehrseite, die ihn in anderer Form zurückkehren lässt. Zu starre Ordnung nämlich kann dem Leben Schaden zufügen und ist genauso gefährlich wie das Chaos. In diesem Sinne ist es in der Hobbesschen Theorie gerade der die Ordnung herstellende absolute Herrscher, der mit der Metapher des Leviathans verbunden wird. Georg Simmel (1996 [1918]) hat es als die Tragödie der Kultur bezeichnet, dass sie, geschaffen für ein erfülltes Leben und zur Bewältigung einer als chaotisch-bedrohlich erlebten Natur, dem Leben ein todbringendes Korsett werden kann. Heimito von Doderer, ein berühmter österreichischer Literat, hat es in seinem Aufsatz „Die Wiederkehr der Drachen“ (1970) wunderbar literarisch dargestellt:
„Was aber hätte uns wesentlich die Wiederkehr der Drachen zu sagen, gesetzt, sie träten da und dort ganz unmissverständlich und unbestreitbar aus der Tiefe der Zeiten hervor? … Ist die Großstadt nichts als eine letzte Metastase des Urwaldes, in dessen direkte Grundbedeutung sie zurückkehren soll, überwachsen und überwildert, wie einst die großen Städte Mittelamerikas dem Urwalde wieder anheimfielen? Es ist eine alte Meinung, dass die Erscheinung von Chimären und Ungeheuern einen Wechsel der Zeiten anzeigt. … Werden sich die Nachkommen des motorisierten Neandertalers unserer Zeit … dereinst wieder von den Wäldern umfasst sehen und den wiedergekehrten Drachen gegenüber?“ (1970, S. 26).
Kultur sei, so Jordan Peterson, sowohl weiser König als auch autoritärer Tyrann. Wir müssen lernen, diese beiden Pole in Balance zu halten, um mit den Herausforderungen der Wechselhaftigkeiten des Lebens umgehen zu können (Peterson 2021, S. 435). Oder, um zu Game of Thrones zurückzukehren, ein Zitat von Lord Baelish: „Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder“. (Game of Thrones, „The Climb“).
Kurz zusammengefasst: Die Drachen-Metapher ästhetisiert sowohl die Unkontrollierbarkeit archaischer Kräfte als auch den Verlust der Lebendigkeit im Falle ihrer Verdrängung. Es geht um die Ästhetisierung des Spannungsfeldes der Kräfte des Chaos und der Kämpfe um Ordnung sowie deren Fallen. Dies wird in Game of Thrones mit Stilmitteln tief verwurzelter kultureller Metaphern erreicht. Darauf beruht, so meine These, die faszinierende Wirkung auf ein weltweites Publikum.
4 Resümee
Eine Welt aus Feuer und Eis ergibt im Mittelwert eine lauwarme Welt, wohl-temperiert wie das Klima in unseren Wohnzimmern und die dazugehörige Hintergrundmusik. Wir haben dies in unserer Gesellschaft so eingerichtet mit all den vielen Vorteilen, aber, wie wir manchmal empfinden, doch auch einigen damit verbundenen Opfern. Game of Thrones erinnert daran, dass wir in ein größeres Universum eingebettet sind, das sich unserer Kontrolle entzieht und auf das wir in unserer Existenz doch angewiesen sind. Dies mag beängstigend sein, aber es ist auch ein Wegweiser aus einer berechenbaren und beengenden Welt, einem „stahlharten Gehäuse“ der modernen Kultur, wie es Max Weber genannt hat. Und Jordan Peterson hat auch einen Tipp, wie man angesichts dessen handeln sollte: „If you have to fight a dragon, you should go to its lair before it comes to your village.“ Und so erscheint es als Desiderat, die mit der Filmserie verbundene Suggestion mitzunehmen in das reale Leben, um auch hier dem verdrängten Drachen einen Platz zurückzugeben, oder, anders ausgedrückt, gelegentlich ein wenig mehr Feuer und Eis zuzulassen.
Notes
- 1.
Zitiert nach Beaton (2016, S. 211). Sie fügt hinzu: „It is important not to reduce the aesthetic qualities of Martin’s work to thematic concerns“.
- 2.
Im Buch findet sich die Ergänzung: „‚Do it,‘ says the king, ‚for I am your lawful ruler.‘ ‚Do it,‘ says the priest, ‚for I command you in the name of the gods.‘ ‚Do it,‘ says the rich man, ‚and all this gold shall be yours.‘“ (Martin 2003, S. 113).
Literatur
Beaton, Elizabeth. 2016. Female Machiavellians in Westeros. In Women of Ice and Fire. Gender, Game of Thrones, and Multiple Media Engagements, Hrsg. A. Gjelsvik und R. Schubart, 193–217. London: Bloomsbury.
Dietrich, Marlene, S. Hofmann, M. Lordick, M. Maier, und S. Reisinger. 2015. Game of Thrones. Eine quantitative Erhebung über die Gründe der Beliebtheit der TV-Serie aus mediensoziologischer Perspektive. Endbericht Forschungspraktikum, Universität Wien.
Doderer, Heimito von. 1970. Die Wiederkehr der Drachen. München: Biederstein.
Hobbes, Thomas. 2017 [1651]. Leviathan, or the Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil. UK: Penguin Random House.
Martin, George. 2003. A Song of Ice and Fire. Glasgow: Harper Collins.
Peterson, Jordan. 2018a. Interview. New York Times. https://www.nytimes.com/2018/05/18/style/jordan-peterson-12-rules-for-life.html. Zugegriffen: 21. Mai 2021.
Peterson, Jordan. 2021. Beyond Order. 12 More Rules for Life. Canada: Random House.
Simmel, Georg. 1996 [1918]. Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In Georg Simmel Gesamtausgabe, Bd. 14, 385–416. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
YouTube-Interviews
Martin, George. 2019a. „George RR Martin on Power and Leadership“. YouTube. https://www.youtube.com/results?search_query=Georgr+RR+Martin+interview+on+power+asnd+leaership. Zugegriffen: 21. Mai 2021.
Martin, George. 2019b. „George RR Martin on the History and Lore of Dragons“. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1iEJz15Cx4c. Zugegriffen: 21. Mai 2021.
Peterson, Jordan. 2019. „You don’t get the gold without the dragon“. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LjIAzKo62MQ&t=283s. Zugegriffen: 21. Mai 2021.
Filmmaterial
The Climb, Game of Thrones, Season 3, Episode 6, 2013. HBO, Regie: Alik Sakharov, Drehbuch: David Benioff und D. B. Weiss.
The Iron Throne, Game of Thrones, Season 8, Episode 6, 2019. HBO, Regie und Drehbuch: David Benioff und D. B. Weiss.
What Is Dead May Never Die, Game of Thrones, Season 2, Episode 3, 2012. HBO, Regie: Alik Sakharov, Drehbuch: Brian Cogman.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Staubmann, H. (2022). Game of Thrones und die Ästhetik der Macht. In: Gamper, A., Müller, T. (eds) „Beyond the Wall”: Game of Thrones aus interdisziplinärer Perspektive. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36145-7_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36145-7_12
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-36144-0
Online ISBN: 978-3-658-36145-7
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)