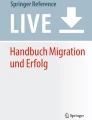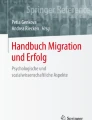Zusammenfassung
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über psychologische Ansätze, die zur Erklärung von Migrationsprozessen und deren psychologischen Folgen herangezogen werden können. Dies umfasst unter anderem den Identitätsansatz, den Ansatz des kulturellen Lernens und den stresstheoretischen Ansatz.
Zunächst werden grundlegende Erkenntnisse zu den Themen Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung angeführt und in verschiedene Theorien eingebettet.
Im nächsten Schritt wird Akkulturation, als Identitätsansatz, aus theoretischer und empirischer Sicht anhand verschiedener Modelle und Ansätze erläutert. Besonders die Akkulturationsstrategie der Integration wird hervorgehoben, da diese mit Vorteilen und Chancen, sowohl für die Migrierenden als auch die Mehrheitsgesellschaft, einhergeht.
Anschließend werden unterschiedliche Aspekte und Herausforderungen eines Akkulturationsprozesses und die jeweiligen Einflussfaktoren dargestellt. Beispiele sind der Kulturschock und der akkulturative Stress, die mit negativen Emotionen, Angst oder gar Depressionen zusammenhängen. Dem gegenüber steht der Prozess der kulturellen Anpassung, den das Individuum durchlebt, bis es sich in der neuen Kultur wohlfühlt und sich kulturadäquate Verhaltensweisen angeeignet hat.
Den Abschluss des Kapitels bilden verschiedene Einflussfaktoren auf den interkulturellen Erfolg.
You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF
Similar content being viewed by others
1 Einleitung
Die empirisch psychologische Forschung ist von zwei Herangehensweisen geprägt: dem Fokus auf Misserfolgsfaktoren, um Negatives zu bekämpfen und dem Fokus auf Erfolgsprädiktoren, um Positives zu fördern. Obwohl Letzteres vor allem im Zusammenhang mit der Integration und Inklusion von Migrierenden relevant ist, hat sich die Psychologie bisher nur peripher mit Erfolgsprädiktoren bei Migrierten beschäftigt. Die noch immer aktuelle und polarisierende Thematik des Umgangs mit Geflüchteten in Europa, beziehungsweise Deutschland, bewirkt, dass sich die Psychologie vermehrt dem Thema Migration widmet und Erfolgsprädiktoren von Flucht- und Migrationserfahrungen erforscht. Diese empirische Forschung soll Möglichkeiten eröffnen, Herausforderungen und Chancen in Migrationsprozessen zu identifizieren und langfristig Maßnahmen für eine erfolgreiche Migration zu entwickeln.
Um Probleme zu erklären, die im Zusammenhang mit Migrationsprozessen auftreten, betrachten viele Ansätze, beispielsweise aus der Soziologie und Sozialpsychologie, Diskriminierung (sowie Stereotype, Vorurteile, Diversity und Gruppenprozesse) vonseiten einer gesellschaftlichen Mehrheit gegenüber Mitgliedern verschiedener Minderheiten. Diskriminierung und damit verbundene Phänomene allein sind jedoch nicht ausreichend, um die komplexen Prozesse von Migration und Migrationserfolg zu erklären. Eine Ausnahme stellt die kulturvergleichende Psychologie dar, in der ganzheitliche Ansätze zur Erfassung des Konstruktes „Migration“ aufgestellt wurden. Diese Ansätze ergänzen, gemeinsam mit der Diversity Forschung, die Mainstream-Forschung der Psychologie auf bedeutende Weise. Gleichzeitig verdeutlichen sie die Grenzen der Mainstream-Forschung in Bezug auf die Beachtung von Themen wie Migrationsprozessen.
2 Gruppenprozesse und Migration
Im Folgenden werden Erkenntnisse zu Migration und Gruppenprozessen vorgestellt, die vor allem auf klassischen Forschungsansätzen der Sozialpsychologie zu Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung beruhen und dabei helfen, die Intergruppenprozesse zu verstehen, die Migrationsprozesse begleiten.
Individuen durchlaufen einen kulturspezifischen Sozialisierungsprozess, in Zuge dessen sie unter anderem ihre Einstellungen gegenüber sich selbst, ihrer Zugehörigkeit zu Gruppen und die Beziehungen zu anderen Gruppen bilden. Basierend auf dieser Annahme kann ein Stereotyp als Beschreibung einer sozialen Gruppe definiert werden, welcher mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Individuen mit gleicher Kulturzugehörigkeit geteilt wird. Eine soziale Gruppe stellt dabei eine Kategorie dar, der Individuen zugeordnet werden. Diese Zuordnung basiert auf der wahrgenommenen Passung von subjektiv relevanten Eigenschaften der Individuen (beispielsweise Hautfarbe, Einkommen, Geschlecht) zu als typisch wahrgenommenen Eigenschaften einer Kategorie oder Gruppe. Ein Stereotyp fasst diese generalisierten, als typisch empfundenen Ausprägungen von Eigenschaften zusammen und kann negativ, neutral oder positiv sein. Stereotype sind somit hilfreich und nützlich, wenn es darum geht, die Umwelt schnell zu begreifen, sie zu strukturieren und sich zu orientieren (Aronson et al., 2008).
Im Gegensatz zu Stereotypen sind Vorurteile in der Regel negativ konnotiert. Sie werden ebenfalls innerhalb des Sozialisierungsprozesses erlernt, inkludieren jedoch die negative Charakterisierung von Gruppen(mitgliedern) und damit einhergehende negative Affekte und Verhaltenstendenzen (Bierhoff & Frey, 2006). Vorurteile entstehen demnach dadurch, dass sich Menschen innerhalb der eigenen Gruppen isolieren und somit nur wenige Informationen über eine Outgroup zur Verfügung stehen. Es folgt das meist unverhältnismäßige Gefühl der Andersartigkeit zu den Personen, die der Outgroup zugehörig sind.
Vorurteile
Stark ausgeprägte Vorurteile sind sowohl für die betroffenen Individuen als auch für ganze Gesellschaften höchst problematisch. Durch die vorurteilsbelastete Beurteilung und die dementsprechende Behandlung von Personen ist es wahrscheinlich, dass sich ebendiese Personen konform zu den bestehenden Vorurteilen verhalten (vgl. selbsterfüllende Prophezeiung). Bestehende Vorurteile werden auf diese Weise bestätigt und verstärkt. Kommen Ängste und Minderwertigkeitsgefühle auf, werden Personen der Outgroup eher abgewertet, woraus eine eigene Selbstaufwertung resultiert. Vorurteilsbelastete Gruppen werden daher auch tendenziell eher als Sündenbock herangezogen. Da offen gezeigte Vorurteile in vielen westlichen Industrienationen jedoch sozial immer weniger akzeptiert werden, hat sich das Phänomen des modernen Vorurteils beziehungsweise der modernen Diskriminierung entwickelt. Individuen verbergen ihre Vorurteile und geben sich als tolerant aus. Erst im „geschützten“ Raum werden vorhandene Vorurteile preisgegeben (Dovidio & Gaertner, 1996; McConahay, 1986).
Die Forschung zu Vorurteilen weist darauf hin, dass beispielsweise ein starkes Nationalitätsbewusstsein ein intrapersoneller Prädiktor für die Präsenz von Vorurteilen ist (Weiss, 2003). Individuen, die sich als Europäer und Europäerinnen anstatt als Deutsche identifizieren, berichten weniger Vorurteile gegenüber Migrierenden (Becker et al., 2007). Des Weiteren stellt das Ausmaß der illusorischen Korrelation, welche Teil des individuumsorientierten Forschungsansatzes von Hamilton (1976) ist (nach Güttler, 1996, S. 91), einen weiteren Prädiktor für Vorurteile dar. Laut dieser Theorie wird ein Zusammenhang zwischen zwei Aspekten angenommen, der in der Realität nicht existiert. Individuen tendieren meist dazu, nur solche Informationen zu berücksichtigen die im Einklang mit bereits bestehenden Überzeugungen sind. Stellen sich Informationen als inkongruent zu den bestehenden Überzeugungen heraus, werden sie als atypische Ausnahmen gewertet (Güttler, 1996) und bestehende (illusorische) Annahmen verhärten sich weiter. Ein Beispiel für eine illusorische Korrelation ist ein Zusammenhang zwischen dem Islam und religiösem Extremismus, der durch mediale Berichterstattung über Terroranschläge katalysiert wird.
Auf der zwischenmenschlichen Ebene führen Vorurteile dazu, dass Feindschaften zwischen Gruppen entstehen. Individuen aus anderen sozialen Gruppen werden gemieden und abweisend behandelt (Wagner et al., 2008). Beispielsweise erleben Migrierende im deutschen Bildungswesen noch immer Nachteile. Die Befürchtung, einer Gruppe zugeordnet zu werden, die mit Stereotypen behaftet ist (= stereotype threat; dt. Stereotypenbedrohung), beansprucht kognitive Kapazitäten. Durch die geminderte intellektuelle Leistungsfähigkeit kann es sein, dass eine langfristige erfolgreiche Bildungsteilhabe eingeschränkt, beziehungsweise das eigene Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Leistung und Erfolg werden als Konsequenz vornehmlich in anderen Domänen, beispielsweise dem Sport, ausgelebt. Gleichzeitig werden auf diese Weise soziale Unterschiede reproduziert, die wiederum selbst ein Vorurteil gegen Migrierende sind (Uslucan & Brinkmann, 2013).
Da eine erfolgreiche Integration von Migrierenden eng mit der Zugehörigkeit zu ihrer Heimat- und zur Gastkultur zusammenhängt (Swann et al., 2010), ist es für den langfristigen Erfolg gesellschaftlicher Integrationsprozesse wichtig, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl gefördert wird. Für diese Förderung kann die Öffentlichkeitsarbeit von Politikern und Politikerinnen und anderen medienwirksamen Repräsentanten und Repräsentantinnen der Majoritätsgruppe ausschlaggebend sein. Des Weiteren können durch interkulturelle Kontakte individuelle sowie kollektive Befürchtungen und Vorurteile reduziert werden. Wagner et al. (2003) konnten zeigen, dass der Kontakt mit Personen aus Minoritätsgruppen bei Mitgliedern der Majoritätsgruppe zu einer Minderung von Vorurteilen führen kann. Dies gelingt jedoch nur, wenn eigene Einstellungen tatsächlich verändert werden (Wagner et al., 2003).
Soziale Diskriminierung kommt, im Gegensatz zu Vorurteilen, auf der Handlungsebene zum Ausdruck (Bierhoff & Frey, 2006). Genauer gesagt: Soziale Diskriminierung „bezieht sich [dabei] auf den behavioralen Aspekt des Vorurteils und bedeutet allgemein Unterschiede in der Behandlung zu vollziehen, gewöhnlich unter Missachtung der individuellen Eigenarten und Vorzüge“ (Güttler, 1996, S. 84).
Nicht nur ein Migrationshintergrund, sondern auch Religionszugehörigkeit oder eine Abweichung des äußerlichen Erscheinungsbildes von dem der Mehrheitsgesellschaft können dazu führen, dass eine Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft infrage gestellt wird (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2016). Soziale Diskriminierung beruht jedoch nicht zwangsläufig auf dem Vorhandensein von Vorurteilen. Sie kann ebenso durch andere Motive, Normen oder Gruppenzwänge entstehen, die für den Beobachtenden nicht direkt erkennbar sind (Güttler, 1996).
Für Mitglieder der jeweiligen Minoritätsgruppe führt Diskriminierung dazu, dass die Grenzen zwischen der Ingroup und der Outgroup als undurchlässig wahrgenommen werden (engl. Faultlines). Die Identifikation mit der eigenen Ingroup nimmt zu (Branscombe et al., 1999) und die wahrgenommene Distanz zur Outgroup (zum Beispiel Gastgesellschaft) wächst (Piontkowski et al., 2000). Dies gilt vor allem für junge Migrierende (Berry et al., 2006; Berry & Sabatier, 2010).
Das tatsächliche Ausmaß sozialer Diskriminierung in einem bestimmten Kontext ist sehr schwierig zu erfassen, da die Art und Weise, in der sich Vorurteile im Verhalten manifestiert, stark variiert. Subtile Handlungen, beispielsweise jemanden zu ignorieren oder Hilfeleistungen zu verweigern, gelten genauso als Diskriminierung, wie explizite, verbale Äußerungen.
Physische Gewalt wird als die extremste und problematischste Äußerung sozialer Diskriminierung betrachtet. Die Forschung konnte jedoch zeigen, dass der größte Teil tatsächlich stattfindender sozialer Diskriminierung nicht von Angesicht zu Angesicht ausgetragen wird. Vielmehr wird Benachteiligung indirekt und im Verborgenen ausgelebt und aufrechterhalten (Allport, 1971; Güttler, 1996).
Hintergrundinformationen
Die Gründe für die Entstehung von sozialer Diskriminierung lassen sich laut Frey und Gaska (1993; Frey et al., 1993; Bierhoff & Frey, 2006) anhand von vier Theorien zusammenfassen:
Die Theorie der relativen Deprivation (Runicman, 1966): Deprivation bedeutet Entbehrung oder Entzug. Die Theorie unterscheidet zwischen der individuellen Deprivation, der Empfindung individueller Benachteiligung durch eine Person oder Gruppe und der kollektiven Deprivation, der gruppenbezogenen Diskriminierung und damit zusammenhängende Benachteiligungen. Die individuelle Deprivation geht oft mit psychischen und psychosomatischen Problemen einher (Runicman, 1966).
Die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts (Campbell, 1965): Laut Campbell (1965) sind „Vorurteile das Ergebnis eines Wettbewerbs zwischen unterschiedlichen Gruppen um seltene, knappe Ressourcen […], wobei die Ziele der verschiedenen Gruppen inkompatibel sind“ (Allport, 1971). Beispiele sind das Verhältnis zwischen Migrierenden und Einheimischen sowie zwischen Männern und Frauen in der Arbeitswelt, in der naturgemäß eine begrenzte Zahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung steht (Bierhoff & Frey, 2006).
Die Theorie der sozialen Identität (Tajfel & Turner, 1986): Diese Theorie beschreibt, dass sich die soziale Identität einer jeden Person auf drei Basisprinzipien zurückführen lässt. Das erste Prinzip beruft sich darauf, dass Menschen nach einem positiven Selbstkonzept streben und es dauerhaft aufrechterhalten wollen. Das zweite Prinzip geht genauer auf das Selbstkonzept ein und teilt es nochmals in zwei Aspekte auf: Die persönliche Identität (zum Beispiel individuelle Merkmale, Fähigkeiten) und die soziale Identität (Eigenschaften der zugehörigen Gruppe). Das dritte Prinzip beschäftigt sich mit der Steigerung des eigenen Selbstwertes, mit dem Ziel, ein positives Selbstkonzept zu erlangen. Dies gelingt, indem die eigene Gruppe aufgewertet und eine fremde Gruppe abgewertet wird. Die Ingroup wird generell als homogen wahrgenommen und anhand ihres besten Mitglieds gemessen. Die Outgroup hingegen wird auf Basis ihres schlechtesten Mitglieds bewertet. Diese unterschiedlichen Maßstäbe verfolgen den Zweck, den Selbstwert, die Anerkennung und den Zusammenhalt in der Ingroup zu festigen, gemeinsame gruppenspezifische Ziele und Meinungen zu bilden und diese zu stärken. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass eine Übereinstimmung der sozialen Identitäten zwischen Ingroup und Outgroup zu mehr Unterstützung von Migrierenden bei ihrer Integration führt (Kunst et al., 2015).
Die Theorie der sozialen Dominanzorientierung (Sidanius & Pratto, 1999): Diese Theorie nimmt an, dass in jeder Gesellschaft durch bestimmte Ideologien soziale Hierarchien aufrechterhalten werden. Diese Ideologien werden allerdings unterschiedlich stark von den Mitgliedern der Gesellschaft vertreten. Eine starke Dominanzorientierung eines Individuums geht demnach mit einem Bestreben einher, die bestehenden gesellschaftlichen Hierarchien aufrecht zu halten. Daraus folgt meist das Ausleben und Zeigen der eigenen Dominanz gegenüber einer anderen Gruppe sowie die Bereitschaft, diese Gruppe zu diskriminieren. Des Weiteren wird der Zusammenhalt mit der dominanzausübenden Gruppe mit Prestige in Verbindung gesetzt, was in manchen Fällen zur Ablehnung der eigenen, weniger prestigeträchtigen Gruppe führen kann. Ein besonderes Charakteristikum der sozialen Dominanzorientierung ist das Erfinden, beziehungsweise Replizieren sogenannter legitimierender Mythen, die bestehende Dominanz- und Machtverhältnisse rechtfertigen. Ein typisches Beispiel ist der Mythos: „Einer muss sagen, wo es langgeht. Das haben schon unsere Vorfahren erkannt. Als sie Mammuts gejagt haben, musste auch einer sagen wo es langgeht, deshalb waren sie so erfolgreich“ (wurde einem Autor auf die Frage erzählt, warum Unternehmen Führungskräfte brauchen).
Es ist wichtig zu betonen, dass nicht eine Theorie allein die Bereitschaft zu diskriminierendem Verhalten erklären kann. Vielmehr spielen, wie bei vielen anderen Verhaltensweisen auch, verschiedene inter- und intrapersonelle Faktoren eine Rolle.
3 Akkulturationsforschung
Unter Akkulturation wird der Prozess der Begegnung und gegenseitigen Beeinflussung von Gruppen und Individuen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen verstanden (Bierbauer, 1996; Redfield et al., 1936; nach Jaeger, 2009). Zu einer Kultur zählen dabei Aspekte wie Werte, Symbole, Verhalten, Prinzipien sowie die Religion, die ihrerseits eine starke Gruppenzugehörigkeit mit sich bringen kann (Gattino et al., 2016; Verkuyten & Yildiz, 2007).
Es wird zwischen Prozessen auf individueller Ebene und Prozessen auf Kultur- oder Gruppenebene differenziert (Graves, 1967), wobei sich im letzteren Fall die gemeinsame Gruppenkultur aufgrund des Kontakts zu einer anderen Kultur verändert (Berry & Sam, 1997). Individuelle Akkulturationsprozesse können nochmals in psychische und soziokulturelle Prozesse unterteilt werden (Searle & Ward, 1990; vgl. Jaeger, 2009).
Psychische Akkulturationsprozesse betreffen die persönliche und kulturelle Identität, die psychische Gesundheit und die allgemeine Lebenszufriedenheit (Jaeger, 2009). Um diese Prozesse besser zu verstehen, können Stress- und Coping-Modelle herangezogen werden (Searle & Ward, 1990), da Akkulturationsprozesse für Migrierende mit Stress verbunden sein können. Kontakt mit Mitgliedern der Gastkultur kann Individuen dabei helfen mit den neuen Gegebenheiten klarzukommen, sofern eine ähnliche oder gar die gleiche soziale Identität miteinander geteilt wird (beispielsweise die Identität der Fußballguckenden oder Biertrinkenden). Durch diese Gemeinsamkeit wird tendenziell mehr soziale Unterstützung vonseiten der Gastkultur angeboten, was als soziale Ressource bei der Bewältigung von belastenden Situationen helfen kann (Ketturat et al., 2016). Außerdem steht die erfolgreiche, reibungslose und schnelle Anpassung von Migrierenden im Zusammenhang mit einer ausgeprägten interkulturellen Sensitivität (Lefringhausen & Marshall, 2016). Ein stressarmer Anpassungsprozess ist erstrebenswert, da eine Anpassung an den neuen kulturellen Kontext beispielsweise mit weniger Hürden im Alltag und einer besseren Arbeitsleistung verbunden ist (Phinney & Ong, 2007).
Während frühere Arbeiten zu psychischen Akkulturationsprozessen (zum Beispiel Gordon, 1964) eine einzelne Dimension, nämlich die Anpassung der Minderheitenkultur an die Mehrheitskultur, annahmen (Jaeger, 2009), vermuten neuere Ansätze (zum Beispiel Berry, 1990; Birman, 1994; LaFromboise et al., 1993; Oetting & Beauvais, 1991) einen zweidimensionalen Akkulturationsprozess.
Dieser Prozess ergibt sich durch die Akkulturation an die eigene Herkunfts- oder Minderheitenkultur sowie die Akkulturation an die Mehrheitskultur als zwei relativ unabhängige Dimensionen. Laut diesen zweidimensionalen Theorien ist es möglich, sich an eine, beide oder aber an keine der beiden Kulturen anzupassen (nach Jaeger, 2009).
Für den Akkulturationsprozess von Minoritäten ist es förderlich, sich mit der eigenen Herkunftskultur zu identifizieren, während gleichzeitig am Leben der Majorität teilgenommen wird. Dies eröffnet den Individuen eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten und kulturellen Ressourcen sowie den Zugang zu wertvoller sozialer Unterstützung durch die Mitglieder der Majorität (Jaeger, 2009). Der sogenannte Bikulturalismus wird demnach als der adaptivste Akkulturationsstil gesehen (vgl. Horenczyk & Ben-Shalom, 2001; Birman et al., 2002).
Das bekannteste beziehungsweise in der Forschung am häufigsten verwendete zweidimensionale Akkulturationsmodell ist das Modell von Berry (1990). Es betrachtet vordergründig die individuelle Einstellung zu Akkulturation aus den oben genannten Perspektiven, die definiert werden als: Cultural Maintenance, also die Beibehaltung der eigenen kulturellen Identität mit typischen Charakteristika und Contact and Participation, also der Kontakt zu der dominanten (Mehrheits-) Gesellschaft.
Hieraus lassen sich vier Akkulturationsstrategien ableiten:
-
Integration,
-
Assimilation,
-
Separation und
-
Marginalisierung
Assimilation (Anpassung an die Mehrheitskultur) und Separation (Aufrechterhaltung der Herkunftskultur, Vermeidung von Kontakt) führen zu einer sogenannten einseitigen Anpassung an die Herkunfts- oder Mehrheitskultur. Die Marginalisierung beschreibt die Abspaltung von der eigenen Herkunftskultur sowie die Isolierung von der Mehrheitskultur. Zu guter Letzt wird als Integration die Aufrechterhaltung der Herkunftskultur bei gleichzeitigem Einbringen in die Mehrheitskultur definiert.
Separation und Marginalisierung auf Seiten der Minoritätengruppen treten vor allem dann auf, wenn Migrierende Diskriminierung vonseiten der Mehrheitskultur erfahren haben (Berry & Sabatier, 2010). Zudem geht Marginalisierung, die allerdings eher selten vorkommt, mit einem Identitätsverlust und erhöhtem Akkulturationsstress, Verwirrung, Angst und Entfremdung einher (Berry et al., 1989). Die Assimilation hingegen hängt positiv mit Stress, niedrigem Selbstwertgefühl und Leistungsstress zusammen (Birman, 1994). Die Integration wird nicht nur am ehesten von Migrierenden bevorzugt und angestrebt (Berry & Sam, 1997; Ryabichenko & Lebedeva, 2017), sie stellt zugleich die adaptivste Strategie mit dem geringsten Akkulturationsstress dar (Berry et al., 1987; Berry & Sam, 1997). Um sich tatsächlich integrieren zu können, sind Migrierende jedoch von der Offenheit und Unterstützung der Mitglieder und Strukturen der Mehrheitsgesellschaft abhängig (Kunst et al., 2015; Schotte et al., 2018).
Akkulturationsstrategien werden nach Berry und Sam (1997) als universalistische Prozesse aufgefasst, die sich, unabhängig von der Gruppe, der Herkunftskultur und der individuellen Aufenthaltsmotivation, vergleichbar äußern. Dadurch ergeben sich drei Arten von Variabilität, die bei der Betrachtung von Akkulturationsstrategien beachtet werden sollten.
Die intrapersonelle Variabilität in Abhängigkeit vom jeweiligen Lebenskontext, also ob die Person sich im öffentlichen oder im privaten Kontext befindet.
Die Variabilität der Akkulturationsstrategie in Abhängigkeit der gesellschaftlichen und politischen Begebenheiten.
Die Variabilität der Akkulturationsstrategie in einem andauernden Prozess, in dem sehr wahrscheinlich mehrere Strategien ausprobiert werden. Eine gültige Reihenfolge oder Hierarchie der Strategien, oder ein bestimmtes Lebensalter, in dem einzelne Strategien eher auftreten, wurden jedoch nicht gefunden (Berry & Sam, 1997, nach Jaeger, 2009).
Ein weiteres bekanntes zweidimensionales Modell stellt das von Birman (1994) dar. Angelehnt an die Differenzierung von Identitätsmodellen (Fokus auf Erfahrung der Migrierenden) und Bikulturalismus-Modellen (Fokus auf Verhalten der Migrierenden) unterscheidet es die Identitätsebene und die Verhaltensebene des Akkulturationsprozesses.
Auf beiden Ebenen werden der Umgang mit der Herkunftskultur und der Umgang mit der Mehrheitskultur als voneinander unabhängige Prozesse betrachtet. Wie auch bei Berrys Modell lassen sich für die Ebenen Identität und Verhalten jeweils vier Stile bilden: Bikulturalismus (entspricht Integration nach Berry), Assimilation, Separation und Marginalisierung.
Später kam die dritte Dimension Sprachkompetenz hinzu, die dem gleichen Muster der beiden bereits genannten Ebenen folgt (Kompetenz in der Herkunftssprache und Kompetenz in der Sprache der Mehrheitskultur) (Birman et al., 2002).
Schlüsselkontexte, in denen Integration strukturell stattfinden kann und sollte, sind das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt. In der heutigen deutschen Gesellschaft bestehen in beiden Kontexten jedoch noch gravierende strukturelle Defizite (Genkova & Riecken, 2020). Um für ein Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, müssen Personen, insbesondere Frauen, mit Migrationshintergrund mehr Bewerbungen verfassen als Personen ohne Migrationshintergrund (OECD, 2015). Arabische Frauen werden hingegen weniger stark auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert als arabische Männer (Arai et al., 2016).
Einen weiteren interessanten Befund stellt das integration paradox dar. Es beschreibt die negative Relation zwischen Bildung und psychologischer Integration, genauer gesagt, distanzieren sich höher gebildete Migrierende eher von der Mehrheitsgesellschaft. De Vroom und Verkuyten (2015) erklären dies mit der Theorie der steigenden Erwartung. Mit höherer Bildung steigen demnach die Erwartungen an Personen und Kontexte. Höher gebildete Personen besitzen mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine größere Sensitivität für Diskriminierung in der Gesellschaft (Fong et al., 2016). Um die Potenziale und Talente von Migrierenden nicht fälschlicherweise zu verdecken (zum Beispiel durch sprachspezifische Wissenstests; Uslucan & Brinkmann, 2013), sondern ihnen im Integrationsprozess gerecht zu werden, muss sich das deutsche Bildungssystem an Diversity Ansätzen orientieren und sie in ihre Prozesse aufnehmen. Neben dem Einfluss, den die Mehrheitsgesellschaft durch ihr Verhalten auf die Integration von Migrierenden haben kann (Berry, 2003), können weitere Faktoren auf den Integrationsprozess wirken: Bildung, Gendernormen, Familiendynamiken, mediale Präsenz des Migrationsthemas, politische Ausrichtung sowie wirtschaftliche und soziale Zufriedenheit (Fong et al., 2016). Des Weiteren stellen das Haushaltseinkommen, die prozentual verbrachte Lebenszeit in der „Gastkultur“ und das Sprachlevel Prädiktoren für Akkulturationsstrategien dar (Needham et al., 2017).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Integration von Migrierenden die erstrebenswerteste Akkulturationsstrategie repräsentiert. Gefühlte Bedrohungen durch die Mehrheitsgesellschaft werden reduziert und das Selbstkonzept wird gestärkt (Markus & Kitayama, 1991; Ward et al., 2001; Ryabichenko & Lebedeva, 2017). Die Aufenthaltsdauer in der Zielkultur und die Motivation der Migrierenden (Huber & Genkova, 2009; Farcas & Gonçalves, 2017) sowie die sozialen Kontexte und das Vorhandensein von Diversity (Beliefs) (Homan et al., 2007) sind ausschlaggebende Faktoren für den erfolgreichen Prozess der Integration. Darüber hinaus spielt die Zusammenstellung der Gesellschaft (multi- vs. monokulturell) eine Rolle.
Um unzureichender Anpassung und den damit verbundenen negativen Konsequenzen (unter anderem Stress, Kulturschock) entgegenzuwirken, ist darüber hinaus die Förderung der interkulturellen Kompetenz von zentraler Bedeutung.
4 Kulturelles Lernen und Interkulturelle Kompetenz
Um Anpassungsschwierigkeiten in Bezug auf kurz- und langfristige Migration zu analysieren und aufzulösen, werden in der Forschung Theorien des kulturellen Lernens und der interkulturellen Kompetenz herangezogen. Als Basis für diese Ansätze dienen Theorien aus der Sozialpsychologie, beispielsweise das klassische Modelllernen und das soziale Lernen (Bandura, 1991; Schein, 2010).
Kultur wird aus der Perspektive der Interkulturellen Psychologie als ein universelles psychologisches Orientierungssystem verstanden, das für eine Gesellschaft, Gruppe und Organisation typisch und sehr spezifisch ist. Sie beinhaltet Normen für Zugehörigkeiten, Werte, Annahmen und Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen und kann sich dabei in einer Bandbreite von Symbolen manifestieren. Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen sind ausschließlich im Kontext der jeweiligen Kultur beziehungsweise durch die jeweilige „kulturelle Brille“ zu verstehen (Thomas, 2003).
Kultur wird im Zuge der Enkulturation durch Verstärkungs-, Vorbild- und soziales Lernen vermittelt und wird mit der Zeit als persönliches Orientierungssystem internalisiert. Das Ziel des Enkulturationsprozesses ist, dass sich das Individuum in einer konfliktfreien und produktiven Art und Weise in der eigenen Gemeinschaft bewegen kann. Dadurch werden Missverständnisse minimiert und können, falls sie doch auftreten, durch Metakommunikation schnell aufgelöst werden (Thomas, 2003). Kultur als internalisiertes Orientierungssystem kann allerdings zu Schwierigkeiten auf interkultureller Ebene führen (Thomas, 2004).
Findet sich ein Individuum in einem neuen (anderen) kulturellen Kontext wieder, kann es dazu kommen, dass die eigenen Denkmuster und Verhaltensweisen als inadäquat bewertet werden. Die erlernten und erlebten positiven und negativen Konsequenzen, die in der Heimatkultur auf ein Verhalten folgen, könnten in einer anderen Kultur auf diese Weise nicht mehr zutreffen (Armstrong et al., 2010; Kühlmann, 1995). Genauer gesagt: Das eigene kulturelle System versagt. Ursprünglich angemessene Verhaltensweisen können sogar als unangemessen aufgefasst werden. Ziel der kulturellen Anpassung, aus Perspektive eines lerntheoretischen Ansatzes, ist daher das Erlernen kulturspezifischer Kompetenzen (Ward et al., 2001).
In den letzten Jahrzehnten konnte die Forschung zu Kulturdimensionen (Hall & Hall, 1990; Hofstede, 2011; Hampden-Tuner & Trompenaars, 2006) Aufschluss darüber geben, welche Dimensionen die Aneignung kulturspezifischer Kompetenzen fördern.
Bekannte Kulturdimensionen sind:
-
Individualismus/Kollektivismus,
-
Machtdistanz,
-
Unsicherheitsvermeidung,
-
Maskulinität/Femininität,
-
Lang-/Kurzzeitorientierung,
-
Genuss/Zurückhaltung,
-
Zeitorientierung (monochrom versus polychrom),
-
Raumorientierung (Sach- versus Beziehungsebene),
-
Kontextorientierung (Low- versus High-Kontext),
-
Informationsgeschwindigkeit (informell versus formell).
In der interkulturellen Kommunikation zeigen sich Konventionen und Verhaltensregeln meist am deutlichsten (Ward et al., 2001). Kommunikationsregeln können ungewollt und unbewusst gebrochen werden, was zur Folge hat, dass Individuen aus einer fremden Kultur als inkompetent oder „asozial“ wahrgenommen werden können. Selbst bei Verwendung derselben oder ähnlichen Sprache können unterschiedliche Kommunikationscodes, basierend auf kulturellen Unterschieden, auftreten (Genkova & Ringeisen, 2017).
Es konnte gezeigt werden, dass Kommunikationsprobleme positiv mit der Differenz zwischen Kulturen zusammenhängen. Je unterschiedlicher die Orientierungsysteme sind, die das interpersonale Verhalten steuern, desto problemanfälliger wird die Kommunikation. Die potenzielle Folge: Personen, die in ihrer Kultur als überaus sozialfähig gelten, werden in einer anderen Kultur als unangepasst und inkompetent wahrgenommen, was wiederum zu hoher Frustration führen kann (Ward et al., 2001).
Unerwartete Reaktionen auf das eigene Verhalten und unbeabsichtigtes, inadäquates Verhalten sind nach dem lerntheoretischen Ansatz ein Grund für den sogenannten Kulturschock. Einem Kulturschock und den damit verbundenen Hürden kann dementsprechend entgegengewirkt werden, indem kulturspezifische soziale Kompetenzen sowie Verhaltensregeln in einer Zielkultur erlernt werden. Auf diese Weise kann sich das Individuum in dem neuen kulturellen Kontext adäquat bewegen und in Situationen sowie Interaktionen kompetent agieren (Black & Mendenhall, 1991; Ward & Kennedy, 1992).
Um die Prädiktoren von Stress aufgrund unzureichender kultureller Anpassung besser zu verstehen, befragten Berger et al. (2019) Erasmus-Studierende zu psychologischem Wohlbefinden, kultureller Kompetenz und wahrgenommener sozialer Unterstützung. Die Ergebnisse zeigen, dass Studierende, die auf stärker ausgeprägte kulturelle und sprachliche Kompetenzen zurückgreifen konnten, von einem besseren Wohlbefinden berichteten, mehr soziale Unterstützung durch die Outgroup erhielten, mehr interkulturellen Kontakt hatten und weniger psychophysische Symptome erlebten. Im Allgemeinen zeigten diese Studierenden eine bessere Anpassung an ihr Gastland.
Die Aneignung von kulturspezifischen und -angemessenen Verhaltensweisen ist jedoch kein geradliniger Prozess. Vielmehr ist sie abhängig von Situationsvariablen (zum Beispiel Ausmaß der kulturellen Unterschiede, Aufenthaltsdauer im Entsendungsland, vorherige Auslandserfahrungen, Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt) und individuellen Variablen (zum Beispiel Selbstwirksamkeitserwartungen, Beziehungsfähigkeiten, Wahrnehmung der anderen Kultur) und weist zudem individuelle Abläufe auf (Black & Mendenhall, 1991).
Der Anpassungsprozess kann im Vorfeld eines Auslandsaufenthaltes durch ein interkulturelles Training gefördert werden (Black & Mendenhall, 1991; Kühlmann, 1995; Thomas et al., 2003). Diese interkulturellen Trainings sollen den zukünftig Migrierenden Kenntnisse über die neue Kultur vermitteln und sie darin schulen, wie sie eine gelungene Anpassung schneller erreichen können (Deardorff, 2006). Für den Anpassungsprozess von Migrierenden sind relevante Fähigkeiten beispielsweise interkulturelle Empathie, soziale Kompetenz und Vorurteilsfreiheit, die ihrerseits interkulturelle Toleranz sowie soziale Identität vorhersagen (Geeraert & Demes, 2012). Auf längerfristige Sicht bringt interkulturelles Lernen positive Konsequenzen, wie Veränderungen in der Persönlichkeit (zum Beispiel Horizonterweiterung, Selbstkonzeptänderung und -erweiterung) mit sich (Thomas et al., 2005).
Nicht nur im privaten Kontext, sondern auch im Berufsleben werden interkulturelle Kontakte immer präsenter, weshalb vor allem mit Blick auf erfolgreiche (Zusammen-) Arbeit, interkulturelle Trainings zunehmend relevant sind und eine steigende Nachfrage haben. Interessant zu erwähnen ist, dass wahrgenommene ethnische Diskriminierung sowie ethnische Ungleichheit die Bereitschaft zur Teilnahme (operationalisiert durch Motivation zum Lernen, Selbstwirksamkeit, Absicht zur Nutzung und wahrgenommener Nutzen) an solchen Trainings beeinflussen können (Chung et al., 2017).
Interkulturelle Trainings lassen sich einerseits anhand der verwendeten Methoden klassifizieren, andererseits daran, ob sie kulturspezifische oder kulturübergreifende Inhalte vermitteln. Darüber hinaus unterscheiden sich Trainings basierend auf ihrem didaktischen Ansatz (informations- versus erfahrungsorientiert; Thomas & Simon, 2007). Darauf aufbauend unterscheiden Gudykunst und Hammer (1983) vier Typen von interkulturellen Trainings:
Das informationsorientierte kulturspezifische Training vermittelt Wissen über Kulturstandards, also individuelle Fakten zu unterschiedlichen Kulturen und wird vor allem als spezifische Vorbereitung bei Auslandsaufenthalten eingesetzt (Beispielmethode: Culture Assimilator Ansatz).
Das erfahrungsorientierte kulturspezifische Training bezieht bei der Vermittlung von Kulturstandards erfahrungsbasierte Maßnahmen, wie Simulationsverfahren, mit ein.
Das erfahrungsorientierte kulturallgemeine Training hat das Ziel, universelle interkulturelle Kompetenzen durch konkrete Erfahrungen zu schulen, beispielsweise durch multikulturelle Gesprächsgruppen, in denen Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kulturen erfahrbar gemacht werden.
Das informationsorientierte kulturallgemeine Training konzentriert sich vornehmlich auf die kognitive Vermittlung von kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Allgemeinen (Thomas & Simon, 2007).
In der Praxis werden meist didaktische Methoden eingesetzt, die sowohl auf informations- als auch emotionsbasiertes Lernen abzielen. Beispiele hierfür sind Brainstorming, selbstreflexive Verfahren, Rollenspiele oder Konfliktlösungsübungen (Grosch et al., 2000). Das Mindestziel der interkulturellen Trainings sollte sein, den Teilnehmenden ein Basiswissen über verschiedene Kulturen mitzugeben. Dadurch wird es den Individuen ermöglicht, ihr eigenes Verhalten im Kontext der fremden Kultur zu reflektieren und einzuordnen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen zu erkennen. Diese Fähigkeiten sollen sie in zukünftigen Situationen dazu befähigen, direkt sensibler und angepasster zu agieren, eigenes Fehlverhalten schneller zu erkennen und zu ändern sowie mit unerwarteten Reaktionen besser umzugehen (Stellamanns, 2007).
Die bis hierher diskutierten Ansätze verdeutlichen, dass Migration sowie interkulturelle Interaktionen potenziell Stress auslösen können. Im nächsten Abschnitt wird daher auf einen weiteren psychologischen Ansatz, den stresstheoretischen Ansatz, eingegangen und seine Relevanz für die Migration beleuchtet.
5 Stresstheoretischer Ansatz und Kulturelle Anpassung
Verständigungsprobleme und damit einhergehende unerwünschte Erlebnisse sind bei interkulturellen Kontakten quasi vorprogrammiert. Solche unerwünschten Konsequenzen werden mit den Oberbegriffen Kulturschock oder Anpassungsschwierigkeiten zusammengefasst (Oberg, 1960). Ein Kulturschock kann als unterschiedlich stark empfunden werden, wobei gravierende Formen zum vorzeitigen Beenden des Aufenthaltes führen können (Weaver, 1986). Um diesem Schock entgegenzuwirken beziehungsweise ihn zu überwinden, sollten sich Individuen der neuen Kultur anpassen und dadurch einen Erfolg auf der interkulturellen Ebene erleben (Weaver, 1986, Huber & Genkova, 2009).
Die Migration (ob freiwillig oder unfreiwillig) in ein anderes Land kann mit sozialen Veränderungen (zum Beispiel Beziehungen zu Familie und Freunde), einem Wohnortswechsel, einer Veränderung des Beschäftigungsverhältnisses oder der finanziellen Situation und gesundheitlichen Konsequenzen einhergehen, da Migrierende, während der Anpassungsphase an eine neue Kultur, meist großen Hürden ausgesetzt sind: Unter anderem einer neuen Sprache, unbekannten Kommunikationscodes, einem neuen physischen Umfeld. Aus diesem Grund wird Migration als ein tief greifendes Stressereignis eingestuft. Psychische Folgen können Angst und Unsicherheit (Ward et al., 2001; Deardorff, 2006) sowie Schlafstörungen oder Depressionen sein (Kirkaldy et al., 2005). Bezüglich der Gesundheit von Migrierenden scheinen soziale Determinanten (beispielsweise der sozioökonomische Status) eine Rolle zu spielen (Razum & Saß, 2015). Allerdings ist der Hauptfaktor für das erhöhte Risiko, depressive Symptome zu erleben, die Adaptation an die neue Kultur und die damit einhergehenden Stressfaktoren (Suinn, 2010).
Einflussreiche Modelle, die Erklärungsansätze für die Adaptation von Migrierenden liefern und den Begriff des „Kulturschocks“ mitgeprägt haben, sind die von Sverre Lysgaard (1955) und Kalervo Oberg (1960). Trotz umfassender Kritik finden die Modelle bis heute Anwendung in Theorie und Forschung (zum Beispiel Barmeyer et al., 2010; Ferraro, 2002).
Lysgaard (1955) nahm basierend auf seinen Forschungsergebnissen an, dass sich die Adaptation im Verhältnis zur Aufenthaltsdauer im Ausland U-förmig beschreiben lässt. Studierende, die sich zwischen 6–18 Monate im Ausland aufhielten, fühlten sich schlechter angepasst als Studierende, deren Auslandsaufenthalt nur bis zu sechs Monaten oder aber mehr als 18 Monate andauerte.
Lysgaard (1955) identifizierte seinerseits bereits eine „crisis“ (dt. Krise), die dem späteren Konstrukt des Kulturschocks entsprach (Oberg, 1960). Sowohl Lysgaard (1955) als auch Oberg (1960) nahmen an, dass sich erstens die Anpassung an eine Kultur mit der Zeit, die man darin zugebracht hat, ändert und, dass sich zweitens diese Anpassung in dem jeweiligen psychologischen Wohlbefinden widerspiegelt.
Kulturelle Anpassung
Unter kultureller Anpassung werden die individuellen Komponenten des komplexen Akkulturationsprozesses zusammengefasst, die durchlaufen werden, bis sich das Individuum in dem neuen kulturellen Kontext wohlfühlt und sich in ihm adäquat verhalten kann. Die kulturelle Anpassung wird als soziokulturelle und psychologische Anpassung aufgefasst, wobei sich die letztere in psychologischem Wohlbefinden mit unterschiedlichen Komponenten im Kontext der neuen Umgebung äußert (Oberg, 1960; Black, 1988; Black et al., 1991). Zudem wird die kulturelle Anpassung heutzutage als mehrdimensionales Konstrukt definiert, dessen Subdimensionen unabhängig voneinander mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können. Bei der Betrachtung von Anpassungsprozessen sollten daher verschiedene Ursachen, Einflussfaktoren, Formen und Konsequenzen berücksichtigt werden (Holtbrügge, 2008).
In einer späteren Arbeit (Gullahorn & Gullahorn, 1963) wurde der U-förmige Verlauf durch die Aufnahme der anstehenden Wiedereingliederung im Heimatland zu einer W-Kurve umgeformt. Neben dem „ersten“ Kulturschock wird der reverse culture shock beschrieben, auch re-entry-shock. Während der Abwesenheit können im Heimatland einige Veränderungen auftreten und die neuerlangte multikulturelle Perspektive kann die Rückkehr erschweren. Daher wird der re-entry-shock als zweiter psychischer Tiefpunkt mit aufgenommen und verwandelt die U-Kurve in eine W-Kurve (Ferraro, 2002).
Oberg (1960) nimmt an, dass sich vier sequentielle Phasen des Anpassungsprozesses unterscheiden lassen, die oft als analog zu Abschnitten des W-Kurven Modells beschrieben werden. Er beschreibt eine sogenannte Honeymoon Stage kurz nach Eintreffen in der fremden Kultur, die von Faszination, neuen Eindrücken und Erlebnissen sowie von freundlichen aber kurzlebigen Beziehungen in der fremden Kultur geprägt ist.
Die nächste Phase, crisis oder auch „Kulturschock“, wird durch das Erleben des Alltags und den damit einhergehenden Schwierigkeiten und Anforderungen definiert. Mit ihr einher gehen Gefühle der Schwäche, Angst sowie Verärgerung, was dazu führt, dass vor allem der Kontakt zu den eigenen Landsleuten gesucht wird. Den Einheimischen begegnet man eher feindselig, kritisch und mit Stereotypen. Oberg (1960) vermutet, dass die Ursache der Krise das Fehlen bekannter Symbole und Zeichen in sozialen Interaktionen ist, wodurch diese einen mehrdeutigen Charakter bekommen. Worte, Gesten, Gesichtsausdrücke, Gewohnheiten oder Normen, deren Bedeutungen das Individuum verinnerlicht hat, sind in einer Interaktion in dieser Art nicht mehr zu finden. Die Kommunikationssicherheit des Individuums nimmt somit tendenziell ab. Hinzu kommen unbekannte Bedingungen der Umgebung und Umwelt, die durch Angst und Unsicherheit ebenfalls zu einem Kulturschock beitragen können (Oberg, 1960).
Als dritte Phase wird die recovery (dt. Erholung/Aufschwung) angenommen. Diese definiert sich durch eine offenere Haltung gegenüber den Einheimischen und ihrer Kultur, was sich durch die Aneignung von Sprachkenntnissen und dem Verständnis von alltäglichen Normen erklären lässt.
Die vierte und letzte Phase wird als adjustment, also Anpassung, beschrieben. Der Prozess der Anpassung an die fremde Kultur wird als abgeschlossen angenommen. Es besteht Akzeptanz gegenüber Bräuchen. Negative Gefühle, beispielsweise Angst, existieren in dieser Phase nicht mehr.
Kulturschock
Der Kulturschock kann sich auf unterschiedliche Weisen äußern. Auf physischer Ebene können Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit gezeigt werden. Auf der Ebene des Erlebens gehören Verärgerung, Misstrauen, Sorgen um den eigenen Gesundheitszustand, schnelle Wutausbrücke, Entwurzelung oder Selbstmitleid zu möglichen Symptomen. Auf der Verhaltensebene treten Leistungsdefizite, Kreativitätsabfall, Abkapselung gegenüber Einheimischen oder in extremen Fällen übermäßiger Alkoholkonsum auf.
Um den Kulturschock zu überwinden, so Oberg, hilft die Anpassung an die Gastkultur (Oberg, 1960). Eine Längsschnittstudie von Kealey (1989) konnte einen U- beziehungsweise W-förmigen Anpassungsverlauf jedoch bei nur 10 % der kürzlich Migrierten finden. Bei 35 % fand er eine linear zunehmende Zufriedenheit von Aufenthaltsanfang bis -ende. Eine weitere Studie (Torbjörn, 1982) fand stattdessen einen J-förmigen Verlauf (nach Hampden-Turner & Trompenaars, 2006). Kealey (1989) betont, dass die Anpassungsverläufe insgesamt sehr individuell sind (nach Hampden-Turner & Trompenaars, 2006). Aus diesem Grund sollten die interindividuellen Unterschiede von Eigenschaften und Einstellungen mit betrachtet werden, die die Abweichung des individuellen Akkulturationsverlaufes von einer theoretisch plausiblen W-Kurve erklären.
Im Laufe der Zeit wurden weitere Faktoren, die im Zusammenhang mit einem Kulturschock stehen, identifiziert: Überlastung aufgrund der Kumulation von Anpassungsanforderungen; Verlustgefühle durch die Trennung von gewohnten Verstärkern; Gefühle der Ablehnung durch Angehörige der Gastkultur; Verunsicherung hinsichtlich der eigenen Identität und Rolle; Überwältigung durch das Ausmaß an Andersartigkeit und Hilfslosigkeit aufgrund fehlender Bewältigungsmöglichkeiten (Hirai et al., 2015; Taft, 1977; Yakunina et al., 2013; Zimmermann & Neyer, 2013).
Die Ursprüngliche Annahme von Lysgaard (1955) und Oberg (1960), dass sich Anpassung im Wohlbefinden widerspiegelt, ist mittlerweile nicht mehr aktuell. Vielmehr hat die psychische Gesundheit der Migrierenden, beispielsweise durch Verhaltensstörungen, weitere Auswirkungen auf die Integration (Gavranidou et al., 2008; Bozorgmehr & Razum, 2015). Daher konzentriert sich die aktuelle Forschung zu Migration verstärkt auf die Stressforschung und auf stresstheoretische Ansätze kultureller Anpassung.
Diese Ansätze erkennen Auslandsaufenthalte als ein einschneidendes Ereignis an, wobei Alltagsärgernisse (daily hassels) sich genauso negativ auf das Empfinden von Stress auswirken wie tief greifende Stresserlebnisse. Letztere stellen meist einen einmaligen Stressor dar, auf den man mit dem Abruf von relevanten Ressourcen und der Initiierung von Stressbewältigung reagieren kann (Schnabel et al., 2015; Ward & Kennedy, 1992).
Dem Transaktionalen Stressmodell nach Lazarus (1966; Franken, 2015; Lazarus & Folkman, 1984; Ward et al., 2001; Ward & Kennedy, 1992) wird in der Stressforschung zu Migration eine hohe Relevanz zugeschrieben. Dieses Modell nimmt an, dass Stress subjektiv im Kontext der spezifischen Person-Umwelt-Beziehung definiert wird. Die Person und ihre Umwelt stehen dabei also in einer wechselseitigen Beziehung (Lazarus, 1998).
Psychologischer Stress wird entsprechend verstanden als „… a particular relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being“(Lazarus & Folkman, 1984, S. 19).
Laut dem Transaktionalen Stressmodell ist die subjektive Wahrnehmung eines Individuums ausschlaggebend, da das Individuum aus der persönlichen Perspektive heraus den erlebten Stress in einer Situation empfindet und bewertet (Lazarus & Folkman, 1984). Dem Stressmodell liegt somit ein kognitiver Prozess zugrunde, in dem die Bedeutung der potenziell bedrohlichen Umwelt für die eigene Person abgeschätzt und mit den eigenen Ressourcen, die bei der Bewältigung helfen, verglichen wird (Lazarus, 1998).
Das Konzept des akkulturativen Stresses (Berry, 1997; Torres & Rollock, 2007; Van der Zee et al, 2004) bezieht sich auf das Transaktionale Stressmodell. Akkulturativer Stress wird definiert als „a response by individuals to life events (that are rooted in intercultural contact), when they exceed the capacity of individuals to deal with them“ (Berry et al., 2002, S. 362). Wie auch der eng verwandte Kulturschock (Oberg, 1960), stellt akkulturativer Stress einen zentralen, herausfordernden Aspekt des Akkulturationsprozesses dar, der negative emotionale Zustände, wie Angst und Depression, mit sich bringen kann (Crockett et al., 2007; Hovey, 2000; Torres & Rollock, 2004). Franco et al. (2019) untersuchten in ihrer Studie den Zusammenhang zwischen akkulturativem Stress, subjektiver sozialer Unterstützung und den Erwartungen an die berufliche Karriere von internationalen Studierenden. Zum einen konnten sie zeigen, dass akkulturativer Stress negativ mit der subjektiven sozialen Unterstützung sowie mit den Erwartungen an die berufliche Karriere korrelierten. Zum anderen erwies sich die soziale Unterstützung als Mediator zwischen akkulturativem Stress und den eigenen Karriereerwartungen.
Trotz umfassender Forschung des Konstrukts der kulturellen Anpassung, fehlt eine eindeutige, umfassende Theorie darüber. Bestehende Ansätze behandeln oft nur einzelne Aspekte der kulturellen Anpassung, was die Komplexität des Forschungsgegenstandes auf wenige Faktoren reduziert (Bolten, 2007; Kühlmann, 1995; Mägdefrau & Genkova, 2014). Die Differenzierung in die Dimensionen der psychologischen und soziokulturellen Anpassung (Ward & Kennedy, 1992) hat allerdings viel Beachtung gefunden (Geeraert & Demes, 2012; Kizilhan, 2007).
Die psychologische Anpassung weist eine enge Verbindung zu den oben beschriebenen Stress- und Coping-Theorien auf und konzentriert sich vor allem auf die Zufriedenheit und das subjektive Wohlbefinden des Individuums. Der Stress in Verbindung mit Migration und Akkulturation erfordert individuelle Ressourcen und Bewältigungsstrategien. Mögliche Strategien lassen sich in vermeidungsorientiert (die Alternative wäre Abbruch des Auslandsaufenthalts beziehungsweise der Migration), problemorientiert (Versuch die Situation zu ändern) und emotionsorientiert (Anpassung) kategorisieren (Deardorff, 2006; Folkman & Moskowitz, 2004; Ward et al., 2001). Für die Migration stellt die affektive Strategie die erfolgversprechendste dar, da sie eine kulturelle Anpassung durch die Orientierung an der neuen Kultur ermöglicht.
Die soziokulturelle Anpassung lässt sich differenzieren in die Anpassung an die Lebensbedingungen im Entsendungsland (general adjustment), die soziale Interaktion mit Einheimischen (interaction adjustment) und die Arbeitsbedingungen im Ausland (work adjustment). Diese Dimensionen können wiederum als Unterdimensionen des Konstrukts „Soziokulturelle Anpassung“ angesehen werden (Black et al., 1991, Selmer, 2004).
Die psychologischen Ansätze (Identitätsansatz, kulturelles Lernen und stresstheoretischer Ansatz), die bis hierher erläutert wurden, dienen zur Erklärung von Anpassungsprozessen inklusive der jeweiligen Einflussfaktoren. Durch diese Ansätze können der Prozess und die Handlungsmöglichkeiten in einer interkulturellen Interaktion in eine affektive, kognitive und verhaltensbezogene Komponente aufgeteilt werden. Auf diese Weise wird kulturelle Anpassung durch verschiedene Merkmale operationalisiert und eine einheitliche, theoretische Grundlage für weitere Untersuchungen der kulturellen Anpassung und ihrer Ursachen, Prozesse und Konsequenzen wird geschaffen (Deardorff, 2006; Ward et al., 2001).
6 Einflussvariablen auf den Interkulturellen Erfolg
In dem folgenden Rahmenmodell von Berry (1997, 2003; Berry et al. 2006) werden zentrale Forschungsergebnisse des Akkulturationsprozesses und akkulturativen Stresses kombiniert. In dem Modell werden Einflussfaktoren und zentrale Prozesse miteinander verknüpft, die in diesem Kapitel bereits einzeln beschrieben wurden.
Eine Annahme des Modells ist, dass in kulturellen Kontexten unterschiedliche Normen gelten, weshalb das Individuum in seinem Auslandsaufenthalt anhand anderer Kriterien als im Heimatland beurteilt wird. Ein beispielhaftes Kriterium ist die Ausprägung der Extraversion, die im Mittel in der fremden Kultur anders ausgeprägt sein kann, als in der Heimatkultur. Demnach würde eine Person, aufgrund ihres gemessenen Extraversionslevels, innerhalb einer deutschen Stichprobe als durchschnittlich, im Vergleich mit einer italienischen Stichprobe jedoch als unterdurchschnittlich extravertiert eingestuft werden.
Übertragen auf den Leistungskontext bedeutet dies, dass dasselbe Ergebnis, in Abhängigkeit des jeweiligen (kulturellen) Durschnitts als gut oder schlecht eingestuft werden kann. Kategorisierungen anhand der geltenden Norm sind somit immer abhängig von den Werten der Mehrheitsgruppe und können zu unerwarteten, (schlechten) Bewertungen führen, verglichen mit den gewohnten Bewertungen aus der eigenen Kultur. In der kulturvergleichenden Psychologie wird dieses Phänomen als „Defizit-Orientierung“ beschrieben (Berry et al., 2012; Genkova, 2012; Segall et al., 1999).
Um das Konstrukt der Akkulturation bestmöglich zu verstehen, sollte der Anpassungsprozess aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet werden (Zick, 2010). Als beliebter ganzheitlicher Erklärungsansatz wird das Rahmenmodell von Berry (1997) herangezogen, da es die Akkulturation auf einer Makro- und Mikroebene veranschaulicht. Ein weiteres, jedoch etwas weniger komplexes Modell (Berry, 2003) konzentriert sich vor allem auf die soziokulturellen und psychologischen Adaptationen des Individuums.
Als weitere Modellalternative verifiziert Ward (1996) in seinem Rahmenmodell die Unterscheidung einer gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Ebene, die jeweils auf unterschiedliche Weise auf den Akkulturationsprozess wirken können. Er bezieht unter anderem Personeneigenschaften, Situationseigenschaften sowie Kontexte der Herkunftskultur und der Gastkultur mit ein. In seinem neueren ABC-Modell, welches sich vor allem auf den Kulturschock fokussiert, werden affektive, behaviorale und kognitive Faktoren integriert (Ward et al., 2001). Er beschreibt Akkulturation als eine Interaktion zwischen Akkulturationsorientierungen, Bedingungsfaktoren und Konsequenzen. Die Entwicklung und Akkulturationsorientierung sind von den Bedingungsfaktoren sowie den Eigenschaften des Individuums und denen der Herkunftskultur abhängig. Das Modell bezieht die in diesem Buch diskutierten, theoretischen Ansätze (Identitätsansatz, kulturelles Lernen und stresstheoretische Ansatz) ein (Ward et al., 2001; Zick, 2010).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die psychologische Akkulturationsforschung sich aus Bestandteilen einer Stressperspektive, eines Identitätsansatzes und eines Lernansatzes (Kulturelles Lernen) sowie Facetten aus der persönlichkeitsorientierten Psychologie und der Entwicklungspsychologie zusammensetzt (Zick, 2010).
Die erfolgreiche und konfliktfreie Anpassung von Individuen an Kulturen in interkulturellen Interaktionen hängt dabei von einer generalisierten Anpassungsorientierung und spezifischen, soziokulturellen Aspekten ab (Zick 2010). Beispielsweise ist die kulturelle Nähe zwischen Heimat- und Gastland auf der situationsbezogenen Ebene ein Prädiktor für erfolgreicheres Studium im Ausland. Als ausschlaggebende Faktoren für eine Migration konnten die kulturellen Dimensionen Individualismus, Unsicherheitsvermeidung und wahrgenommene Geschlechterrollen identifiziert werden (White & Buehler, 2018). Gleichzeitig sollten bei kulturell ähnlichen Ländern die existierenden Unterschiede nicht unterschätzt werden (Genkova & Ringeisen, 2017). Während interkulturelle Probleme während der Akkulturation in ein Land, das eine große kulturelle Distanz zum Heimatlang aufweist, fast erwartet werden, werden sie hinsichtlich Ländern mit geringer kultureller (und räumlicher) Distanz meist unterschätzt (beispielsweise aufgrund einer gemeinsamen oder ähnlichen Sprache), was ebenfalls zu Problemen führen kann (Genkova & Braun-Lüdicke, 2012; Huber & Genkova, 2009). Des Weiteren wurde gezeigt, dass die Kontaktqualität zu den Einheimischen für die kulturelle Anpassung, das Wohlbefinden und den Migrationserfolg eine große Rolle spielt. Kontaktquantität und oberflächliche Kontakte hingegen zeigten keine Auswirkungen auf die genannten Konstrukte (Genkova, 2012).
Bezogen auf die Einflussfaktoren auf individueller Ebene wurde deutlich, dass Vorstellungen, Erwartungen und landeskundliches Wissen irrelevant für den interkulturellen Erfolg sind. Dies kann damit erklärt werden, dass diese Faktoren im Nachhinein zumindest kognitiv angepasst werden können. Als ausschlaggebende Faktoren konnten hingegen Sprachkenntnisse und vorherige Auslandserfahrung identifiziert werden (Huber & Genkova, 2009). Damit geht die Erkenntnis einher, dass Auslandserfahrungen, vor allem im Studium und Berufskontext, gefördert werden sollten, um im nächsten Schritt den interkulturellen Erfolg zu sichern. Neben der kulturspezifischen Anpassung erwerben Individuen bei Auslandsaufenthalten auch kulturallgemeine Kompetenzen, die in der Heimatkultur sowie bei zukünftigen Auslandsaufenthalten hilfreich sind. Von angeeigneten Kompetenzen wie Problem- und Konfliktlösung kann ein Individuum auch nach dem Auslandsaufenthalt profitieren (Deardorff & Jones, 2012; Genkova, 2012, 2014). Generell hat die interkulturelle Kompetenz zwar Auswirkungen auf die soziokulturelle Anpassung, ist jedoch nicht mit der psychologischen Anpassung, also dem Wohlbefinden gleichzusetzen. Die soziokulturelle Anpassung kann allerdings die psychologische Anpassung an die Gastkultur fördern, trägt zu einem effizienteren Coping, einer höheren Leistung und einer geringeren Abbruchquote von Auslandsaufenthalten bei. Sowohl die soziokulturelle als auch die psychologische Anpassung sind daher Voraussetzung für den interkulturellen Erfolg.
7 Zusammenfassung
Migration ist ein hochaktuelles Thema in Gesellschaft, Politik und mittlerweile sogar in der Forschung. Aufgrund des weitreichenden gesellschaftlichen Diskurses zum Umgang mit Migrierenden und insbesondere Geflüchteten konzentriert sich die Forschung vermehrt auf die psychologischen Aspekte von Migration und Integration. Dabei wird deutlich, dass der Migrationsprozess ein komplexes Phänomen darstellt, das sich nicht anhand einer einzelnen Theorie erklären lässt. Vielmehr ermöglicht die Kombination aus dem Identitätsansatz, dem Ansatz des kulturellen Lernens und dem stresstheoretischen Ansatz eine ganzheitliche Betrachtung des Migrationsprozesses. Die Erkenntnis, dass Migration nicht nur eine individuelle Herausforderung darstellt, sondern ebenso von interpersonellen (zum Beispiel Einstellungen der Mehrheitskultur) und strukturellen Faktoren abhängt, ist ausschlaggebend für eine angemessene Unterstützung von Migration- und Integrationsprozessen. Das Ziel sollte es daher sein, Stressoren zu minimieren und anpassungsförderliche Strukturen, Kompetenzen und Prozesse zu fördern.
Literatur
Allport, G. W. (1971). Die Natur des Vorurteils. Kiepenheuer & Witsch.
Arai, M., Bursell, M., & Nekby, L. (2016). The reverse gender gap in ethnic discrimination: Employer stereotypes of men and women with arabic names. International Migration Review, 50(2), 385–412.
Armstrong, C., Flood, P. C., Guthrie, J. P., Liu, W., MacCurtain, S., & Mkamwa, T. (2010). The impact of diversity and equality management on firm performance: Beyond high performance work systems. Human Resource Management, 49(6), 977–998.
Aronson, E., Wilson, T., & Akert, R. (2008). Sozialpsychologie (6. Aufl.). Pearson Studium.
Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational behavior and human decision processes, 50, 248–287.
Barmeyer, C., Genkova, P., & Scheffer, J. (2010). Interkulturelle Kommunikation und Kulturwissenschaft: Grundbegriffe, Wissenschaftsdisziplinen, Kulturräume. Stutz.
Becker, J., Wagner, U., & Christ, O. (2007). Nationalismus und Patriotismus als Ursache von Fremdenfeindlichkeit [Nationalism and patriotism as cause of prejudice]. In W. Heitmeyer (Hrsg.), Deutsche Zustände. Folge, 5 [The German issues, series 5 Part 1] (S. 131–149). Suhrkamp.
Berger, R., Safdar, S., Spieß, E., Bekk, M., & Font, A. (2019). Acculturation of Erasmus students: Using the multidimensional individual difference acculturation model framework. International Journal of Psychology: Journal International De Psychologie, 54(6), 739–749.
Berry, J. W. (1990). Acculturation and adaptation: A general framework. In W. H. Holtzman & T. H. Bornemann (Hrsg.), Mental health of immigrants and refugees (S. 90–102). Hogg Foundation for Mental Health.
Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46, 5–34.
Berry, J. W. (2003). Conceptual approaches to understanding acculturation. In K. M. Chun, P. B. Organista, & G. Marin (Hrsg.), Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research (S. 17–38). American Psychological Association.
Berry, J. W., & Sabatier, C. (2010). Acculturation, discrimination, and adaptation among second generation immigrant youth in Montreal and Paris. International Journal of Intercultural Relations, 34, 191–207.
Berry, J. W., & Sam, D. L. (1997). Acculturation and adaptation. In J. W. Berry, M. H. Segall, & C. Kagitcibasi (Hrsg.), Handbook of cross-cultural psychology. Volume 3 Social behavior and applications (2. Aufl., S. 291–326). Allyn and Bacon.
Berry, J. W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. (1987). Comparative studies of acculturative stress. International Migration Review, 21, 491–511.
Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural societies. Applied Psychology, 38(2), 185–206.
Berry, L., Carbone, L., & Haeckel, S. (2002). Managing the total customer experience. MIT Sloan Management Review, 43, 85–88.
Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 55, 303–332.
Berry, J., Poortinga, Y., Breugelmans, S., Chasiotis, A., & Sam, D. (2012). Cross-cultural psychology. Research and applications. Cambridge University Press.
Bierbrauer, G. (1996). Sozialpsychologie. Kohlhammer.
Bierhoff, H.-W., & Frey, D. (2006). Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie. Hogrefe.
Birman, D. (1994). Acculturation and human diversity in a multicultural society. In E. J. Trickett, R. J. Watts, & D. Birman (Hrsg.), Human diversity. Perspectives on people in context (S. 261–284). Jossey-Bass.
Birman, D., Trickett, E. J., & Vinokurov, A. (2002). Acculturation of Soviet Jewish refugee adolescents: Predictors of adjustment across life domains. American Journal of Community Psychology, 30(5), 585–607.
Black, J. S. (1988). Work role transitions. A study of American expatriate managers in Japan. Journal of International Business Studies, 19, 277–294.
Black, S. J., & Mendenhall, M. (1991). The U-curve adjustment hypothesis revisited: A review and theoretical framework. Journal of International Business Studies, 22, 225–247.
Black, J. S., Mendenhall, M., & Oddou, G. (1991). Toward a comprehensive model of international adjustment: An integration of multiple theoretical perspectives. Acadamy of Management Review, 16, 291–317.
Bolten, J. (2007). Was heißt „Interkulturelle Kompetenz?“ Perspektiven für die internationale Personalentwicklung. In V. Künzer & J. Berninghausen (Hrsg.), Wirtschaft als interkulturelle Herausforderung (S. 21–42). IKO.
Bozorgmehr, K., & Razum, O. (2015). Effect of restricting access to health care on health expenditures among asylum-seekers and refugees: A quasi-experimental study in Germany, 1994–2013. PloS One, 10(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131483.
Branscombe, N. R., Schmitt, M. T., & Harvey, R. D. (1999). Perceiving pervasive discrimination among African-Americans: Implications for group identification and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 135–149.
Campbell, D. T. (1965). Ethnocentric and other altruistic motives. In D. Levine (Hrsg.), Nebraska symposium on motivation (13. Aufl., S. 283–311). University of Nebraska Press.
Chung, Y., Gully, S. M. Lovelace, K. J. (2017). Predicting readiness for diversity training – The influence of perceived ethnic discrimination and dyadic dissimilarity. Journal of Personnel Psychology, 16(1). (S.25–35). Deutschland: Hogrefe.
Crockett, L. J., Iturbide, M. I., Stone, R. A. T., McGinley, M., & Raffaelli, M. (2007). Acculturative stress, social support, and coping: Relations to psychological adjustment among Mexican American college students. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13, 347–355.
De Vroom, T., & Verkuyten, M. (2015). Labour market participation and immigrants’ acculturation. In S. Otten, K. van der Zee, & M. B. Brewer (Hrsg.), Towards inclusive organizations (S. 12–28). Psychology Press.
Deardorff, D. K. (2006). The identification and assessment of intercultural competence. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241–266.
Deardorff, D. K., & Jones, E. (2012). Intercultural competence: An emerging focus in international higher education. In D. K. Deardorff, H. de Wit, J. D. Heyl, & T. Adams (Hrsg.), The SAGE handbook of international higher education (S. 283–303). SAGE.
Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (1996). Affirmative action, unintentional racial biases, and intergroup relations. Journal of Social Issues, 52(4), 51–75.
Farcas, D., & Gonçalves, M. (2017). Motivations and cross-cultural adaptation of self-initiated expatriates, assigned expatriates, and immigrant workers: The case of Portuguese migrant workers in the United Kingdom. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48(7), 1028–1051.
Ferraro, G. P. (2002). The cultural dimension of international business. Prentice Hall.
Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 745–774.
Fong, E., Verkuyten, M., & Choi, S. Y. P. (2016). Migration and identity: Perspectives from Asia, Europe, and North America. American Behavioral Scientist, 60(5–6), 559–564.
Franco, M., Hsiao, Y.-S., Gnilka, P. B., & Ashby, J. S. (2019). Acculturative stress, social support, and career outcome expectations among international students. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19(2), 275–291.
Franken, S. (2015). Personal: Diversity management (6. Aufl.). Gabler.
Frey, D., & Gaska, A. (1993a). Die Theorie der kognitiven Dissonanz. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie (Bd. 1, S. 275–325). Huber.
Frey, D., Dauenheimer, D., Parge, O., & Haisch, J. (1993b). Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie (Bd. 1, S. 81–121). Verlag Hans Huber.
Gattino, S., Miglietta, A., Rizzo, M., & Testa, S. (2016). Muslim acculturation in a catholic country: Its associations with religious identity, beliefs, and practices. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47(9), 1194–1200.
Gavranidou, M., Niemiec, B., Magg, B., & Rosner, R. (2008). Traumatische Erfahrungen, aktuelle Lebensbedingungen im Exil und psychische Belastung junger Flüchtlinge. Kindheit und Entwicklung, 17(4), 224–231.
Geeraert, N., & Demes, K. (2012). The impact of living abroad: Research report. University of Essex.
Genkova, P. (2012). Kulturvergleichende Psychologie: Ein Forschungsleitfaden (Lehrbuch). Springer VS.
Genkova, P. (2014). Social perception and cross-cultural communication –psychological aspects. Journal for Psychology, 19(32), 71–83.
Genkova, P., & Braun-Lüdicke, F. (2012). Interkulturelle Kompetenz und Auslandseinsätze – Der Wiederanpassungsprozess nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt. In Gesellschaft für Arbeitssicherheit e.V. (Hrsg.), Gestaltung nachhaltiger Arbeitssysteme (S.719–742). GfA-Press.
Genkova, P., & Ringeisen, T. (Hrsg.). (2017). Handbuch Diversity Kompetenz. Band 1: Perspektiven und Anwendungsfelder. Springer Fachmedien.
Genkova, P., Gajda, A., & Wörmann, S. (2012). Ist Kultur virtuell erkennbar? Einflussvariablen der Interkulturellen Kommunikation bei virtuellen Teams. In U. Reutner (Hrsg.), Von der digitalen zur interkulturellen Revolution? (S. 349–367). Nomos.
Gordon, M. M. (1964). Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins. Oxford University Press.
Graves, T. (1967). Psychological acculturation in a tri-ethnic community. South-Western Journal of Anthropology, 23, 337–350.
Grosch, H., Groß, A., & Leenen, W. R. (2000). Methoden interkulturellen Lehrens und Lernens. ASKO Europa Stiftung.
Gudykunst, W., & Hammer, M. (1983). Basic training design: Approaches to intercultural training. In Landis, D. & Brislin, R. (Hrsg.), Handbook of Handbook of intercultural training: Vol 1, Issues in theory and design (S. 118–154). Elmsford.
Gullahorn, J. T., & Gullahorn, J. E. (1963). An extension of the U-curve hypothesis. Journal of Social Issues, 19, 33–47.
Güttler, P. O. (1996). Sozialpsychologie. Oldenburg.
Hall, E. T., & Hall, M. R. (1990). Understanding cultural differences. Intercultural Press.
Hamilton, V. L. (1976). Role play and deception: A re-examination of the controversy. Journal for Theory of Social Behaviour, 6(2), 233–252.
Hampden-Turner, C., & Trompenaars, F. (2006). Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business. N. Brealey Publishing.
Hirai, R., Frazier, P., & Syed, M. (2015). Psychological and sociocultural adjustment of first-year international students: Trajectories and predictors. Journal of Counselling Psychology, 62(3), 438–452.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.101.
Holtbrügge, D. (2008). Cultural adjustment of expatriates: Theoretical concepts and empirical studies. Rainer Hampp.
Homan, A. C., Van Knippenberg, D., Van Kleef, G. A., & De Dreu, C. K. (2007). Bridging faultlines by valuing diversity: Diversity beliefs, information elaboration, and performance in diverse work groups. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1189.
Horenczyk, G., & Ben-Shalom, U. (2001). Multicultural identities and adaptation of young immigrants in Israel. In N. K. Shimahara, I. Z. Holowinsky, & S. Tomlinson-Clarke (Hrsg.), Ethnicity, race, and nationality in education. A global perspective (S. 57–80). Lawrence Erlbaum.
Hovey, J. D. (2000). Acculturative stress, depression, and suicidal ideation among central American immigrants. Suicide and Life-threatening Behavior, 30, 125–139.
Huber, K., & Genkova, P. (2009). Kulturelle Anpassung oder Culture Shock? – Eine empirische Studie der Einflussfaktoren interkulturellen Erfolgs bei Expatriates. In G. Raab & A. Unger (Hrsg.), Der Mensch im Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns (S. 330–362). Pabst Publishers.
Jaeger, C. (2009). Akkulturation auf Ebene des Verhaltens: Die Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens zur Vorhersage unterschiedlicher Akkulturationsmuster am Beispiel von russischen Aussiedlern und russisch-jüdischen Zuwanderern in Deutschland und Israel. VDM Verlag Dr.
Kealey, D. J. (1989). A study of cross-cultural effectiveness. Theoretical issues, practical applications. International Journal of Intercultural Relations, 13, 387–428.
Ketturat, C., Frisch, J. U., Ullrich, J., Häusser, J. A., Van Dick, R., & Mojzisch, A. (2016). Disaggregating within- and between-person effects of social identification on subjective and endocrinological stress reactions in a real-life stress situation. Personality and Social Psychology Bulletin, 42(2), 147–160.
Kirkaldy, B., Siefen, R. G., Witiig, U., Schüller, A., Brähler, E., & Merbach, M. (2005). Health and emigration: Subjective evaluation of health and physical symptoms in Russian-speaking migrants. Stress and Health, 21(5), 295–309.
Kizilhan, J. (2007). Potenziale und Belastungen psychosozialer Netzwerke in der Migration. In T. Borde & M. David (Hrsg.), Migration und seelische Gesundheit, psychische Belastungen und Potenziale (S. 53–68). mabuse.
Kühlmann, T. M. (1995). Mitarbeiterentsendung ins Ausland. Hogrefe.
Kunst, J. R., Thomsen, L., Sam, D. L., & Berry, J. W. (2015). „We are in this together“: Common group identity predicts majority members’ active acculturation efforts to integrate immigrants. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(10), 1438–1453.
LaFromboise, T., Coleman, H. L. K., & Gerton, J. (1993). Psychological impact of biculturalism. Evidence and theory. Psychological Bulletin, 114(3), 395–412.
Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. McGraw-Hill.
Lazarus, R. S. (1998). Fifty years of the research and theory of R.S. Lazarus: An analysis of historical and perennial issues. Lawrence Erlbaum.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer.
Lefringhausen, K., & Marshall, T. C. (2016). Locals’ bidimensional acculturation model. Validation and associations with psychological and sociocultural adjustment outcomes. Cross-Cultural Research, 50(4), 356–392.
Lysgaard, S. (1955). Adjustment in a foreign society. Norwegian fulbright grantees visiting the Unites States. International Social Science Bulletin, 7, 45–51.
Mägdefrau, J., & Genkova, P. (2014). Der Zusammenhang von kultureller Distanz, kultureller Anpassung und beruflichem Belastungserleben: Eine Studie zum Gelingen der Entsendung von Lehrkräften im deutschen Auslandsschulwesen. Paradigma, 5, 38–55.
Markus, H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.
McConahay, J. B. (1986). Modern racism, ambivalence, and the modern racism scale. In J. F. Dovidio & S. L. Gaertner (Hrsg.), Prejudice, discrimination, and racism (S. 91–125). Academic Press.
Needham, B. L., Mukherjee, B., Bagchi, P., Kim, C., Mukherjea, A., Kandula, N. R., & Kanaya, A. M. (2017). Acculturation strategies among South Asian immigrants: The mediators of atherosclerosis in South Asians living in America (MASALA) Study. Journal of Immigrant and Minority Health, 19(2), 373–380.
Oberg, K. (1960). Cultural shock. Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropologist, 7, 177–182.
OECD. (2015). OECD/EU-Bericht: Jugendliche mit Migrationshintergrund profitieren noch nicht genug vom Aufschwung am Arbeitsmarkt. http://www.oecd.org/berlin/presse/jugendliche-mit-migrationshintergrund-profitieren-noch-nicht-genug-vom-aufschwung-am-arbeitsmarkt.html. Zugegriffen: 4. Apr. 2018.
Oetting, E. R., & Beauvais, F. (1991). Orthogonal culture identification theory: The cultural identification of minority adolescents. The International Journal of the Addictions, 25, 655–685.
Phinney, J. S., & Ong, A. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future directions. Journal of Counseling Psychology, 54, 271–281.
Piontkowski, U., Florack, A., & Hoelker, P. (2000). Predicting acculturation attitudes of dominant and non-dominant groups. International Journal of Intercultural Relations, 24, 1–26.
Razum, O., & Saß, C. (2015). Migration und Gesundheit: Interkulturelle Öffnung bleibt eine Herausforderung. Bundesgesundheitsblatt, 58, 513–514.
Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. J. (1936). Memorandum on the study of acculturation. American Anthropologist, 38, 149–152.
Runciman, W. G. (1966). Relative deprivation and social justice A study of attitudes to social inequality in twentieth-century. British Journal of Sociology, 17(4), 430–434.
Ryabichenko, T., & Lebedeva, N. (2017). Motivation for ethno-cultural continuity as a predictor of acculturation and adaptation in two generations of Latvian Russians. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48(5), 682–697.
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration. (2016). Viele Götte, ein Staat: Religiöse Vielfalt und Teilhabe im Einwanderungsland. Jahresgutachten 2016 mit Integrationsbarometer. Königsdruck Printmedien und digital eDienste GmbH.
Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4. Aufl.). Wiley.
Schnabel, D. B. L., Kelava, A., & Van de Vijver, F. J. R. (2015). Examining psychometric properties, measurement invariance, and construct validity of a short version of the Test to Measure Intercultural Competence (TMIC-S) in Germany and Brazil. International Journal of Intercultural Relations, 49, 137–155.
Schotte, K., Stanat, P., & Edele, A. (2018). Is integration always most adaptive? The role of cultural identity in academic achievement and in psychological adaptation of immigrant students in Germany. Journal of Youth and Adolescence, 47(1), 16–37.
Searle, W., & Ward, C. (1990). The prediction of psychological and sociocultural adjustment during cross-cultural transition. International Journal of Intercultural Relations, 14, 449–464.
Segall, M. H., Dasen, P. R., Berry, J. W., & Poortinga, Y. H. (1999). Human behavior in global perspective: An introduction to cross-cultural psychology. Allyn & Bacon.
Selmer, J. (2004). Psychological barriers to adjustment of Western business expatriates in China: Newcomers vs. Long stayers. International Journal of Human Resource Management, 15(4), 794–813.
Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge University Press.
Stellamanns, S. (2007). Evaluation interkultureller Trainings. Analysen und Lösungsstrategien in Theorie und Praxis. VDM Verlag Dr. Müller.
Suinn, R. M. (2010). Reviewing acculturation and Asian Americans: How acculturation affects health, adjustment, school achievement, and counselling. Asian American Journal of Psychology, 1, 5–17.
Swann, W. B., Gómez, Á., Dovidio, J. F., Hart, S., & Jetten, J. (2010). Dying and killing for one’s group: Identity fusion moderates responses to intergroup versions of the trolley problem. Psychological Science, 21(8), 1176–1183.
Taft, R. (1977). Coping with unfamiliar cultures. In N. Warren (Hrsg.), Studies in cross-cultural psychology (S. 121–153). Academic Press.
Tajfel, H., & Tuner, J. C. (1986). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Hrsg.), The social psychology of intergroup relations (S. 33–47). Brooks/Cole.
Thomas, A. (2003). Kulturvergleichende Psychologie (2 überarb). Hogrefe.
Thomas, A. (2004). Kulturverständnis aus Sicht der Interkulturellen Psychologie. Kultur als Orientierungssystem und Kulturstandards als Orientierungshilfen. In H.-J. Lüsebrink (Hrsg.), Konzepte der interkulturellen Kommunikation: Theorieansätze und Praxisbezüge in interdisziplinärer Perspektive (S. 145–156). Röhrig Universitätsverlag.
Thomas, A., & Simon, P. (2007). 4. Kapitel, Interkulturelle Kompetenz. In G. Trommsdorff & H.-J. Konradt (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich C Theorie und Forschung. Serie 7 Kulturvergleichende Psychologie. Band 3 Anwendungsfelder der kulturvergleichenden Psychologie (S. 135–177). Hogrefe Verlag für Psychologie.
Thomas, A., Kinast, E.-U., & Schroll-Machl, S. (2003). Handbuch Interkultureller Kommunikation und Kooperation Band 1: Grundlagen und Praxisfelder (2., überarb. Aufl.). Vandenhoeck & Ruprecht.
Thomas, A., Kammhuber, S., & Schmid, S. (2005). Interkulturelle Kompetenz und Akkulturation. In U. Fuhrer & H.-H. Uslucan (Hrsg.), Familie, Akkulturation und Erziehung: Migration zwischen Eigen- und Fremdkultur (S. 187–205). Kohlhammer.
Torbiörn, I. (1982). Living abroad. Personal adjustment and personnel policy in overseas setting. John Wiley & Sons.
Torres, L., & Rollock, D. (2004). Acculturative distress among hispanics: The role of acculturation, coping, and intercultural competence. Journal of Multicultural Counseling and Development, 32(3), 155–167.
Torres, L., & Rollock, D. (2007). Acculturation and depression among hispanics: The moderating effect of intercultural competence. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13, 10–17.
Uslucan, H.-H., & Brinkmann, H. U. (Hrsg.). (2013). Dabeisein und Dazugehören. Integration in Deutschland. Springer.
Van der Zee, K. I., Van Oudenhoven, J. P., & De Grijs, E. (2004). Personality, threat, and cognitive and emotional reactions to stressful intercultural situations. Journal of Personality, 72(5), 1069–1096.
Verkuyten, M., & Yildiz, A. A. (2007). National (dis) identification, and ethnic and religious identity: A study among Turkish-Dutch Muslims. Group Processes & Intergroup Relations, 10, 341–357.
Wagner, U., Hewstone, M., & Machleit, U. (1998). Contact and prejudice between Germans and Turks. Human Relations, 42, 561–574.
Wagner, U., Van Dick, R., Pettigrew, T. F., & Christ, O. (2003). Ethnic prejudice in East and West Germany: The explanatroy power of intergroup contact. Group Processes & Intergroup Relations, 6(1), 22–36.
Wagner, U., Chist, O., Pettigrew, T. F., Stellmacher, J., & Wolf, C. (2006). Prejudice and minority proportion: Contact instead of threat effects. Social Psychology Quarterly, 69(4), 380–390.
Wagner, U., Christ, O., & Pettigrew, T. F. (2008). Prejudice and group related behaviour in Germany. Journal of Social Issues, 64(2), 303–320.
Ward, C. (1996). Acculturation. In D. Landis & R. Bhagat (Hrsg.), Handbook of intercultural training (S. 124–147). Sage.
Ward, C., & Kennedy, A. (1992). Locus of control, mood disturbance and social difficulty during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations, 16, 175–194.
Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock. Routledge.
Weaver, G. R. (1986). Understanding and coping with cross-cultural adjustment stress. In R. M. Paige (Hrsg.), Cross-cultural orientation, new conceptualizations and applications (S. 137–168). University Press of America.
Weiss, H. (2003). A cross-national comparison of nationalism in Austria, the Czech and Slovac Republics, Hungary, and Poland. Political Psychology, 24, 377–401.
White, R., & Buehler, D. (2018). A closer look at the determinants of international migration: Decomposing cultural distance. Applied Economics, 50(4), 1–21.
Yakunina, E., Weigold, I., & Weigold, A. (2013). Personal growth initiative: Relations with acculturative stress and international student adjustment. International Perspectives In Psychology: Research, Practice, Consultation, 2(1), 62–71.
Zick, A. (2010). Psychologie der Akkulturation. Neufassung eines Forschungsbereiches. Springer.
Zimmermann, J., & Neyer, F. (2013). Do we become a different person when hitting the road? Personality development of sojourners. Journal of Personality and Social Psychology, 105(3), 515–530.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Copyright information
© 2022 Der/die Autor(en)
About this chapter
Cite this chapter
Genkova, P. (2022). Migration und Erfolg: Gelingensbedingungen und Hindernisse. In: Genkova, P., Semke, E., Schreiber, H. (eds) Diversity nutzen und annehmen. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35326-1_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-35326-1_3
Published:
Publisher Name: Springer, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-35325-4
Online ISBN: 978-3-658-35326-1
eBook Packages: Psychology (German Language)