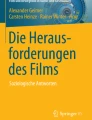Zusammenfassung
Spielfilme, die in vergangenen Zeiten situiert sind, sollten sowohl einen realistischen Eindruck der abgebildeten Epoche vermitteln als auch eine grundsätzliche Lesbarkeit für das kontemporäre Publikum gewährleisten. Insbesondere für Biopics stellt die Perzeption von Authentizität und Realismus eine relevante Komponente für das Einlassen auf bzw. Eintauchen in diese ‚ferne‘ Welt dar. Unter diesen Prämissen diskutiert der vorliegende Beitrag Bedingungen für einen sozialen Realismus, insbesondere aus sozialstruktureller Perspektive, die nicht nur die Figuren und ihre Handlungen, sondern auch die sozialräumliche Architektur der Filmwelt berücksichtigen. Auf einer an die Konzeptionen Pierre Bourdieus angelehnten theoretischen Basis erfolgt eine Sozialraum- und Lebensstilanalyse des Spielfilms CAPOTE inklusive einer Diskussion über die Chancen und Grenzen eines solchen Ansatzes.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Es ist zu betonen, dass keine direkte Unvereinbarkeit zwischen diesen beiden Ausführungen von Kracauer und Bazin besteht. Bazin geht es um das Filmbild per se und dessen Innovationen bezüglich der Perzeption des Präsentierten. Die Zitate dienen vorrangig der Illustration der unterschiedlichen Näherungen an die Frage eines filmischen Realismus in und für vergangene Welten.
- 2.
So fügt Williams im Verlauf seiner Ausführungen noch einen vierten Punkt hinzu, der im Kontext des politisch-interventionistischen Anspruchs der Cultural Studies zu verstehen ist: „the consciously interpretative in relation to a particular political viewpoint“ (Williams 1977, S. 68), womit er einen dezidiert linken Standpunkt meint, von dem aus die Gesellschaft unter die Lupe genommen werden soll. Eine ähnliche Schlagrichtung findet sich etwa in der Konzeption eines progressive realism nach John Caughie (1981) oder der Diskussion zu Social Realism als Genrebegriff bei Marion Jordan (1981).
- 3.
Kirsten orientiert sich hier an den verschiedenen Realismen des diegetischen Schichtenmodells von Hans J. Wulff (2007): Physikalischer Realismus (Übereinstimmung mit den uns bekannten Naturgesetzen), sozialer Realismus (Übereinstimmung mit den herrschenden Institutionen, Werten und Normen), moralischer Realismus (Übereinstimmung mit geteilten Moralvorstellungen) sowie Wahrnehmungsrealismus (Übereinstimmung mit unverfälschter, nicht phantastisch beeinträchtigter Sinneswahrnehmung).
- 4.
Medienwissenschaftliche Konzepte, die ähnliche Phänomene beschreiben, sind etwa die Wirklichkeitseffekte nach Roland Barthes (2006) – vorgeblich bedeutungslose Details, die der tiefen Einbettung dienen – oder die „contextualing devices“ nach Janet Murray (2017), die zu einer besseren (sozialen) Orientierung in der fiktionalen Welt führen.
- 5.
An anderer Stelle spricht Bourdieu (1982: 728) hierbei auch von einem – zunächst präreflexivem – „gesellschaftliche[n] Orientierungssinn“, der als ein „praktisches Vermögen des Umgangs mit sozialen Differenzen“ begriffen werden kann.
- 6.
Der Darsteller von Truman Capote, Philip Seymour Hoffman, merkte in einem Interview an, dass sowohl er als auch Regisseur Bennett Miller den Film nicht als Biopic betrachten, da lediglich eine kurze Phase aus Capotes Leben abgebildet wird, dazu noch unter einem dezidierten thematischen Fokus, nämlich der Recherche zu dem Buch sowie den psychischen Folgen (vgl. O’Rourke 2006). Allerdings ist anzumerken, dass die Länge des behandelten Lebensabschnitts keine Bedingung per se für die Einordnung in das Genre Biopic darstellt (vgl. grundlegend Taylor 2002).
- 7.
Noch deutlicher wird diese Lebensstildifferenz später am Beispiel des mondänen Anwesens an der Costa Brava, in dem Capote zeitweilig mit seinem Partner Jack Dunphy lebt und am Buch zu den Morden schreibt.
- 8.
Die Zahl hinter dem Zitat verweist auf die Minute, in der das Zitat im Film auftritt.
- 9.
Mann: „Kudos on ‚Kill the Bird‘, is it?“
Lee: „That’s close. Thank you.“ […]
Mann: „It’s a children’s book, right?“.
Lee: „Yes.“
Mann: „No, no, it’s about children?“
Lee: „Yes.“
Mann: „Yes, I’ve heard a lot about it“ (40).
Als Lee den Raum verlässt, bemerkt ein anderer Mann in der Runde: „I didn’t even know she wrote“ (ebd.)
- 10.
Akte der Lynchjustiz kamen zu dieser Zeit nur noch vereinzelt vor und beschränkten sich seit einigen Jahrzehnten auf die Südstaaten der USA (vgl. Berg 2014), ein gewisser Aufruhr – insbesondere bei Vermutungen zum ethnischen Hintergrund von Smith – wäre nichtsdestotrotz zu erwarten gewesen.
- 11.
In diesem Kontext ist zudem zu berücksichtigen, dass der Einfall von Repräsentant*innen urbaner Liberalität in rural-konservative Orte gerade in filmischen Verhandlungen diverser Genres als Quelle schwerwiegender Konflikte identifiziert werden kann.
- 12.
Die binäre Opposition, die Capote in einem Gespräch mit William Shaw, dem Redakteur von The New Yorker, vornimmt, wirkt bemerkenswert oberflächlich: „Two worlds exist in this country. The quiet, conservative life, and the life of those two men. The underbelly. The criminally violent. And those worlds converged that bloody night” (42–43).
- 13.
Fotos und insbesondere Portraitbilder werden hier mehrfach zur Charakterisierung von Personen und sozialen Positionen eingesetzt. So verweilt die Kamera auffällig lange auf den Bildern an den Wänden des Clutter-Hauses.
- 14.
Diese von Capote bemühte Parallelisierung wird auch mit filmischen Mitteln angedeutet, etwa zwischen dem in der Gefängniszelle liegenden, vom Hungerstreik geschwächten Smith und dem im Hotelbett liegenden Capote, dem die einfallenden Sonnenstrahlen aufgrund der Jalousien eine Gitterstruktur auf den Körper zeichnen (48–49).
Literatur
Barthes, Roland. 2006. Das Rauschen der Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bazin, André. 1975. Was ist Kino? Bausteine zur Theorie des Films. Köln: DuMont Schauberg.
Berg, Manfred. 2014. Lynchjustiz in den USA. Hamburg: Hamburger Edition.
Bohnsack, Ralf. 2011. Qualitative Bild- und Videointerpretation: Die dokumentarische Methode, 2. Aufl. Stuttgart, Opladen: UTB; Budrich.
Bohnsack, Ralf. 2013. Dokumentarische Methode und die Logik der Praxis. In Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus: Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven, Hrsg. Alexander Lenger, Christian Schneickert und Florian Schumacher, 175–200. Wiesbaden: Springer VS.
Bourdieu, Pierre. 1982. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Bourdieu, Pierre. 1985. Sozialer Raum und "Klassen". Lecon sur la lecon. Zwei Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre. 1989a. Antworten auf einige Einwände. In Klassenlage, Lebensstil und kulturelle Praxis. Beiträge zur Auseinandersetzung mit Pierre Bourdieus Klassentheorie, Hrsg. Klaus Eder, 395–410. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre. 1989b. Satz und Gegensatz. Über die Verantwortung des Intellektuellen. Berlin: Wagenbach.
Bremer, Helmut, und Christel Teiwes-Kügler. 2013. Zur Theorie und Praxis der „Habitus-Hermeneutik“. In Empirisch Arbeiten mit Bourdieu. Theoretische und methodische Überlegungen, Konzeptionen und Erfahrungen, Hrsg. Anna Brake, Helmut Bremer und Andrea Lange-Vester, 93–129. Weinheim: Beltz Juventa.
Busselle, Rick, und Helena Bilandzic. 2008. Fictionality and Perceived Realism in Experiencing Stories: A Model of Narrative Comprehension and Engagement. Communication Theory 18: 255–280.
Caughie, John. 1981. Progressive Television and Documentary Drama. In Popular Television and Film. A Reader, hrsg. Tony Bennett, Susan Boyd-Bowman, Colin Mercer und Janet Woollacott, 327–352. London: BFI Publishing.
Cramer, Katherine J. 2016. The Politics of Resentment. Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker. Chicago: The University of Chicago Press.
Denzin, Norman K. 2008. Die Geburt der Kinogesellschaft. In Ethnographie, Kino und Interpretation - die performative Wende der Sozialwissenschaften. Der Norman K. Denzin-Reader, Hrsg. Rainer Winter und Elisabeth Niederer, 89–136. Bielefeld: Transcript.
Düllo, Thomas. 2008. Wohnen im Film. In Gesellschaft im Film, Hrsg. Markus Schroer, 356–392. Konstanz: UVK.
Goodhart, David. 2017. The Road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of Politics. London: Hurst & Company.
Hall, Alice. 2003. Reading Realism: Audiences' Evaluations of the Reality of Media Texts. Journal of Communication 53 (4): 624–641.
Hartmann, Britta. 2007. Diegetisieren, Diegese, Diskursuniversum. montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 16 (2): 53–69.
Heinze, Carsten. 2018. Filmsoziologische Suchbewegung. In Die Herausforderungen des Films. Soziologische Antworten, Hrsg. Alexander Geimer, Carsten Heinze und Rainer Winter, 7–55. Wiesbaden: Springer VS.
Hochschild, Arlie Russell. 2016. Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right. New York: The New Press.
Jarness, Vegard. 2015. Modes of Consumption: From “What” to “How” in Cultural Stratification Research. Poetics 43 (1): 65–79.
Jordan, Marion. 1981. Realism and Convention. In Coronation Street, Hrsg. Richard Dyer, Christine Geraghty, Marion Jordan, Terry Lovell, Richard Paterson und John Stewart, 27–39. London: BFI Publishing.
Kimmich, Dorothee. 2013. Charlie Chaplin und Siegfried Kracauer. Bemerkungen zum Verhältnis von Geschichte, Kunst und Kino. In Historisierte Subjekte - subjektivierte Historie: Zur Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit von Geschichte, hrsg. Stefan Deines, Stephan Jaeger und Ansgar Nünning, 225–238. Berlin: De Gruyter.
Kirsten, Guido. 2013. Filmischer Realismus. Marburg: Schüren.
Korte, Helmut. 2010. Einführung in die Systematische Filmanalyse, 4. Aufl. Berlin: Erich Schmidt.
Kracauer, Siegfried. 1973. Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lange-Vester, Andrea, und Christel Teiwes-Kügler. 2013. Das Konzept der Habitushermeneutik in der Milieuforschung. In Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus. Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven, hrsg. Alexander Lenger, Christian Schneickert und Florian Schumacher, 149–174. Wiesbaden: Springer VS.
Michel, Burkard. 2006. Bild und Habitus. Sinnbildungsprozesse bei der Rezeption von Fotografien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Millington, Bob, und Robin Nelson. 1986. Boys from the Blackstuff. The Making of TV Drama. London: Comedia.
Monaco, James. 2002. Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der neuen Medien. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Murray Janet. 2017. Hamlet on the holodeck. The future of narrative in cyberspace. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Nelson, Robin. 1997. TV drama in transition: Forms, values and cultural change. Basingstoke: Macmillan.
Nichols, Bill. 1991. Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary. Bloomington u.a.: Indiana Univ. Press.
Odin, Roger. 2002. Kunst und Ästhetik bei Film und Fernsehen. Elemente zu einem semio-pragmatischen Ansatz. montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 11 (2): 42–57.
O’Rourke, Meghan. 2006. Philip Seymour Hoffman. https://slate.com/news-and-politics/2006/01/an-interview-with-philip-seymour-hoffman.html. Zugegriffen 28.11.2020.
Rodríguez-Pose, Andrés. 2017. The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 11 (1): 189-209.
Ryan, Marie-Laure. 1980. Fiction, non-factuals, and the principle of minimal departure. Poetics 9 (4): 403–422.
Sander, Tobias, und Jan Weckwerth. 2019. Kompetenzen als symbolisches Kapital in beruflich-sozialen Feldern? Ein Vergleich des soziologischen Kompetenzbegriffs mit den theoretischen Konzepten Pierre Bourdieus. In Das Personal der Professionen, Hrsg. Tobias Sander und Jan Weckwerth, 55–80. Weinheim: Beltz Juventa.
Segal, Erwin M. 1995. A Cognitive-Phenomenological Theory of Fictional Narrative. In Deixis in narrative. A cognitive science perspective, Hrsg. Judith F. Duchan, Gail A. Bruder und Lynne E. Hewitt, 61–78. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Sutherland, Jean-Anne, und Kathryn Feltey. 2013. Introduction. In Cinematic Sociology. Social Life in Film, Hrsg. Jean-Anne Sutherland und Kathryn Feltey, 1–23. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Taylor, Henry M. 2002. Rolle des Lebens. Die Filmbiographie als narratives System. Marburg. Schüren.
Turner, Graeme. 1999. Film as social practice, 3. Aufl. London u.a.: Routledge.
Vester, Michael, Peter von Oertzen, Heiko Geiling, Thomas Hermann, und Dagmar Müller. 2015. Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung, 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Weckwerth, Jan. 2014. Sozial sensibles Handeln bei Professionellen. Von der sozialen Lage zum Habitus des Gegenübers. In: Habitussensibilität. Eine neue Anforderung an professionelles Handeln, Hrsg. Tobias Sander, 37–66. Wiesbaden: VS-Verlag.
Weckwerth, Jan. 2018. Das 'Wissen' um Differenz. Bourdieus Habitus- und Lebensstilkonzept als Bedeutungsgenerator zwischen Produkt und Rezeption – am Beispiel des Horrorfilmgenres. In Die Herausforderungen des Films. Soziologische Antworten, Hrsg. Alexander Geimer, Carsten Heinze und Rainer Winter, 107–125. Wiesbaden: Springer VS.
Williams, Raymond. 1977. A Lecture on Realism. Screen 18 (1): 61–74.
Wulff, Hans J. 2007. Schichtenbau und Prozesshaftigkeit des Diegetischen: Zwei Anmerkungen. montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 16 (2): 39–51.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2021 Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Weckwerth, J. (2021). Sozialräume historisierter Filmwelten. In: Dimbath, O., Heinze, C. (eds) Methoden der Filmsoziologie. Film und Bewegtbild in Kultur und Gesellschaft. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34927-1_10
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-34927-1_10
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-34926-4
Online ISBN: 978-3-658-34927-1
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)