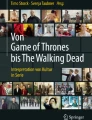Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag geht davon aus, dass Serienforschung heutzutage als Serialitätsforschung zu verstehen ist, die die kulturelle Arbeit von Serien gleichermaßen reflektiert wie ihre Ästhetiken und Erzählverfahren. Defizite der aktuellen Serienforschung werden vor allem in ihrer Verengung auf bestimmte Medien und Erscheinungsformen (insbesondere das sog. Quality-TV) gesehen. Dargestellt werden die Grundformen seriellen Erzählens (Reihe/Anthologie, Episoden- und Fortsetzungsserie) sowie die unterschiedliche Formstruktur fiktionaler und nicht-fiktionaler Serien. Verfahren des Remakings werden als „Serialität zweiter Ordnung“ (Kelleter und Loock 2017) reflektiert.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Daher zeige sich eine starke Neigung zur Selbstserialisierung. Dies gelte dabei nicht nur für einzelne populäre Serien, sondern für die Entwicklung populärer Serialität im Allgemeinen. So folgt eben auf einen erfolgreichen James Bond Roman (oder Film) nicht nur ein, zwei, drei … weitere James Bond Romane (Filme), sondern gleichsam eine Vielzahl ähnlicher Filme, Bücher etc. über Geheimagenten, die die Welt unter unmöglichen Umständen retten müssen.
- 2.
Auch wenn Serien so keine reinen Produkte/Folgen des Entscheidungshandelns Einzelner sind, so ermöglichen sie Einzelnen, Entscheidungen – unter bestimmten Rahmenbedingungen und auch Entscheidungszwängen – zu treffen.
- 3.
„Scriptwriters, fans, executive boards, television scholars, cable networks, camera setups, genre conventions, program slots, canons, memes: they all do something in the act of serial storytelling, but their actions and inter-actions are highly specific to each evolving narrative.“ (Kelleter 2017, S. 25; Herv. i. Orig.)
- 4.
Dem ließe sich allerdings entgegenhalten, dass dies für sämtliche Gesellschafts- und Wirtschaftsformen gelten dürfte – auch der Kommunismus oder eine Tausch-Gesellschaft zerfällt, wenn niemand mehr an seine Zukunft(sfähigkeit) glaubt.
- 5.
Zur Frage, ob einige Serien nicht vielmehr kompliziert als komplex erzählen, vgl. Klein 2012.
- 6.
Es würde dem verfassungsmäßigen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks widersprechen, wenn er quasi nur die ‚Programmlücken‘ des privatwirtschaftlich organisierten Rundfunks füllen würde.
- 7.
Auch auf ein ‚besseres‘ Fernsehen lässt sich der Grundversorgungsauftrag ebenfalls nicht herunterbrechen (das öffentlich-rechtliche soll gerade kein ‚Elite-TV‘ sein). So heißt es im sogenannten Lebach-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1973: „Ebensowenig läßt die Rundfunkfreiheit von vornherein eine Unterscheidung der Sendungen nach dem jeweils verfolgten Interesse oder der Qualität der Darbietung zu; eine Beschränkung auf ‚seriöse‘, einem anerkennenswerten privaten oder öffentlichen Interesse dienende Produktion liefe am Ende auf eine Bewertung und Lenkung durch staatliche Stellen hinaus, die dem Wesen dieses Grundrechts gerade widersprechen würde.“
- 8.
Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime veröffentlichen in der Regel keine Zugriffsdaten, so dass über den tatsächlichen Erfolg ihrer Produktionen/Angebote kaum gesicherte Angaben zu machen sind.
- 9.
Verwiesen sei nur auf Serien wie Am grünen Strand der Spree (BRD 1960), Acht Stunden sind kein Tag (BRD 1972–1973), Heimat – Eine deutsche Chronik (BRD 1984) oder die immer noch außergewöhnliche Produktion Tod eines Schülers (BRD 1981).
- 10.
Das lineare Fernsehen ist hierbei abhängig von zeitlich fixierten Sendeplätzen, mit denen auch bestimmte Erwartungen verknüpft sind. Eine Sendung zur Hauptsendezeit muss (in absoluten Zahlen) mehr Zuschauer binden als bspw. eine im Nachmittagsprogramm (darf/muss dafür aber auch mehr kosten). Produktionen, die Quotenvorgaben nicht erfüllen, werden zu anderen Zeiten programmiert und/oder ganz abgesetzt, um den Sendeplatz ‚nicht zu beschädigen‘ (zu Programmstrategien im linearen Fernsehen vgl. Eick 2007). Aus Sicht der Programmverantwortlichen mag das sinnvoll sein – für Serienfans eher nicht (lassen sie sich auf eine neue Serie ein, wissen sie nicht, ob sie vom Sender auch zu Ende geführt wird). Streamingdienste hingegen kennen a) keine Programmplätze und b) werden Serien dort oft als sog. ‚full drop seasons‘ veröffentlicht. Aufgrund der unterschiedlichen Distributionsmöglichkeiten und -strategien bemisst sich so auch der Erfolg einer Produktion an (zumindest teilweise) anderen Indikatoren.
- 11.
Kelleter und Loock (2017) beschreiben Formen des remakings dabei als Serialisierung zweiter Order („Second- Order Serialization“); s. u.
- 12.
Kelleter schränkt seine Seriendefinition auf „Fortsetzungsgeschichten mit Figurenkonstanz“ (2012, S. 18) ein, das würde aber Reihen/Anthologien und Episodenserien ausschließen – und damit einen erheblichen Teil populärer Serien (zu den Serienformen s. u.). Zudem gerät damit die „Serialität des Programms“ (Hickethier 1991, S. 11), die Stockinger (2018) beispielsweise im Familienblatt Die Gartenlaube untersucht, aus dem Blick.
- 13.
Zuweilen wird auch der Mehrteiler bzw. die Miniserie als eigene serielle Form aufgeführt. Lothar Mikos versteht unter Mehrteiler „eine narrative Programmform mit einer abgeschlossenen Geschichte, die von Anfang bis Ende erzählt wird“ (1994, S. 136). Mehrteiler werden bzw. wurden oftmals eher als ‚zerteilte‘ Fernsehfilme wahrgenommen (vgl. Giesenfeld und Prugger 1994, S. 353). Die Begriffe ‚Mehrteiler‘ und ‚Mini-Serie‘ sind nicht unproblematisch, da das Abgrenzungskriterium ‚Folgenanzahl‘ unbestimmt ist (vgl. Klein und Hißnauer 2012, S. 10). Mikos (1994, S. 137) weist zudem darauf hin, dass bspw. Telenovelas (im Unterschied zu Soap Operas) ebenfalls abgeschlossene Geschichte erzählen – mit zum Teil weit über 100 Folgen. Auch einige US-amerikanische Serien wie z. B. Lost (2004–2010) sind von vornherein auf ein bestimmtes Ende nach mehreren Staffeln hin konzipiert (vgl. Klein und Hißnauer 2012, S. 10 f.). Giesenfeld und Prugger (1994, S. 353) betonen demgegenüber jedoch: „Weist aber eine Serie trotz finalen Handlungstyps sehr viele Folgen auf, […] so wird sie von den Rezipienten als eine offene Serie empfunden.“ – Problematisch ist der Begriff Mehrteiler bzw. Miniserie auch, weil es durchaus Beispiele dafür gibt, dass Produktionen aufgrund ihres Erfolges eine zunächst nicht geplante Fortsetzung fanden.
- 14.
Mikos (1994, S. 137) versteht unter Reihe hingegen „eine Programmform, in der einzelne Episoden aus dem Leben der Protagonisten erzählt werden“. In der derzeitigen Produktions- und Fernsehpraxis wird die Bezeichnung Reihe zudem „unterschiedslos auf serielle Programme mit einer Episodenlänge von 90 Minuten verwandt“ (Weber und Junklewitz 2008, S. 22; vgl. auch Eick 2007, S. 63), unabhängig davon, ob es sich um eine Episodenserie oder eine Anthologie handelt. Zur Diskussion unterschiedlicher Begriffsbestimmungen in der deutschsprachigen Serienforschung siehe auch Liebnitz 1992 und Weber und Junklewitz 2008. Zu abweichenden begrifflichen Abgrenzung bspw. Türschmann 2007 oder Krah 2010.
- 15.
Schleich und Nesselhauf (2016, S. 120 ff.) sprechen hingegen von Status-Quo-Serien und progressiven Serien.
- 16.
Soaps zeichnen sich durch ein großes Ensemble aus, das weder Haupt- noch Nebendarsteller kennt (bzw. wechselt die Bedeutung der einzelnen Figuren für die Serie laufend) und zum anderen durch ihre sog. Zoff-Dramaturgie, bei der verschiedene, unterschiedlich weit fortgeschrittene Handlungsstränge alternierend erzählt werden und immer wieder durch neue ersetzt bzw. ergänzt werden.
- 17.
Dabei kann man zwischen der intraseriellen Kohärenz (Weber und Junklewitz 2008), also den Verknüpfungsformen innerhalb einer Serie, und der interseriellen Kohärenz, also den Verknüpfungsformen unterschiedlicher Serien miteinander (Junklewitz und Weber 2016) unterscheiden. Für die typologische Unterscheidung der Serienformen ist vor allem die intraserielle Kohärenz von Interesse.
- 18.
In ähnlicher Weise nutzte Newcom bereits in den 1980er-Jahren (1985) die Bezeichnung cumulative narrative. Newcomb (2004, S. 422) begreift das cumulative narrative bei fiktionalen Serien wie Magnum P.I./Magnum (USA 1980–1988) als eine Art Meta-Plot „that extends over the entire series“, aber nur vereinzelt in Folgen zum Tragen kommt. Er unterscheidet es von kürzeren Handlungsbögen („narrative arcs“), die sich über eine geringe Anzahl von Episoden erstrecken, und den vollständig serialisierten (fortgesetzten) Narrativen.
- 19.
In diesem Zusammenhang sind auch die Überlegungen zur Serie von Thomas Klein (2007, 2012) relevant. Für ihn werden in Serien gesellschaftliche Diskurse verhandelt. Gerade die episodische Struktur ermöglicht es dabei, immer wieder neue Variationen und Aspekte eines Themas durchzuspielen – und den Diskurs so auch in seiner Komplexität abzubilden.
- 20.
Allerdings verwendet die Serie bereits einen staffelübergreifenden Handlungsbogen, indem sie die Liebesgeschichte ihrer Hauptprotagonisten erzählt, auf die immer wieder Bezug genommen wird.
- 21.
In der Regel bedeute dies auch einen komplett neuen Cast, wobei in American Horror Story (USA seit 2011) einige Darsteller in verschiedenen Staffeln mitwirken; allerdings in anderen Rollen.
- 22.
Serien wie The Affair (USA seit 2014), Seven Types of Ambiguity/Sieben Seiten der Wahrheit (AUS 2017) oder De Dag/24 Hours – Two Sides of Crime (B 2018) sind in ihrer Erzählhaltung deswegen weniger konsequent, da sie ihre Geschichten (mehr oder weniger) von Folge zu Folge (bei De Dag jeweils alle zwei Folgen) fortgesetzt erzählen – auch wenn dabei die Erzählperspektive wechselt. In Tod eines Schülers steht die Zeit aber still.
- 23.
Derzeit soll Steven Spielbergs Produktionsfirma an einer Serialisierung des Films arbeiten (vgl. Doerksen 2018).
- 24.
- 25.
Zuweilen werden Figuren auch aus dramaturgischen Gründen nachträglich mit Vergangenheit(en) ausgestattet, die sie zuvor (so) nicht hatten. In der Comic-Forschung spricht man auch von der retcon, der retrospective continuity. „[D]ie Technik der ‚retrospective continuity‘ verleiht Autorität über Zukunft und Vergangenheit einer Serie“ (Kelleter und Stein 2012, S. 280), da in der Regel das neu Erzählte aus der Vergangenheit den Fortgang der Geschichte bestimmt.
- 26.
Dieses ‚unaufgezeichnete Dasein‘ gibt es so gesehen nicht zwingend zwischen den Episoden, da Fortsetzungsserien bspw. oftmals – siehe z. B. 24 (USA 2001–2010) – direkt an die vorhergehende Folge anschließen (bei anderen Serien, wie bspw. der Lindenstraße, BRD seit 1985; hingegen vergeht sowohl in der Realität als auch in der Serienwirklichkeit zwischen den Episoden eine Woche). Ein ‚unaufgezeichnetes Dasein‘ findet sich aber auch in diesen Serien: zwischen einzelnen Einstellungen, Szenen, Sequenzen, Staffeln …
- 27.
So stellen Wiederbegegnungen und bestimmte Formen der Langzeitbeobachtung ebenfalls Verfahren nicht-fiktionaler Serialität dar (siehe dazu auch den Artikel Langzeitdokumentation – Langzeitbeobachtung. Formen dokumentarischer Wiederbegegnungen in diesem Band).
- 28.
Ähnlich, wenn auch nur implizit, auch Bleicher (2017, S. 168): „Dabei ist es manchmal die reale Biographie, die in nicht intendierter Fortführung der Formatdiegese zur dauerhaften Medienpräsenz beiträgt.“ Bleicher begreift dies aber a) nicht serialitätstheoretisch und b) reflektiert sie nicht, dass es zuweilen nur die vermeintlich ‚reale‘ Biographie ist, die zur dauerhaften Medienpräsenz beiträgt (so z. B. wenn Promi-Singles angeblich bei Adam sucht Eva, seit 2014; nach neuen Liebenspartnern suchen).
- 29.
Unter Remaking als kulturelle Praxis fassen Kelleter und Loock nicht nur Remakes im engen Sinne (also Neuverfilmungen), sondern auch Sequels (mehr oder weniger fortsetzende Neuerzählung des ursprünglichen Films), Prequels (quasi die Vorgeschichte zum Original) und Franchise-Produktionen, die das Serienuniversum erweitern, da eine klare Abgrenzung nicht immer möglich ist.
- 30.
Abgesehen von dem Umstand, dass viele Filme oder Fernsehproduktionen auf Romanen, Theaterstücken oder Comics basieren.
- 31.
In gewisser Weise kann man solche Selbsthistorisierungsprozesse auch an seriellen Figuren – im Unterschied zu Serienfiguren/Seriencharakteren – beobachten. Serielle Figuren (serial figures) kann man dabei mit Denson und Meyer (2012, 2017) als „topische Figuren“ verstehen, „deren populärkulturelle Karriere[n] von verschiedenen Medien geprägt wurde[n]“ (Denson und Mayer 2012, S. 185): „[S]erial figures are inevitably characterized by repetitions, revisions, and even the occasional ‚reboot‘ of their entire history.“ (Denson und Mayer 2017, S. 110) An ihnen lassen sich daher Medienumbrüche besonders gut beschreiben und ablesen: „Die Medienevolution wird in besonderer Weise durch serielle Figuren reflektiert und dokumentiert.“ (Denson und Mayer 2012, S. 185)
- 32.
Bis 1944 weitergeführt unter dem Titel Die neue Gartenlaube.
Literatur
Allrath, Gaby, Marion Gymnich, und Carola Surkamp. 2005. Introduction: Towards a Nar-ratology of TV Series. In Narrative strategies in television series, Hrsg. Gaby Allrath und Marion Gymnich, 1–43. Houndsmills/Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.
Baßler, Moritz. 2014. Bewohnbare Strukturen und der Bedeutungsverlust des Narrativs. Überlegungen zur Serialität am Gegenwarts-Tatort. In Zwischen Serie und Werk. Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte im „Tatort“, Hrsg. Christian Hißnauer, Stefan Scherer und Claudia Stockinger, 347–360. Bielefeld: transcript.
Bleicher, Joan Kristin. 2017. Reality-TV in Deutschland. Geschichte, Themen, Formate. Avinus: Hamburg.
Denson, Shane, und Ruth Mayer. 2012. Grenzgänger: Serielle Figuren im Medienwechsel. In Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert, Hrsg. Frank Kelleter, 185–203. Bielefeld: transcript.
Denson, Shane, und Ruth Mayer. 2017. Spectral seriality. The sights and sounds of count Dracula. In Media of serial narrative, Hrsg. Frank Kelleter, 108–124. Columbus: Ohio State University Press.
Doerksen, Katrin. 2018. Akira Kurosawas „Rashomon“ wird zur Serie. In www.kino-zeit.de vom 19.12.2018. https://www.kino-zeit.de/news-features/aktuelles/akira-kurosawas-rashomon-wird-zur-serie. Zugegriffen am 05.11.2019.
Eco, Umberto. 1988. Die Innovation im Seriellen. In derselbe: Über Spiegel und andere Phänomene, 155–180. München: Hanser.
Eco, Umberto. 2005. Serialität im Universum der Kunst und der Massenmedien. In derselbe: Streit der Interpretationen, 81–111. Hamburg: Philo & Philo Fine Arts/Europäische Verlagsanstalt.
Eick, Dennis. 2007. Programmplanung. Die Strategien deutscher TV-Sender. Konstanz: UVK.
Feuer, Jane, Paul Kerr, und Tise Vahimagi, Hrsg. 1984. MTM: Quality television. London: BFI.
Giesenfeld, Günter, und Prisca Prugger. 1994. Serien im Vorabend- und im Hauptprogramm. In Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland. Band 2: Das Fernsehen und die Künste, Hrsg. Helmut Schanze und Berhard Zimmermann, 349–388. München: Fink.
Harrigan, Pat, und Noah Wardrip-Fruin, Hrsg. 2009. Third person: Authoring and exploring vast narratives. Cambridge: MIT.
Hecken, Thomas, und Annemarie Opp. 2017. TV-Serien. In Handbuch Popkultur, Hrsg. Thomas Hecken und Marcus S. Kleiner, 164–168. Stuttgart: Metzler.
Hickethier, Knut. 1976. Serienunterhaltung durch Unterhaltungsserien – Fernsehspielserien im Werberahmenprogramm. In Didaktik der Massenkommunikation 2. Materialien zum Fernsehunterricht. Unterrichtspraxis, Programmanalysen und Medientheorie, Hrsg. Reent Schwarz, 173–222. Stuttgart: Metzler und Poeschel.
Hickethier, Knut. 1991. Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens. Lüneburg: Universität Lüneburg.
Hißnauer, Christian. 2012. Perspektiven auf den Tod eines Schülers: Fokalisierung als serielles Prinzip. In Revisionen – Relektüren – Perspektiven. Dokumentation des 23. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums, Hrsg. Simon Frisch und Tim Raupach, 139–149. Marburg: Schüren.
Hißnauer, Christian. 2016a. „Die Geschichte ist weitergegangen – die im wirklichen Leben.“ Real-Life-Storytelling und die dreifache Formstruktur nicht-fiktionaler Serialität. In Scripted Reality: Fernsehrealität zwischen Fakt und Fiktion. Perspektiven auf Produkt, Produktion und Rezeption, Hrsg. Daniel Klug, 65–88. Baden-Baden: Nomos.
Hißnauer, Christian. 2016b. Episodischer Variationsreichtum: Innovative Krimiserien abseits des ‚Quality-TV‘. Boomtown, Motive, Accused, Countdown und Krimiprinzipien jenseits ‚klassischer‘ Whodunit- und Howcatchem-Dramaturgien. AVINUS-Magazin. Europäisches Online-Magazin für Medien, Kultur und Politik. http://www.avinus-magazin.eu/2016/08/17/hissnauer-christian-innovative-krimiserien-abseits-des-quality-tv/. Zugegriffen am 05.11.2019.
Hißnauer, Christian, Stefan Scherer, und Claudia Stockinger, Hrsg. 2014. Föderalismus in Serie. Die Einheit der ARD-Reihe „Tatort“ im historischen Verlauf. Paderborn: Fink.
Hißnauer, Christian. 2019. Der „Fernsehroman“ als Nobilitierungsversuch der Serie in den 1960er-Jahren: So weit die Füße tragen und Am grünen Strand der Spree. In Fernsehserie und Literatur: Facetten einer Medienbeziehung, Hrsg. Vincent Fröhlich, Lisa Gotto und Jens Ruchatz, 62–82. München: edition text+kritik.
Junklewitz, Christian, und Tanja Weber. 2016. Die Vermessung der Serialität: Wie Fernsehserien zueinander in Beziehung stehen. MEDIENwissenschaft 32(2): 8–24.
Kelleter, Frank. 2012. Populäre Serialität. Eine Einführung. In Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert, Hrsg. derselbe, 11–46. Bielefeld: transcript.
Kelleter, Frank, Hrsg. 2017. Five ways of looking at popular seriality. In Media of serial narrative, 7–34. Columbus: Ohio State University Press.
Kelleter, Frank, und Kathleen Loock. 2017. Hollywood remaking as second-order serialization. In Media of serial narrative, Hrsg. Frank Kelleter, 125–147. Columbus: Ohio State University Press.
Kelleter, Frank, und Daniel Stein. 2012. Autorisierungspraktiken seriellen Erzählens: Zur Gattungsentwicklung von Superheldencomics. In Populäre Serialität: Narration-Evolution-Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert, Hrsg. Frank Kelleter, 259–290. Bielefeld: transcript.
Klein, Thomas. 2007. Sterben in Serie. Die HBO-Produktion Six Feet Under. In medien – zeit – zeichen. Dokumentation des 19. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums 2006, Hrsg. Christian Hißnauer und Andreas Jahn-Sudmann, 116–124. Marburg: Schüren.
Klein, Thomas. 2012. Diskurs und Spiel. Überlegungen zu einer medienwissenschaftlichen Theorie serieller Komplexität. In Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert, Hrsg. Frank Kelleter, 225–239. Bielefeld: transcript.
Klein, Thomas, und Christian Hißnauer, Hrsg. 2012. Einleitung. In Klassiker der Fernsehserie, 7–26. Stuttgart: Reclam.
Krah, Hans. 2010. Erzählen in Folge. Eine Systematisierung narrativer Fortsetzungszusammenhänge. In Strategien der Filmanalyse – reloaded. Festschrift für Klaus Kanzog, Hrsg. Michael Schaudig, 85–114. München: diskurs film.
Kupper, Fabian. 2016. Serielle Narration. Die Evolution narrativer Komplexität in der US-Crime-Show von 1950–2000. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Kurotschka, Mara. 2007. Verschwimmende Grenzen von Realität und Fiktion: Eine Analyse von „Deutschland sucht den Superstar“. In Im Namen des Fernsehvolkes. Neue Formate für Orientierung und Bewertung, Hrsg. Katrin Döveling, Lothar Mikos und Jörg-Uwe Nieland, 117–153. Konstanz: UVK.
Liebnitz, Martina. 1992. Fernsehserien – Geschichte, Begriff und Kritik. Ein Literaturbericht. In Serie. Kunst im Alltag, Hrsg. Peter Hoff und Dieter Wiedemann, 148–168. Berlin: Vistas.
Loock, Kathleen, und Constantine Verevis, Hrsg. 2012. Film Remakes, Adaptations and Fan Productions: Remake/Remodel. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Lückerath, Thomas. 2018. „The Romanoffs“: Weiners neue Serie ist keine Serie. In dwdl.de vom 13 Oktober 2018. https://www.dwdl.de/meinungen/69178/the_romanoffs_weiners_neue_serie_ist_keine_serie/. Zugegriffen am 05.11.2019.
Mikos, Lothar. 1994. Es wird dein Leben! Familienserien im Fernsehen und im Alltag der Zuschauer. Münster: MAkS.
Mittell, Jason. 2012. Narrative Komplexität im amerikanischen Gegenwartsfernsehen. In Populäre Serialität: Narration – Evolution – Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert, Hrsg. Frank Kelleter, 98–122. Bielefeld: transcript.
Mittell, Jason. 2015. Complex TV. The poetics of contemporary television storytelling. New York/London: New York University Press.
Nelson, Robin. 2013. Entwicklung der Geschichte: vom Fernsehspiel zur Hypermedia TV Narrative. In Transnationale Serienkultur. Theorie, Ästhetik, Narration und Rezeption neuer Fernsehserien, Hrsg. Susanne Eichner, Lothar Mikos und Rainer Winter, 21–43. Wiesbaden: Springer VS.
Newcomb, Horace M. 1985. Magnum: The champagne of TV? Channels of Communication, 5(1): 23–26.
Newcomb, Horace. 2004. Narrative and genre. In The SAGE handbook of media studies, Hrsg. John D. H. Downing et al., 413–428. Thousand Oaks: Sage.
Schleich, Markus, und Jonas Nesselhauf. 2016. Fernsehserien. Geschichte, Theorie, Narration. Tübingen: Franke.
Schöberl, Joachim. 1980. Die Fernseh-Spielserie. Aspekte eines Genres fortgesetzter Unterhaltung. In Film und Fernsehen. Materialien zur Theorie, Soziologie und Analyse der audio-visuellen Massenmedien, Hrsg. Manfred Brauneck, 416–441. Bamberg: C. C. Buchners.
Stockinger, Claudia. 2018. An den Ursprüngen populärer Serialität. Das Familienblatt „Die Gartenlaube“. Göttingen: Wallstein.
Türschmann, Jörg. 2007. Spannung und serielles Erzählen. Vom Feuilletonroman zur Fernsehserie. In Gespannte Erwartungen, Hrsg. Kathrin Ackermann und Judith Moser-Kroiss, 201–219. Wien: LIT.
Türschmann, Jörg. 2008. Spannung in Zeitungsliteratur. Romananfang und serielles Erzählen am Beispiel des frühen französischen Feuilletonromans. In Zwischen Text und Leser. Studien zu Begriff, Geschichte und Funktion literarischer Spannung, Hrsg. Daniela Langer, Christoph Jürgensen und Ingo Irsigler, 225–246. München: edition text+kritik.
Weber, Tanja, und Christian Junklewitz. 2008. Das Gesetz der Serie: Ansätze zur Definition und Analyse. Medienwissenschaft 25/2008(1): 13–31.
Williams, Raymond. 2008 [1974]. Television. Technology and cultural form. Reprint. London/New York: Routledge.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2021 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Hißnauer, C. (2021). Serialität und Serienformen. In: Geimer, A., Heinze, C., Winter, R. (eds) Handbuch Filmsoziologie. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10729-1_100
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-10729-1_100
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-10728-4
Online ISBN: 978-3-658-10729-1
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)