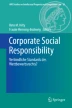Zusammenfassung
Die Vorschriften zur Verhinderung von Täuschungen durch geschäftliche Handlungen, im deutschen Gesetz zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (UWG) in den §§ 5 und 5a UWG zu finden, stehen regelmäßig im Mittelpunkt der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung unternehmerischer Aktivitäten im Bereich der Corporate Social Responsibility (CSR). Dieser Beitrag behandelt das Thema in drei Schritten. Er beginnt mit der Skizze zweier Grundpositionen zum Verhältnis von CSR und UWG (1). Danach folgt ein Überblick über die unterschiedlichen unternehmerischen Aktivitäten, die man mit dem Begriff CSR in Verbindung bringt und die Relevanz für das Unlauterkeitsrecht haben können (2). Der dritte Punkt, auf den ich mich konzentrieren will, ist die Frage nach einer etwaigen Verpflichtung der Unternehmen, über CSR-Maßnahmen zu informieren (3). Den Abschluss bildet ein Fazit in Thesenform (4).
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Notes
- 1.
Mit „green washing“ werden PR-Methoden bezeichnet, die darauf abzielen, einem Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen, ohne dass es dafür eine hinreichende Grundlage gibt. Vielfach geht es weniger um Tatsachen als vielmehr um die unterschiedliche Bewertung der Umstände durch die Unternehmen einerseits und gesellschaftlichen Gruppen, insbes. NGOs, andererseits.
- 2.
Unter einem normativistischen Fehlschluss versteht man ein moralisches Urteil, dass auf der Grundlage unzureichender Analyse der Tatsachen und der Wirklichkeit gefällt wird. Vgl. Suchanek, Ökonomische Ethik, 2. Aufl. 2007, 31 f.
- 3.
Zum ersten großen Kräftemessen zwischen einer NGO und Unternehmen kam es im Jahr 1995 im Fall des schwimmenden Öltanks (oft fälschlich als Ölplattform bezeichnet) „Brent-Spar“, der von Shell und ESSO im Atlantik betrieben wurde und nach den Plänen der Ölgesellschaften zunächst im Meer versenkt werden sollte. Nach Protesten von Greenpeace wurde die Ölplattform stattdessen an Land gebracht und in Norwegen verschrottet. Dabei waren, wie sich später herausstellte, die Angaben von Greenpeace über die giftigen Ölrückstände im Tank und damit die Gefahr für die Umwelt grob fehlerhaft.
- 4.
Vgl. Fezer, in: Fezer (Hrsg.), UWG, 2. Aufl. 2010, Einl. E Rn. 238 ff.; Peifer, in: Hilty/Henning-Bodewig (Hrsg.), Lauterkeitsrecht und Acquis Communautaire, 2009, 125 ff.
- 5.
Vgl. Peifer (Fn. 5), 143.
- 6.
So etwa der Diskussionsbeitrag von Ohly, in: Hilty/Henning-Bodewig (Fn. 5), S. 145.
- 7.
Wettbewerbsprozesse werden – man kann das m. E. auf einen Punkt bringen – dann verfälscht, wenn die „rationale“ oder „akkurate“ Entscheidung des Kunden massiv in Gefahr gerät, entweder in dem Kunden unzulässig beeinflusst, Konkurrent in ihren Marketingaktivitäten unzulässig behindert oder Vorteile durch Verstöße gegen rechtliche Marktverhaltensregelungen verschafft werden.
- 8.
Vgl. BVerfG GRUR 2001, 170 – Benetton I; GRUR 2003, 442 – Benetton II; GRUR 2002, 455 – Tier- und Artenschutz; BGH GRUR 2001, 1181 (1182) – Telefonwerbung für Blindenware; GRUR 2007, 247– Regenwaldprojekt I; GRUR 2007, 251– Regenwaldprojekt II.
- 9.
Vgl. aber Peifer (Fn. 5).
- 10.
So aber Fezer (Fn. 5), Einl. E Rn. 240.
- 11.
Nach Abstimmung mit dem Ko-Referenten, Hr. von Walther (in diesem Buch S. 187), konzentriere ich mich dabei auf die Frage nach den Informationspflichten über CSR. Diese Fokussierung kommt mir entgegen, da ich zu den anderen Problembereichen bereits in einem Beitrag in der GRUR (2011, 196 ff.) Stellung genommen habe.
- 12.
Vgl. etwa Blowfield/Murray, Corporate Responsibility, 2008, 12 ff.
- 13.
Henning-Bodewig, UWG und Geschäftsethik, WRP 2010, 1094 (1103).
- 14.
Vgl. Hansen, Studie: „Konsumentenorientierte Kommunikation über Corporate Social Responsibility“, Universität Hannover 2005, abrufbar unter: http://www.ub.uni-koeln.de/ssg-bwl/archiv/h/uh/muk/konsumorientierte_kommunikation_corporate.pdf (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 15.
Die G4-Leitlinien der Global Reporting Initiative sind abrufbar unter: https://www.globalreporting.org/languages/german/Pages/default.aspx (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 16.
Vgl. etwa Daimler, Nachhaltigkeitsbericht 2012 (Print-Version), 68.
- 17.
Zur PKW-EnVKV: Schabenberger/Amschewitz, (Keine) Pflicht zur Angabe von Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Werten in Werbeschriften für Automarken und Baureihen, WRP 2012, 669 ff.
- 18.
Die interne Zielgruppe sollen insbesondere die Mitarbeiter sein.
- 19.
Die bekanntesten Nachhaltigkeitsratingagenturen in Deutschland sind oekom research und imug. Die wichtigsten Nachhaltigkeitsindizes sind der Dow Jones Sustainability Index und der FTSE for goods.
- 20.
Köhler, in diesem Band auf S. Den Begriff „kommerzielle Kommunikation“ definiert Art. 2 lit. f E-Commerce-Richtlinie: „alle Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens … dienen“.
- 21.
Erwägungsgrund 7 S. 1 UGP-Richtlinie. Vgl. dazu Köhler, in: Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl. 2013, § 2 Rn. 45.
- 22.
Zum Begriff „objektiver Zusammenhang“ siehe Köhler (Fn. 21), § 2 Rn. 42, 48, 52. Der „objektive Zusammenhang“ verlangt in Bezug auf Mitbewerber, dass sich die geschäftliche Handlung „primär“ bzw. „gezielt“ auf die Konkurrenten bezieht.
- 23.
Siehe dazu www.corporate-governance-code.de (zuletzt aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 24.
Vgl. etwa Daimler (Fn. 16), 52. Es fehlt im wesentlichen nur die Verpflichtung zur Einhaltung der ISO 26000.
- 25.
Eine ausführliche Begründung findet sich in Birk, (Fn. 1), 196 ff.
- 26.
Prospekt der Biber Umweltprodukte Versand GmbH, Dornbirn (A), Beilage der SZ vom 4. Mai 2013.
- 27.
Vgl. IKEA Homepage, abrufbar unter http://www.ikea.com/ms/de_DE/about_ikea/our_responsibility/working_conditions/preventing_child_labour.html (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 28.
Bei IKEA geschieht dies etwa durch folgende Ergänzung „Kinderarbeit existiert in Ländern, in denen IKEA Produkte hergestellt werden. IKEA akzeptiert keine Kinderarbeit bei seinen Lieferanten oder deren Subunternehmern und arbeitet aktiv daran, sie zu verhindern.“
- 29.
Vgl. Nordemann, Wettbewerbsrecht – Markenrecht, 11. Aufl. 2012, Rn. 153 ff.
- 30.
Vgl. Birk, (Fn. 1), 196 ff.
- 31.
Verliehen vom Verein Transfair: http://www.fairtrade-deutschland.de/ (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 32.
Siehe http://www.fairwear.org/ (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 33.
BGH GRUR 2007, 247 – Regenwaldprojekt I; GRUR 2007, 251 – Regenwaldprojekt II.
- 34.
BGH GRUR 2007, 251 Rn. 22 – Regenwaldprojekt II.
- 35.
Dazu Bornkamm, Irrungen, Wirrungen – Der Tatbestand der Irreführung durch Unterlassen, WRP 2012, 1 ff. Es geht u. a. darum, ob ein irreführendes Unterlassen ausreicht oder ob zusätzlich eine Kausalität der fehlenden Information für die Kaufentscheidung zu fordern ist (echtes oder unechtes Unterlassungsdelikt).
- 36.
So wohl Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, (Fn. 21), § 5a Rn. 32a: „Informationen, bei denen es nicht unmittelbar um Produktmerkmale, sondern um wichtige außerhalb des konkreten Produkts liegende Informationen handelt, fallen eher nicht unter § 5a Abs. 3 Nr. 1 UWG, sondern unter § 5a Abs. 2 UWG.“
- 37.
So Sosnitza, in: Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl. 2010, § 5a Rn. 26; Peifer (Fn. 5), 141. Die Zuordnung macht einen gewissen Unterschied, weil es in Abs. 2 um „wesentliche Informationen“, in Abs. 3 um „wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung“ geht.
- 38.
Dazu Bornkamm, Irrungen, Wirrungen – Der Tatbestand der Irreführung durch Unterlassen, WRP 2012, 1 ff.; ders. (Fn. 21), § 5a Rn. 55 ff.; Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig (Hrsg.), UWG, 3. Aufl. 2013, § 5a Rn. 81 ff.; Fezer, Lebensmittelimitate, gentechnisch veränderte Produkte und CSR-Standards als Gegenstand des Informationsgebots im Sinne des Art. 7 UGP-RL – Lauterkeitsrechtliche Informationspflichten nach § 5a UWG zum Schutz vor irreführender Lebensmittelvermarktung, WRP 2010, 577 (582).
- 39.
BGH GRUR 2012, 1275– Zweigstellenbriefbogen; Bornkamm, Irrungen, Wirrungen – Der Tatbestand der Irreführung durch Unterlassen, WRP 2012, 1; ders. (Fn. 36), § 5a Rn. 29b ff.; Peifer, in: Fezer (Hrsg.), UWG, 2. Aufl. 2010, § 5a Rn. 14; Nordemann (Fn. 29), Rn. 383 f.; Dreyer (Fn. 38), § 5a Rn. 59 ff.
- 40.
Letzteres bringt Art. 7 Abs. 3 UGP-Richtlinie deutlich zum Ausdruck, wenn es dort heißt, dass bei der Entscheidung darüber, ob Informationen vorenthalten wurden, die räumlichen oder zeitlichen Beschränkungen des verwendete Kommunikationsmediums sowie die Maßnahmen, die der Gewerbetreibende getroffen hat, um den Verbrauchern die Informationen anderweitig zur Verfügung zu stellen, zu berücksichtigen sind.
- 41.
BGH GRUR 2012, 1275– Zweigstellenbriefbogen.
- 42.
Vgl. Sosnitza (Fn. 37), Rn. 26.
- 43.
Vgl. Bornkamm (Fn. 21), § 5a Rn. 32.
- 44.
Vgl. Peifer (Fn. 39), § 5a Rn. 17 ff.
- 45.
So insbes. Fezer (Fn. 5), 240; ders., Das Informationsgebot der Lauterkeitsrichtlinie als subjektives Verbraucherrecht, WRP 2007, 1021 (1022).
- 46.
BGH GRUR 2010, 852 – Gallardo Spyder (Rn. 16). Der BGH beruft sich zur Begründung auf Art. 2 lit. e UGP-Richtlinie. Der Wortlaut der Vorschrift lässt aber sowohl eine Verengung auf rein wirtschaftliche Interessen als auch eine Ausdehnung auf ideelle Interessen zu.
- 47.
Vgl. Birk, (Fn. 1), 196 ff.
- 48.
Vgl. Wolff/Moser, in: Moser (Hrsg.), Wirtschaftspsychologie, 2007, Kap. 3.5.1.
- 49.
Mit trade-off bezeichnet man die Situation, dass selten ein Produkt alle gewünschten Eigenschaften in sich vereint. Mit der Entscheidung für ein Produkt entscheidet man sich in der Praxis zugleich gegen ein anderes Produkt, das in einer entscheidungsrelevanten Eigenschaft besser ist.
- 50.
Käufe finden in einem sozialen Kontext statt, in dem man sich für seine Entscheidung rechtfertigen muss.
- 51.
Vgl. Solomon, Konsumentenverhalten, 9. Aufl. 2012, Kap. 8; Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, 10. Aufl. 2013, 2. Teil Abschnitte C und D.
- 52.
Sachverhalt zitiert nach Bowoto vs. Chevron, Court of Appeals ND California, No. 09-15641, D.C. No. 3:99-cv-02506-SI (June 14, 2010) führte in den USA zu einem sog. „Alien Tort Claim“.
- 53.
BGH NJW 1972, 1366; NJW 1998, 377.
- 54.
BVerfG NJW 1985, 2395; VGH Mannheim, VBlBW 1997, 187; NVwZ-RR 2008, 700; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 14. Aufl. 2008, § 6 I.
- 55.
Vgl. Menke/Pollmann, Philosophie der Menschenrechte, 3. Aufl. 2012, I.1. (30).
- 56.
UN Global Compact, abrufbar unter: http://www.unglobalcompact.org/ (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013); OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen, Text abrufbar unter: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsatzefurmultinationaleunternehmen.htm (zul. aufgerufen am 16.Oktober 2013); ISO 26000, Informationen dazu abrufbar unter: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 57.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UN Resolution 217 A (III) vom 10. Dezember 1948.
- 58.
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 (BGBl. 1973 II 1553); Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966 (BGBl. 1973 II, 1569).
- 59.
Vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, Loseblatt, Stand: November 2013, Art. 1 Abs. 3 Rn. 59 ff.; seit BVerfG, NJW 1958, 254 ständige Rechtsprechung.
- 60.
Vgl. Ruggie, Protect, respect and remedy: a Framework for Business and Human Rights, vom 7. April 2008, A/HRC/8/5, Download: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013); Ruggie, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations „Protect, Respect and Remedy“ Framework, vom 21. März 2011, A/HRC/17/31, Download: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 61.
Vgl. von Bernstorrf, Die UN Guiding Principles on Business and Human Rights – Ein Kommentar aus völkerrechtlicher Sicht, Vortrag auf der Konferenz des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Universität Essen-Duisburg vom 24./25. November 2012 in Berlin, abrufbar unter: http://www.unesco.de/uho_1112_keynote_bernstorff.html (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
- 62.
Vgl. nur Jarass, in: Jarass/Pieroth (Hrsg.), Grundgesetz, 12. Aufl. 2012, Vorb. vor Art. 1 Rn. 14 ff.
- 63.
Vgl. Fezer, (Fn. 38), 577 (580) unter II. 3. c) bb).
- 64.
Auch in vermeintlich technischen Bereichen ist in der Regel eine komplexen Folgenabwägung und Folgenbewertung nötig. Beispielhaft sei dazu auf den in Fn. 4 erwähnten Fall „Brent Spar“ verwiesen.
- 65.
Dieses Problem wird momentan in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vielfach diskutiert. Vgl. etwa Wieland, Globale Standards und Global Commons, in: Forum Wirtschaftsethik 2012, 62 ff., ders., Corporate Social Responsibility – Die Aufgaben privater und öffentlicher Akteure, in: Wieland (Hrsg.), CSR als Netzwerkgovernance, 2009, 7 ff.; Jastram, Legitimation privater Governance, 2012. Zur Legitimation „privater Governance“ werden im wesentlichen, zum Teil etwas naiv, basis- bzw. direktdemokratische Argumente (man spricht heute von Netzwerken) verwendet. Die Probleme, welche basisdemokratische Entscheidungen verursachen, sind aber seit langem bekannt: vgl. dazu Schmidt, Demokratietheorien, 5. Aufl. 2010, Kap. 14; Kirsch, Neue politische Ökonomie, 5. Aufl. 2004, Kap. VI; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 7. Aufl. 2013, Rn. 73.
- 66.
Vgl. ebenso die Bedenken von Palazzo, Die Privatisierung von Menschenrechtsverletzungen, in: Wieland (Hrsg.), CSR als Netzwerkgovernance, 2009, 17 (33).
- 67.
Vgl. Wieland (Rn. 65), 62 ff.
- 68.
So wird das Verhältnis zwischen nationalem Recht und internationalem soft law unterschiedlich bewertet: Ruggie geht von einem Vorrang des UN Global Compact aus, die OECD-Leitsätze postulieren einen Vorrang nationalen Rechts. Vgl. einerseits Ruggie (Fn. 60), Nr. 11 (Rn. 58), andererseits die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, I. 2. Deutlich differenzierter die ISO 26000 unter 4.6–4.8.
- 69.
Siehe oben Fn. 65.
- 70.
Wie schnell sind die Skandale, welchen Unternehmen in den Medien vorgeworfen werden, wieder vergessen und der Kunde kehrt zu seinen alten Gewohnheiten wieder zurück.
- 71.
Der Anteil sozialökologisch orientierter Verbraucher beträgt nach der neusten Sinus-Milieu-Studie von 2013 etwa 7 %. Abrufbar unter: http://www.sinus-institut.de/loesungen/ (zul. aufgerufen am 16. Oktober 2013).
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Birk, A. (2014). Irreführung über CSR – Informationspflichten über CSR?. In: Hilty, R., Henning-Bodewig, F. (eds) Corporate Social Responsibility. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, vol 21. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54005-9_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-54005-9_12
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-54004-2
Online ISBN: 978-3-642-54005-9
eBook Packages: Humanities, Social Science (German Language)