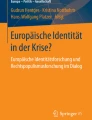Auszug
Identität als Problem interdisziplinärer Forschung und Reflexion erlebte in den Jahren um 1980 eine Hochkonjunktur und erfreut sich seitdem ungebrochener Beliebtheit. Identität oder durch diverse Adjektive gewürzte Verbindungen sind „magische Worte“1 geworden, die sich durch die Reduktion des semantischen und eine dramatische Steigerung des affektiven Gehalts auszeichnen. Solche magischen Worte scheinen in unserer durch rasche Veränderung geprägten Zeit, die von atavistischen Geistern nationalistischer und fundamentalistischer Provenienz geplagt wird, deren Gesellschaften als Risiko- oder Erlebnisgesellschaften bezeichnet werden, einen eigenartigen Zauber auszuüben. Obwohl dem Begriff nicht mehr als „connotative significance“2 zukommt, scheint es sich um einen Schlüsselbegriff zu handeln, dessen Nutzen gerade in seiner Mehredeutigkeit und seiner spezifischen Appellqualität liegt. Im Zuge neoliberaler Globalisierungsdiskussionen wird eine Spielart kollektiver Identität, die nationale, von den einen als Hindernis auf dem Weg zur wahren, meist ökonomischen, Weltgesellschaft, von den anderen als letzte Bastion der Bewahrung und Garantie individueller Rechte gesehen. Der Begriff selbst erscheint nicht als „essentially contested“3; vielmehr ist seine Verwendung durch Vertrauen auf die Erklärungskraft der Wiederholung gekennzeichnet.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Similar content being viewed by others
Literatur
E. Cassirer, Der Mythus des Staates: Philosophische Grundlagen politischen Verhaltens, Frankfurt a.M. 1985, 368.
R. Robertson/ B. Holzner, Identity and Authority. Explorations in the Theory of Society, Oxford 1980, 2.
W.B. Gallie, „Essentially Contested Concepts“, 56 Proceedings of the Aristotelian Society 1956, 167–198.
Anstatt vieler: P. Katzenstein (Hrsg.), The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics, New York 1996; Y. Lapid/F. Kratochwil (Hrsg.), The Return of Culture and Identity, in: International Relations Theory, Boulder 1996; B. Laffan, „The Politics of Identity and Political order in Europe“, 34 Journal of Common Market Studies 1996, 81–102.; I.B. Neumann, Self and Other in International Relations, 2 European Journal of International Relations 1996, 139–174; P. Goff/K. Dann (eds.), Identity and Global Politics. Theoretical and Empirical Elaborations, Houndmills 2004.
F. Fukuyama, The end of history and the last man, New York 1992.
S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York 1996.
B. Barber, Jihad vs. McWorld, New York 1996.
In der Integrationstheorie der 50er Jahre wurde die europäische Einigung immer schon eng an die Entstehung einer tragfähigen kollektiven Identität gekoppelt. Vgl. dazu B. Locher-Dodge, „Identitätsexperiment Europa: Geschlecht und supranationale Integration“, Paper für die Tagung „Europa zwischen Integration und Ausschluß“, Wien, Juni 1998.
Ebenda, 2.
O. Marquard, „Identität in Schwundtelos und Mini-Essenz — Bemerkungen zur Genealogie einer aktuellen Diskussion“, in: O. Marquard/ K. Stierle (Hrsg.), Poetik und Hermeneutik, Bd. VII, München 1979, 347; vgl. dazu auch W.R. Brubaker/F. Cooper, „Beyond ‘identity’“, 29 Theory and Society 2000, 1–47; L. Niethammer, „Kollektive Identität“ — Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur, Reinbek bei Hamburg 2000 hat aufgrund der unscharfen Konturen zu einer Aufgabe des Begriffspaares „kollektive Identität“ geraten.
B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1983.
A.D. Smith, National Identity, London 1991.
J.M. Guéhenno, Das Ende der Demokratie, München 1994, 39.
P. Fuchs u.a. (Hrsg.), Lexikon zur Soziologie, Opladen 1988.
Hier soll Hermann Heller, Gesammelte Schriften, 3. Band, hrsg. v. M. Drath/ G. Niemeyer/ O. Stammer/ F. Borinski, Leiden 1971, 195 gefolgt werden: „Mit pedantischer Genauigkeit und dringender als je muß an dieser Stelle darauf bestanden werden, daß gesellschaftliche Wirklichkeit unter keinen Umständen als etwas anderes gedacht werden darf denn als menschliche Wirksamkeit.“ Auch für den Antipoden Rudolf Smend, „Verfassung und Verfassungsrecht“, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlin 1955 ist an den Beginn einer „Staatsuntersuchung“ das Individuum zu stellen: Der Staat ist bei Smend das „Einheitsgefüge der Sinnerlebnisse“, er ist keine reine Zweckschöpfung, sondern eine Existenzweise und geistige Lebensgemeinschaft von Individuen. Dass der Staat keine starre, ruhende Substanz, sondern geistige Gemeinschaft ist entspricht der Lehre Theodor Litts, Individuum und Gemeinschaft, 3. Aufl., Leipzig 1926, 234, vom Erlebnisgefüge als Wesen des geschlossenen Kreises.
L. Krappmann, Soziologische Dimensionen der Identität, Stuttgart 1971, 9.
G. Deleuze/ F. Guttari, Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie, Frankfurt a.M. 1988.
Selbst Thomas Hobbes’ Leviathan besteht aus einzelnen Individuen, ihm kommt also keine eigene Körperlichkeit zu. Vgl. dazu H. Bredekamp, Thomas Hobbes visuelle Strategien, Berlin 2002. Siehe dazu auch die Hobbes vorangehende mittelalterliche Korporationslehre, J. Pollak, Repräsentation ohne Demokratie, Wien/New York 2007.
C. Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philosophie, Frankfurt a.M. 1990.
So schon bei Smend Verfassung und Verfassungsrecht“, in: Rudolf Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlin 1955 (Fn. 15), 136 nachzulesen. Das Volk als Subjekt der Geschichte, als nichtstaatliche ethnische Einheit muss sich in seiner Eigenheit und Besonderheit geschichtsgeformt und geschichtsbestimmt durch einen Akt des Selbstbewusstseins und des Willens bejaht haben, um den Staat konstituieren zu können. Die empirische Wirklichkeit des Staates besteht in seinen faktischen Lebensäußerungen; in Gesetzen, diplomatischen Akten und anderen Äußerungen spiegelt sich dieser Lebens-und Erlebenszusammenhang. Der Staat „lebt und ist nur da in diesem Prozeß beständiger Erneuerung, dauernden Neuerlebtwerdens“.
M. Bloch, „Mémoire collective, tradition et coutume“, Revue de Synthèse Historique 1925, 73–83, 73.
P.L. Berger/ T. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt a.M. 1969 sprechen von der Selbigkeit der Sinnwelten; siehe dazu auch H. Schneider, „Patriotismus und Nationalismus“, Concilium 1995, 499–509.
J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992, 17.
Vgl. T. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt a.M. 1969 Berger/Luckmann (Fn. 22), 20.
Assmann (Fn. 23), 138.
J. Habermas, „Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?“, in: ders./D. Henrich, Zwei Reden. Aus Anlass des Hegel-Preises, Frankfurt a.M. 1974, 29.
O. Ranum, „Counter-Identities of Western European Nations in the Early-Modern Period: Definitions and Points of Depature“, in: P. Boerner (Hrsg.), Concepts of national identity — an interdisciplinary dialogue, Baden-Baden 1986, 63–78, 63f.
B. Giesen, „Intellektuelle, Politiker und Experte: Probleme der Konstruktion einer europäischen Identität“, in: B. Schäfers (Hrsg.), Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa: Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages in Düsseldorf 1992, Frankfurt a.M./New York 1992, 492–504, 494.
P.R. Hofstätter, Gruppendynamik, Neuausg. Reinbek bei Hamburg 1972, 108ff..
Berger/Luckmann T. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt a.M. 1969 (Fn. 22), 53f.
Damit ist hier v.a. ein sog. Generationengedächtnis gemeint und keine Erinnerungsgemeinschaft wie sie von P. Kielmansegg, „Integration und Demokratie“, in: M. Jachtenfuchs/ B. Kohler-Koch (Hrsg.), Europäische Integration, Opladen 1996, 47–72, 55 angesprochen wird.
J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 4. Aufl., Frankfurt a.M. 1981, 175, der die Ausbildung vernünftiger Identität an die Chance der Teilnahme an einem Verständigungsprozess koppelt, sieht das „normative Grundeinverständnis“ folgerichtig als ein Kennzeichen nicht differenzierter Gesellschaften. Mit der „Kolonisierung der Lebenswelt“ durch funktional organisierte Steuerungssysteme kann die Integration moderner Gesellschaften nur mehr „über den systemischen Zusammenhang funktional spezifizierter Handlungsbereiche“ erfolgen. Intergration via „grand narratives“ ist damit unmöglich geworden.
Habermas Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?“, in: J. Habermas/ D. Henrich, Zwei Reden. Aus Anlass des Hegel-Preises, Frankfurt a.M. 1974 (Fn. 26), 74.
K.J. Gergen, „Social Psychology and the Wrong Revolution“, 19 European Journal of Social Psychology 1989, 463–484; ders./K.E. Davis (Hrsg.), The Social Construction of the Person, New York 1985; ders., „Correspondance versus Autonomy in the Language of Understanding Human Action“, in: D. Fiske/R. Shweder (Hrsg.), Metatheory in Social Science, Chicago 1986.
Auch B. Giesen Intellektuelle, Politiker und Experte: Probleme der Konstruktion einer europäischen Identität“, in: B. Schäfers (Hrsg.), Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa: Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages in Düsseldorf 1992, Frankfurt a.M./New York 1992 (Fn. 28), 492 fasst kollektive Identität als Konstruktion: „Auch wenn sie den Mitgliedern einer Gemeinschaft als elementar und natürlich erscheint, ist kollektive Identität nicht natürlich gegeben, sondern wird in bestimmten Situationen sozial konstruiert“; siehe dazu auch Baecker u.a., „Sozialer Konstruktivismus — eine neue Perspektive in der Psychologie“, in: S.J. Schmidt (Hrsg.), Kognition und Gesellschaft — Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 1992, 116–145.
Vgl. J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt a.M. 1992, 441ff.
B. Peters, „Der Sinn von Öffentlichkeit“, in: F. Neidhardt (Hrsg.), Öffentlichkeit, Öffentliche Meinung, Soziale Bewegungen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 34, Opladen 1994, 42–76, 47. Die Öffentlichkeit konstituiert also den Rahmen des Spiegels, den sich die Gesellschaft vorhält. In modernen Gesellschaften konstituiert sich Öffentlichkeit als massenmedial hergestellte Öffentlichkeit. Die große Zahl an teilnehmenden Akteuren oder Kommunikationsbeiträgen erzwingt per se eine Asymmetrie von Sprecher-und Hörerrollen. Im idealtypischen Modell der Öffentlichkeit kann von einem einheitlichen, überschaubaren Teilnehmerkreis ausgegangen werden. In der Realität ist die öffentliche Sphäre aber aus einer „Vielzahl von Kommunikationszusammenhängen, die sich entweder im Rahmen bestimmter vorgegebener Vergesellschaftungen entfalten (...) oder die sich konstituieren im Hinblick auf jeweils aktuelle Themen“, zusammengesetzt, vgl. Peters (Fn. 39), 56. Daraus resultiert die Differenzierung des Teilnehmerkreises in zahlreiche soziale Gruppierungen wie z.B. Parteien oder Vereinen, deren Zugang durch unterschiedliche Ressourcen geprägt ist.
Vgl. dazu E. Voegelin, Die Neue Wissenschaft der Politik. Eine Einführung, 4. Aufl., München 1991. Voegelin unterschied zwischen deskriptivem und existentiellem Typus der Repräsentation. Ersterer beinhaltet einfache demographische Daten der Außenwelt, z.B. beziehen sich diese Daten auf geographische Bezirke, auf Männer und Frauen, deren Alter, auf Wahlakte etc. Der deskriptive Typus der Repräsentation ist die Beschreibung der äußeren Realisierung einer politischen Gesellschaft. Der Typus der existentiellen Repräsentation ist die Verwirklichung der Idee der Institutionen. Voegelin stützt sich hier auf die Repräsentationstheorie von Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris 1929.
M. Halbwachs, Les cadres so ciaux de la mémoire, Paris 1925.
Siehe z.B. P. Connerton, How Societies Remember, Cambridge 1989; J. Fentress, Social Memory, Oxford 1992.
J.G. Droysen, „Historik“, hrsg. von P. Leyh, Nr. 10, Stuttgart-Bad Cannstadt, 1977, 45.
E. Cassirer, Der Mythus des Staates: Philosophische Grundlagen politischen Verhaltens, Frankfurt a.M. 1985, 371; vgl. auch S. Schama, Landscape and Memory, New York 1996.
M. Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Frankfurt a.M. 1985, 209f.
Assmann (Fn. 23); ders./Hölscher T. (Hg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a.M. 1988.
Assmann (Fn. 23), 52.
Giesen Intellektuelle, Politiker und Experte: Probleme der Konstruktion einer europäischen Identität“, in: B. Schäfers (Hrsg.), Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa: Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages in Düsseldorf 1992, Frankfurt a.M./New York 1992 (Fn. 28), 495. Ein Kennzeichen moderner Gesellschaften ist die dominante Stellung textueller Kohärenz: Nicht mehr die exakte Wiederholung steht im Zentrum der Vergegenwärtigung des kulturellen Gedächtnisses, sondern der Text. „An die Stelle der Liturgie tritt die Hermeneutik“, vgl. Assmann (Fn. 23), 18. Texte und deren Interpretationen bilden so einen Kanon. Das Konzept des Kanons trifft ohne Frage für prämoderne Gesellschaften zu. Moderne Gesellschaften hingegen, mit ihrer Vielzahl an Deutungs-und Zugehörigkeitsstrukturen, verweigern so etwas wie eine „Bestandsaufnahme“ des Kanons. Als Prinzip einer kollektiven Identitätsstiftung und-stabilisierung erscheint er unbrauchbar. Kollektive Identität mittels eines Kanons greifbar zu machen, wäre nur ein Versuch, die Prozesshaftigkeit kollektiver Identität und damit kommunikativer Sinnwelt für einen Augenblick zu unterbrechen, um eine kaum erschöpfende Auflistung der Designata zu ermöglichen.
Vgl. P. Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt 1990, 211.
R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M. 1979.
E. Gellner, Nationalismus und Moderne, Berlin 1991, 89.
K.A. Appiah, „Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction“, in: A. Gutman (Hrsg.), Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition, Princeton 1994, 149–163 hat auf den Aspekt der Unterdrückung durch kollektive Identität hingewiesen.
Schneider (Fn. 22), 505.
Voegelin (Fn. 40), 81.
Was C. Kluckhohn und H.A. Murray (Hrsg.), Personality in Nature, Society and Culture, New York 1948, 35 in Bezug auf die individuelle Identität schrieben, gilt auch für Kollektive: “Every man is in certain respects: a) like all other men, b) like some other men, c) like no other men”. Heute ist es v.a. der feministischen Debatte über Identität zu verdanken, dass die Aufmerksamkeit auf die Heterogenitäten innerhalb kollektiver Identität und den geschlechtsspezifischen Charakter von nationaler Identität gelenkt wird, vgl. J. Krause/N. Renwick (Hrsg.), Identities in International Relations, New York 1996; D. Kandiyoti, „Identity and its Discontent: Women and the Nation“, 20 Millennium 1991, 429–443.
M. Foucault hat in The Archaeology of Knowledge, London 1972 diesen Anspruch auf Konsistenz entlarvt.
Habermas Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?“, in: J. Habermas/ D. Henrich, Zwei Reden. Aus Anlass des Hegel-Preises, Frankfurt a.M. 1974 (Fn. 26), 51.
Siehe A. Somek, „Europa als Rechtsgemeinschaft“, in: M. Mokre/ G. Weiss/ R. Bauböck (Hrsg.), Europas Identitäten. Mythen, Konflikte, Konstruktionen, Frankfurt a.M. 2003, 207–230; vgl. dazu auch U. Halterns Abhandlung über das Thema Grundrechte und Identität: Europarecht und das Politische, Tübingen 2005, 351ff.
E. Hobesbawm/ T. Ranger (Hrsg.), The Invention of Tradition, Cambridge 1992.
Vgl. dazu B. Laffan, „The European Union and its institutions as ‘identity builders’“, in: R.K. Herrmann/ T. Risse/ M.B. Brewer (Hrsg.), Transnational Identities. Becoming European in the EU, Lanham 2004, 75–96; R.M. Lepsius, „Prozesse der europäischen Identitätsstiftung“, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 38), 2004, 3–5.
In der Literatur ist zumeist die Rede von der europäischen Seele (z.B. A. Holl, „Kapitalismus und Spirituaöität“, in: K.P. Liessmann/ G. Weinberger (Hrsg.), Perspektive Europa. Modelle für das 21. Jahrhundert, Wien 1999, 18–26), die erwachen müsse (P. Sloterdijk, Falls Europa erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence, Frankfurt a.M. 2002). So stellte Dominique Moisi, „Dreaming of Europe“, 115 Foreign Policy 1999, 44–61 denn auch fest, Europa befinde sich in einer Phase des „soul searching.
Abgedruckt in: Europa-Archiv, Nr. 5, 1974, D51ff.
J.H.H. Weiler, „Federalism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg“, in: K. Nicolaides/ R. Howse (Hrsg.), The Federal Vision. Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the European Union, Oxford 2000.
Allgmein dazu z.B. H. Vorländer (Hrsg.), Integration durch Verfassung, Opladen 2002; U. Haltern, „Integration als Mythos“, 45 Jahrbuch des Öffentlichen Rechts 1997, 31–88; C. Sunstein, Designing Democracy. What Constitutions Do?, Oxford 2001.
Smend Verfassung und Verfassungsrecht“, in: Rudolf Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlin 1955 (Fn. 15).
T. Litt, Individuum und Gemeinschaft, 3. Aufl., Leipzig 1926.
D. Grimm, „Integration durch Verfassung“, Vortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin am 12.7.2004, abgedruckt in: Forum Constitutionis Europae FCE6/04, Berlin 2004.
Ebenda, 7.
Siehe dazu etwa H. Heller, Staatslehre, in der Bearbeitung von G. Niemeyer, 6. Aufl., Tübingen 1983 (orig. 1934, 66); ferner auch W. Hennis’ Warnung vor der teleokratischen Fixierung.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 2008 VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Pollak, J. (2008). Ist eine europäische Identität möglich? Oder: Warum wir lernen sollten, Zwiebeln zu lieben. In: Joerges, C., Mahlmann, M., Preuß, U.K. (eds) „Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit“ und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90989-9_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90989-9_5
Publisher Name: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Print ISBN: 978-3-531-15414-5
Online ISBN: 978-3-531-90989-9
eBook Packages: Humanities, Social Science (German Language)