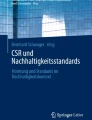Auszug
Der rechtliche Schutz von Menschenrechten in Europa wirft eine Reihe von schwierigen Problemen auf. Ein wichtiges Gebiet bildet dabei die Auseinandersetzung um die Substanz konkreter rechtlicher Verbürgungen, vom Gehalt klassischer liberaler Freiheitsrechte bis zur Menschenwürde selbst. Diese wird etwa im Rahmen der Herausforderungen, die der Kampf gegen terroristische Bedrohungen oder das umkämpfte Gebiet der Bioethik schafft, in neuer Weise grundsätzlich reflektiert.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Similar content being viewed by others
Literatur
Vgl. etwa England, dem klassischen common law Ansatz (und seinen Schwächen) und dem Human Rights Act, A.W. Bradley/ K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 13. Aufl., Harlow/New York 2003, 403ff.
Vgl. BVerfGE 37, 271, 280ff.; 73, 339, 387; 89, 155, 175; 102, 147.
BVerfGE 101, 361.
Vgl. BVerfGE 111, 307.
Vgl. zur aktuellen Diskussion z.B. H.-J. Papier, „Koordination des Grundrechtsschutzes in Europa — die Sicht des Bundesverfassungsgerichts“, ZSchR 2005, 113ff; E. Benda, „Die Bindungswirkung von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte“, AnwB1 2005, 602ff; S. Kadelbach, „Der Status der Europäischen Menschenrechtskonvention im deutschen Recht“, Jura 2005, 480ff; J. Bergmann, „Diener dreier Herren? — Der Instanzrichter zwischen BVerfG, EuGH und EGMR“, EuR 2006, 101ff.
Vgl. I-9 Abs. 2 Vertrag über eine Verfassung von Europa, Abl. Nr. C 310 vom 16.12.2004.
BVerfGE 111, 307, 329.
H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, zitiert nach der dt. Taschenbuchausgabe, München 2005, 604ff.
Ebenda, 619.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, 619f.
Ebenda, 607ff, 614.
Das Recht, Rechte zu haben, sei gleichbedeutend damit, „in einem Beziehungssystem zu leben, in dem man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird“, ebenda, 614.
Ebenda, 612ff.
Vor der Ausstoßung von ganzen Gruppen von Menschen, „wurde das, was wir heute als ein ‘Recht’ zu betrachten gelernt haben, eher als ein allgemeines Kennzeichen des Menschseins angesehen und die Rechte, die hier verloren gehen, als menschliche Fähigkeiten. Der Verlust der Relevanz und damit der Realität des Gesprochenen involviert in gewissem Sinne den Verlust der Sprache, zwar nicht in einem physischen Sinne, wohl aber in dem Sinne, in dem Aristoteles den Menschen als ein Lebewesen definierte, das sprechen kann; denn hiermit meinte er nicht die physische Kapazität, die auch Barbaren und Sklaven zukam, sondern die Fähigkeit, im Zusammenleben durch Sprechen, und nicht durch Gewalt, die Angelegenheiten des menschlichen und vor allem des öffentlichen Lebens zu regeln. Die Narrenfreiheit der Internierungslager wie die Verfolgungen, die unabhängig sind von dem, was einer sagt und meint, machen gleicherweise den Betroffenen mundtot in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Und an diesen Verlust reiht sich der Verlust der öffentlich gesicherten Gemeinschaft überhaupt, der Fähigkeit zum Politischen, die wie immer man sie deutete, seit Aristoteles ebenfalls als ein Kennzeichen des Menschseins überhaupt galten. Hier treten mit anderen Worten Verluste ein, die wir im Sinne der abendländischen Tradition nur als Verlust einiger des essentiellen Charaktere des menschlichen Lebens überhaupt verstehen können“, ebenda, 614f.
Ebenda, 616.
„Dies abstrakte Menschenwesen, das keinen Beruf, keine Staatsangehörigkeit, keine Meinung und keine Leistung hat, durch die es sich identifizieren und spezifizieren könnte, ist gleichsam das genaue Gegenbild des Staatsbürgers, dessen Ungleichheit und Undifferenziertheit dauernd innerhalb der politischen Sphäre von dem großen Gleichmacher aller Unterschiede, der Staatsbürgerschaft selbst eingeebnet werden; denn wiewohl der Rechtlose nichts ist als ein Mensch, ist er dies gerade nicht durch die gegenseitig sich garantierende Gleichheit der Rechte, sondern in seiner absolut einzigartigen, unveränderlichen und stummen Individualität, der der Weg in die gemeinsame und darum verständliche Welt dadurch abgeschnitten ist, daß man ihn aller Mittel beraubt hat, seine Individualität in das Gemeinsame zu übersetzen und in ihm auszudrücken. Er ist gleichzeitig der Mensch und das Individuum überhaupt, das allerallgemeinste und das allerspeziellste, das beides gleichermaßen abstrakt ist, weil es gleichermaßen weltlos bleibt“, ebenda, 623f. Man mag bei G. Agamben, Homo Sacer, Frankfurt a.M. 2002 und seiner Idee vom „nackten Leben“ an diese Gedanken Arendts erinnert werden.
Ebenda, 624.
Ebenda, 617ff.
Die historischen Rekonstruktionen zum Ursprung des Totalitarismus beziehen sich immer wieder positiv auf eine lebendige Idee der Menschheit als Mittel der Verbindung der Menschen, vgl. z.B. a.a.O., 483 (zur Menschheit als regulative Idee aller Politik), 498ff; 946.
Das Verhältnis Arendt/Heidegger ist das Thema vieler Beiträge, natürlich auch aus biografischen Motiven. Zu einem Selbstzeugnis, das emphatisch die Bedeutung Heideggers betont vgl. J. Fest, Begegnungen, Reinbek 2004, 176ff; D.R. Villa, Arendt and Heidegger, Princeton, NJ 1996, 115 hält fest: “Few would contest the notion that Arendt was influenced by Heidegger: her debt has often been noted, although often in quite vague terms. Specific consideration tends to occur in the course of assessing the liabilities, even’dangers,’ of her political theory: those aspects that seem most questionable are, predictably, traced back to Heidegger. (...) I think the appeal to Heidegger as a way of establishing guilt by association is both interpretively dubious and intellectual lazy”, Worauf es ankommt — das ist der richtige Kern dieser Äußerungen — ist der konstruktive Wert der Argumente, die sich aus der Rezeption von Heideggers Theorie ergeben, die Villa selbst überschätzt.
J. Habermas, „Heidegger — Werk und Weltanschauung“, in: V. Farías, Heidegger und der Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1989, 13.
Vgl. zum In-der-Welt-sein als Existenzial, M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1984, 52ff.
Vgl. zu H. Arendts Begriff des hierbei zentralen Begriffs des „Handelns“, a.a.O., 956 und umfassend in H. Arendt, Vita Activa, München 2002.
Vgl. zum philosophischen Programm Heideggers, M. Mahlmann, „Heidegger’s political philosophy and the theory of the liberal state“, 14 Law and Critique 2003, 229ff. Heideggers Philosophie in ihrer sich wandelnden Form, insbesondere bis zur “Kehre”, ist nicht intrinsisch nazistisch. Derartige Kritiken, inspiriert von Heideggers politischem Engagement für die nationalsozialistische Bewegung, verfehlen die Schwierigkeit und den philosophischen Kern der Sache. Die ontologisierende politische Anthropologie Heideggers düngt vielmehr einen Boden, auf dem auch der Nationalsozialismus zwar nicht notwendig wachsen musste, aber zu leicht wachsen konnte.
Vgl. J. Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, Cambridge, Mass. 2000, 366.
Vgl. R. Rorty, „Human Rights, Rationality, and Sentimentality“, in: S. Shute/ S.L. Hurley (Hrsg.), On Human Rights, New York, 1993, 122ff.
In der deutschen Diskussion regelmäßig mit Rückgriff auf Böckenfördes bekanntes Diktum, ders., „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation“, in: ders., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M. 1991, 112.
Vgl. etwa C. Enders, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung, Tübingen 1997, 177.
R. Forst, Toleranz im Konflikt, Frankfurt a.M. 2003, 592ff.
Vgl. dazu eindringlich J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt a.M. 2001, 124f.
Vgl. J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt a.M. 2005, 118, 137, unter wiederholter Betonung sogar, dass es keinen epistemischen prima facie Vorrang nicht-religiöser Weltbilder gebe. Zur Notwendigkeit der partikular-kulturellen Einbettung der Rechtsintegration, ebenda, 111: „Entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis heißt ‘Verfassungspatriotismus’, dass sich Bürger die Prinzipien der Verfassung nicht allein in ihrem abstraktem Gehalt, sondern konkret aus dem geschichtlichen Kontext ihrer jeweils eigenen nationalen Geschichte zu Eigen machen. Wenn die moralischen Gehalte von Grundrechten in Gesinnungen Fuß fassen sollen, genügt der kognitive Vorgang nicht. Moralische Einsichten und die weltweite Übereinstimmung in der moralischen Empörung über massive Menschenrechtsverletzungen allein würden nur für die hauchdünne Integration der Bürger einer politisch verfassten Weltgesellschaft genügen (wenn es sie denn eines Tages geben sollte). Unter Staatsbürgern entsteht eine wie immer auch abstrakte und rechtlich vermittelte Solidarität erst dann, wenn die Gerechtigkeitsprinzipien in das dichtere Geflecht kultureller Wertorientierungen Eingang finden“.
Zu letzterer Konzeption klassisch C. Schmitt, Verfassungslehre, München/Leipzig 1928, 20ff.
Vgl. M. Mahlmann, „1789 Renewed? Prospects of the Protection of Human Rights in Europe“, 11 Cardozo Journal of International & Comparative Law 2004, 903, 927ff.
Vgl. M. Mahlmann, „§ 3“, in: B. Rudolf/ M. Mahlmann (Hrsg.), Gleichbehandlungsrecht, Baden-Baden 2007.
Vgl. zur Relevanz der ersten drei Fragen, J.B. Schneewind, The Invention of Autonomy, Cambridge 1998, 4ff; J. Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, Cambridge, Mass. 2000, 10
Die Urteile sind mithin „vindicatory“ in dem Sinn, den B. Williams als philosophisch widerlegt ausschließt, vgl. B. Williams, Philosophy as a Humanistic Discipline, 75 Philosophy 2000, 487.
Vgl. I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Akademie Ausgabe, Bd. IV, 415.
Vgl. näher M. Mahlmann, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie, Baden-Baden (im Erscheinen).
Dass Arendt wohl einen Kulturbegriff entwickelt, der die Würde des schlichten Menschseins unterschätzt, illustriert z.B. die „Tragödie wilder Völkerstämme“, vgl. a.a.O., 621.
Vgl. z.B. A. Sen, Human Rights and Asian Values, 16th Morgenthau Memorial Lecture on Ethics & Foreign Policy, New York 1997.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 2008 VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Mahlmann, M. (2008). Die Menschenrechtskonzeption Europas im Spiegel ihrer Vergangenheit. In: Joerges, C., Mahlmann, M., Preuß, U.K. (eds) „Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit“ und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90989-9_14
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90989-9_14
Publisher Name: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Print ISBN: 978-3-531-15414-5
Online ISBN: 978-3-531-90989-9
eBook Packages: Humanities, Social Science (German Language)