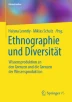Zusammenfassung
Im Training des Kampfsports ‚Mixed Martial Arts‘ (MMA) werden weibliche Trainierende in spezifisch invisibilisierter Weise sozial konstruiert und exkludiert: Durch formale Rahmenbedingungen des Trainings erfolgt zunächst keine solche Konstruktion und Exklusion. Und durch den Trainings-Diskurs erfolgt zwar vergeschlechtlichte Differenzierung. Deren Relevanz wird aber gleich wieder partiell negiert. Geschlechtsdifferenzierung und damit einhergehende soziale Exklusion erfolgen damit vor allem praktisch, und zwar, indem weiblichen Trainierenden im Sparring kämpferischer Widerstand verwehrt wird. Dies wiederum liegt daran, dass die Interaktionsordnung des Sparrings den Trainierenden ihre kämpferischen Bewegungen als ihre Entscheidungen zurechnet – und dies vor dem Hintergrund der Uneindeutigkeit der Zeichenhaftigkeit eben dieser Bewegungen.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Notes
- 1.
MMA beschreibt sich nicht als Sportpraxis, die aktiv Diversität fördert, so wie es z. B. viele Inklusionssportangebote tun: Dass MMA gemäß Selbstbeschreibung Diversität zulässt, ist vor allem an die Annahme geknüpft, dass es weniger etwaige körperliche Voraussetzungen, sondern vielmehr spezifisch erlernbare Kampffertigkeiten seien, die erfolgreiche MMA-Betreibende aufweisen müssen.
- 2.
- 3.
In Diskussionen dieses Themas wird zumeist das Wort ‚Effektivität‘ bzw. ‚effectiveness‘ verwendet. Daher verwende ich es hier ebenfalls. In vielen Fällen aber, wenn die Betreibenden über kämpferische ‚Effektivität‘ des MMA sprechen, meinen sie genau genommen eher Effizienz.
- 4.
Prinzipiell impliziert in vorliegendem Text die weibliche Form die männliche und andersherum. Beim Schreiben über die MMA-Betreibenden werde ich jedoch fast nur die männliche Form verwenden. Dies soll die zentrale These dieses Beitrags auch schreib- und leseperformativ greifbarer machen, dass im MMA weibliche Teilnehmende auf eine spezifisch invisibilisierte Weise exkludiert werden.
- 5.
Diese Untersuchungen ergänzte ich um drei weitere Formen teilnehmender Beobachtung, die auf kontextualisierende Vergleiche (Glaser 1965) abzielten. Erstens unternahm ich Stippvisiten in neun weiteren deutschen MMA-Clubs, wenn ich eine andere Stadt besuchte und sich die Gelegenheit für Feldaufenthalte ergab. Zweitens führte ich Forschungsaufenthalte in den beiden Ursprungsländern des MMA durch, nämlich in Brasilien (Oktober bis November 2015) und in Japan (Dezember 2016 bis Mai 2017), von deren MMA-Kulturen ich erwartete, dass sie sich spezifisch von der deutschen unterscheiden würden. Drittens unternahm ich bei sich bietenden Gelegenheiten Stippvisiten in Trainings anderer Kampfsportarten und Kampfkünste, und zwar Boxen, Karate, Taekwondo, Krav Maga, Wing Chun, Panantukan, Ninjutsu, Aikido, Jujutsu, Brazilian Jiu-Jitsu, Griechisch-Römisches Ringen, Freistil-Ringen, Judo und Thaiboxen.
- 6.
Je nach methodischem Vorgehen bekommt man anstatt von Selbstwahrnehmungen eher (durch soziale Erwünschtheit geprägte) Selbstdarstellungen in den Blick.
- 7.
Dieses Problem stellt sich nicht bei allen Interview- und Interviewauswertungsmethoden (nämlich z. B. nicht bei objektiv hermeneutischen Ansätzen). Solche wurden in o.g. Studien aber nicht angewendet.
- 8.
In besonders illustrativer Form kommt diese Präferenzordnung in der Situation zum Ausdruck, in der Royce Gracie, einer der Schlüsselfiguren in der Popularisierung des MMA in den USA, sich bei einem Lehrgang an der Universität Frankfurt/Main gezwungen sah, das Schild an der Wand im Kampfsport-Trainingsraum zu kommentieren: Dessen Aufdruck „Strength and Power“ erwecke genau die falschen Vorstellungen davon, was einen guten Kämpfer ausmachen würde. Stattdessen müsste dort „Technique and Leverage“ stehen.
- 9.
Die Verwendung des englischen Begriffs ‚Fighter‘ ist in deutschen MMA-Clubs üblich.
- 10.
MMA-Organisationen differenzieren zumeist ca. 8 Männer- und 4 Frauen-Gewichtsklassen. Offiziell institutionalisierte Erfahrungsniveaus sind ‚Amateur‘ und ‚Profi‘. Jedoch holen MMA-Organisationen in der Eventplanung häufig differenziertere Informationen über Kampf-Vorerfahrungen potentieller Kämpfer ein (z. B. deren Kampfstatistiken), um ‚Mismatches‘ zu verhindern. Und in einigen Ländern verbieten zudem Athletic Commissions Kämpfe, wenn die Erfahrungsniveaus zweier Kämpfer zu unterschiedlich sind.
- 11.
In sehr großen MMA-Clubs gibt es in seltenen Fällen die Trennung von Anfänger- und Profi-Trainings(zeiten). Trennungen der Trainings(zeiten) nach Gewichtsklassen oder Geschlecht habe ich bei meiner Betrachtung der Homepages der MMA-Clubs in Deutschlands 75 größten Städten im April 2017 nie gesehen (eher noch nach Kindern und Erwachsenen). Allerdings thematisiert vorliegender Text ohnehin nicht die Makro-Organisation der Trainings(zeiten) von MMA-Clubs, sondern analysiert Praxismuster auf mikroorganisationaler Ebene, die sich im MMA-Training manifestieren, wenn makroorganisational nicht nach Geschlecht getrennt wird.
- 12.
Wie in vielen Sportsettings kommen hier viele ‚sportuntaugliche‘ ästhetische Geschlechts-Codes wie z. B. Schminke und Parfum, die in anderen Settings häufig und intensiv verwendet werden, nur in geringem Maße zur Anwendung. Dies führt bei den Beteiligten jedoch nicht zu gender assignment trouble. Denn MMA ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein stark maskulin dominierter Sport, indem MMA zu betreiben häufig mit der Verwendung deutlich maskuliner optischer Marker einhergeht wie neben (der Darstellung) von großen und/oder ‚definierten‘ Muskeln seit einigen Jahren auch ein großer (und oft scharf getrimmter) Bart. Dieses ‚Verschieben der geschlechtlichen Nulllinie‘ führt dazu, dass der nötige Aufwand an Geschlechts-Codes im Verhältnis zu anderen Settings geringer ist, um sich selbst als ‚vollständige‘ Frau zu klassifizieren.
- 13.
Ich habe allein männliche Umkleideräume besucht. Auf Rückfrage berichteten meine Informantinnen, dass man die Umkleidekulturen nicht vergleichen könne. Denn während in Männerumkleiden häufig viel geredet wird, fällt dies in Frauenumkleiden allein dadurch in vielen Fällen (und vor allem in kleinen Clubs) schon aus, dass frau dort oft alleine ist. Meine in diesem Zusammenhang geäußerte Frage, ob gerade die Stille dieses abgeschiedenen Raumes, zumal häufig von außerhalb vermutlich undeutlich viele Stimmen zu hören sind, einem ein Bewusstsein eigener, am Geschlecht festgemachter Exzeptionalität verschaffen würde, wurde von manchen meiner Informantinnen positiv beantwortet, während andere betonten, dass sie während des Umziehens bereits zu sehr auf das Training fokussiert seien und sich über so etwas keine Gedanken machten.
- 14.
Für z. B. den (seltenen) Fall, dass mehr als eine Frau im Training ist, finden sich häufig Frauen als Trainingspartner zusammen.
- 15.
Dies erfolgt performativ z. B. dadurch, dass frau nicht denselben offensiven Ernst aufbringt wie man: Sie blickt weniger ernst wenn in Kampfhaltung (nämlich nicht mit vorgebeugtem Kopf, verkniffenen Augen und ‚durch die eigenen Augenbrauen‘), freut sich über eine gelungene Schlagkombination, anstatt diese still selbstanerkennend abzunicken (oder sich bei Misslingen zu ärgern) und vollführt z. B. Schläge und Tritte grazil auf den Zehenspitzen anstatt mit tiefem Schwerpunkt, so dass ihre Schläge und Tritte gegen Pratzen auch sie selbst bewegen, anstatt vor allem die Pratzen weg- und einzuschlagen (Vgl. zu Unernst als männlichem und weiblichem Deplatzierungsanzeiger generell Goffman 1981).
- 16.
Frau fragt eher nach beim Trainer bezüglich korrekter Technikausführungen und unterscheidet sich damit von ihren männlichen Partnern, die sich als mit der kämpferischen Praxis immer schon vertraut darstellen, indem sie einmal gezeigte Techniken selbstverständlich sofort korrekt nachmachen (und eher irritiert sind, wenn der Trainer diese Korrektheit in Abrede stellt). Andersherum unterstützen die männlichen Partner ihre weiblichen im demonstrativen Anzeigen ihrer Distanz zur kämpferischen Sache, indem sie ihnen als Gentlemen auch ohne direkte Aufforderung mit Tipps und Erklärungen helfen.
- 17.
Andere Kontexte, in denen eine besondere weibliche Beweglichkeit als vorteilhaft genannt wird, sind z. B. die Ausführungen anderer Aufgabegriffe aber auch Ausführungen von Tritten zum Kopf oder schließlich auch die Abwehr bestimmter Aufgabegriffe wie Armstreckhebel.
- 18.
Im MMA ist es, anders als beispielsweise im Fußball, sehr ungewöhnlich, Wettkämpfe zu kämpfen: Die große Mehrheit der Trainierenden trainiert ohne dieses Ziel. Dadurch erhält Sparring eine ungleich höhere Bedeutung: Für viele Trainierende ist es ‚der‘ kämpferische ‚Ernstfall‘.
- 19.
Das Zurückhalten beim Schlagen ist natürlich nicht nur Geschlechtskonstruktion. Denn es ist ja ein Kerncharakteristikum des Sparrings, ein spezifisches Maß an Rücksicht aufeinander zu nehmen. Aber bei Frauen wird dieses Zurückhalten doch mit besonderer Bedeutsamkeit aufgeladen: „Was willste machen? Passte nicht auf, kriegste einen von ner Frau verkloppt. Gehste aber voll ab, haste ne Frau verkloppt. Auch nicht besser!“ (lacht) (Feldinterview mit Hermann, 01.09.2016).
- 20.
Natürlich lässt dies trotzdem die Möglichkeit, sich durchgehend geschlechts-homosozial zu paaren. Aber solche Paarungen werden aufgrund der Maßgabe des ‚Rundum-Wechselns‘ der Partner im Sparring mehr und mehr als individuelle Entscheidungen wahrgenommen denn als zufällig. Solch eine individuelle Entscheidung kann man dann z. B. als ‚Frau‘ immer damit legitimieren, lieber nicht mit ‚Männern‘ trainieren zu wollen. Aber diese Legitimation muss eigens sprachlich artikuliert werden, z. B. wenn frau von einem Mann gefragt wird, ob man ‚die nächste Runde zusammen machen‘ soll. Performanz und Präferenz von Geschlechtsdifferenzierung sind hier m. a. W. legitimationsbedürftig, und deren Gegenteile sind es nicht.
- 21.
Zu dieser Invisibilisierung trägt natürlich nicht zuletzt auch noch bei, dass diese Exklusion zudem auf eine Weise erfolgt, die es den Frauen sehr schwer macht, sie erfolgreich als diskriminierend zu thematisieren bzw. diese Diskriminierung gar aufzuheben. Denn sie können natürlich ihre männlichen Trainingspartner bitten, sie nicht als ‚weibliche‘ Sparringspartner zu behandeln, indem sie aufgrund ihrer Weiblichkeit auf sie ‚mehr‘ Rücksicht nehmen als auf männliche Trainingspartner. Aber wie sollten sie diesen Trainingspartnern nachweisen, dass diese dieser Bitte nicht nachkommen?
- 22.
Allerdings ist deren Exklusions-Status insofern weniger substanziell, als dass er prinzipiell temporär imaginiert ist: Derart Exkludierte können lernen, sie können an Gewicht zulegen, sie können die Verletzung auskurieren bzw. sie können einfach älter werden.
- 23.
Sport zeichnet sich daher dadurch aus, dass in Wettkämpfen große Anstrengungen unternommen werden, um die Behauptung einer prinzipiell gleichen Startposition der Wettbewerbenden plausibel aufrechtzuerhalten. Dann kann die Differenz von Siegenden und Unterliegenden am Wettbewerbsende zelebriert werden. (Hiermit unterscheidet es sich vom Sporttreiben, das auf Inklusion ausgerichtet ist: Hier werden Anstrengungen unternommen, um die Differenz der Startpositionen zu betonen, so dass dann im Sporttreiben die Gleichheit der Sporttreibenden zelebriert werden kann).
Literatur
Abramson, Corey M., und Darren Modzelewski. 2011. Caged morality. Moral worlds, subculture, and stratification among middle-class cage-fighters. Qualitative Sociology 34 (1): 143–175.
Alencar Passos, Daniella de, Rodrigo Cribari Prado, Wanderley Marchi Júnior, und André Mendes Capraro. 2014. The origins of “vale-tudo” in the city of Curitiba, PR. Memories on identity, masculinity and violence. Movimento 20 (3): 1153–1170.
Blumer, Herbert. 1954. What is wrong with social theory? American Sociological Review 19 (1): 3–10.
Channon, Alex, und Christopher R. Matthews. 2015. “It is what it is”. Masculinity, homosexuality, and inclusive discourse in mixed martial arts. Journal of Homosexuality 62 (7): 936–956.
Couture, Randy. 2003. Interviewed by J. Michael Plott. Black Belt Magazine 2003:56–61.
Dooley, Ann M. 2013. Mixed martial arts. On the Risk 29 (2): 63–67.
Fair, Brian. 2011. Constructing masculinity through penetration discourse. The intersection of misogyny and homophobia in high school wrestling. Men and Masculinities 14 (4): 491–504.
Gebauer, Gunter, Thomas Alkemeyer, Bernhard Boschert, Uwe Flick und Robert Schmidt. 2004. Treue zum Stil. Die aufgeführte Gesellschaft. Bielefeld (transcript).
Gensler, Helmut. 2013. Blasrohrschießen als Einstieg in die Kampfkunst für schwer behinderte Menschen. In Kampfkunst und Kampfsport in Forschung und Lehre, Hrsg. Sigrid Happ und Olaf Zajonc, 245–248. Ahrensburg bei Hamburg: Czwalina.
Glaser, Barney G. 1965. The constant comparative method of qualitative analysis. Social Problems 12:436–445.
Goffman, Erving. 1981. Geschlecht und Werbung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Green, Kyle. 2011. It hurts so it is real. Sensing the seduction of mixed martial arts. Social & Cultural Geography 12 (4): 377–396.
Green, Kyle. 2016. Tales from the Mat. Narrating men and meaning making in the mixed martial arts gym. Journal of Contemporary Ethnography 45 (4): 419–450.
Hirschauer, Stefan. 2017. Humandifferenzierung. Modi und Grade sozialer Zugehörigkeit. In Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung, Ders. Hrsg. Weilerswist: Velbrück.
Hirose, Akihiko, und Kay Kei-ho Pih. 2010. Men who strike and men who submit. Hegemonic and marginalized masculinities in mixed martial arts. Men and Masculinities 13 (2): 190–209.
Holthuysen, Jaime. 2011. Embattled identities. Constructions of contemporary American masculinity amongst mixed martial arts cagefighters. Ann Arbor, Michigan: ProQuest Dissertations Publishing. 3452883.
Mierzwinski, Mark, Philippa Velija, und Dominic Malcolm. 2014. Women’s experiences in the mixed martial arts. A quest for excitement? Sociology of Sport Journal 31:66–84.
Müller, Marion. 2006. Geschlecht als Leistungsklasse. Der kleine Unterschied und seine großen Folgen am Beispiel der „gender verifications“ im Leistungssport. Zeitschrift für Soziologie 35 (5): 392–412.
Müller, Marion und Christian Steuerwald. 2017. „Gender“, „Race“ und „Disability“ im Sport. Von Muhammad Ali über Oscar Pistorius bis Caster Semenya. Bielefeld (transcript).
Neuhaus, Henrike. 2015. Fighting for sociocultural acceptance/and diversity. In Von Kämpfern und Kämpferinnen. Kampfkunst und Kampfsport aus der Genderperspektive, Hrsg. Marquardt Anja und Peter Kuhn, 49–56. Ahrensburg bei Hamburg: Czwalina.
Paradis, Elise. 2012. Boxers, briefs or bras? Bodies, gender, and change in the boxing gym. Body & Society 18 (2): 82–109.
Rödel, Jan C. 2013. Kampfsport in olympischer Tradition? Das antike Pankration und die modernen Mixed Martial Arts. In Kampfkunst und Kampfsport in Forschung und Lehre, Hrsg. Sigrid Happ und Olaf Zajonc, 61–70. Ahrensburg bei Hamburg: Czwalina.
Spencer, Dale C. 2012a. Ultimate fighting and embodiment. Violence, gender and mixed martial arts. New York: Routledge.
Spencer, Dale C. 2012b. Narratives of despair and loss. Pain, injury and masculinity in the sport of mixed martial arts. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health 4 (1): 117–137.
Staack, Michael. 2013. Sport oder Spektakel? Ansätze einer sportsoziologischen Reflexion von „Mixed Martial Arts“. In Kampfkunst und Kampfsport in Forschung und Lehre, Hrsg. Sigrid Happ und Olaf Zajonc, 131–139. Ahrensburg bei Hamburg: Czwalina.
Staack, Michael. 2018. Fighting as real as it gets. A micro-sociological encounter. In der Veröffentlichung befindliche Dissertationsschrift.
Sund, Ann-Helen. 2005. The sport, the club, the body. A study of ultimate fighting. Ethnologia Scandinavica 35:86–98.
Vaccaro, Christian A. 2011. Two analyses of gender. Using ethnographic field data on the sport of mixed martial arts. Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 5241.
Vaccaro, Christian A., Douglas P. Schrock, und Janice McCabe. 2011. Managing emotional manhood. Fighting and fostering fear in mixed martial arts. Social Psychology Quarterly 74 (4): 414–437.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2020 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Staack, M. (2020). Ob ‚Frauen‘ ‚Fighter‘ sein können. Zur Un-/Möglichkeit von Geschlechter-Gleichheit und Diversität im Mixed Martial Arts. In: Leontiy, H., Schulz, M. (eds) Ethnographie und Diversität. Erlebniswelten. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21982-6_15
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21982-6_15
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-21981-9
Online ISBN: 978-3-658-21982-6
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)