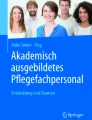Ein Sozialforschungsprojekt der Universität Linz untersuchte, wie die sogenannte 24-Stunden Betreuung in Österreich funktioniert. Die Ergebnisse sind nicht nur im Licht der hierzulande angekündigten Pflegereform interessant, sondern auch durch den Vergleich mit ähnlichen Modellen in Deutschland und der Schweiz.
Similar content being viewed by others
Avoid common mistakes on your manuscript.
Die COVID-19-Krise legte vor einem Jahr manche Schwäche des Sozialsystems offen, so auch im Bereich der Live-in-Betreuung — landläufig als 24-Stunden-Betreuung bezeichnet. Die Sorge, plötzlich keine Betreuerinnen (zu 95 Prozent sind in der Personen-Betreuung Frauen tätig) mehr zur Verfügung zu haben, sobald die Grenzen geschlossen sind, begann plötzlich sowohl die betroffenen Familien als auch die Politik umzutreiben. Die ersten coronabedingten Einbrüche in der 24-Stunden-Betreuung seien Katalysator einer veränderten Wahrnehmung gewesen. Die „Systemrelevanz“ dieser Arbeit sei zum Thema geworden, sagt Brigitte Aulenbacher, Vorständin des Instituts für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz. „Das ist mit erhöhter medialer Aufmerksamkeit ebenso verbunden gewesen wie mit symbolischen Politiken, darunter Initiativen von Bundesländern, WKO und Agenturen, Betreuerinnen mit eigens gecharterten Sonderflügen und -zügen zu holen.“
Aulenbacher untersuchte zusammen mit dem Sozialwirt Michael Leiblfinger und der Soziologin Veronika Prieler in einem Forschungsprojekt den Status Quo von Live-in-Betreuung in Österreich. Durch einen Forschungsverbund mit Wissenschaftlern in Deutschland und der Schweiz konnten auch Vergleiche mit Modellen vermittelter Personenbetreuung in diesen Nachbarländern gezogen werden.Footnote 1
Informelle Arrangements
Die Befürchtung, das Betreuungsarrangement könnte zusammenbrechen, habe im Umgang mit den Betreuerinnen zu informellen Änderungen geführt, sagt Aulenbacher. So hätten manche Angehörige ausgefallene Fahrdienste ersetzt, Betreuerinnen an der Grenze abgeholt, Taxifahrten finanziert. „Ferner ist uns von zusätzlichen materiellen Anerkennungen und neuer Wertschätzung durch manche Betreute oder Angehörige berichtet worden.“
Sozialwirt Michael Leiblfinger: „Immer noch Probleme bei der Bereitstellung kostenloser FFP2-Masken.“

Foto: D. Vellis
Die Pandemie habe auch einer alten Forderung der Betreuungsagenturen neuen Nachdruck verliehen, nämlich nach Erhöhung der staatlichen Förderung, damit das Modell für die Haushalte leistbarer und für die Betreuerinnen mit höheren Honoraren verbunden wäre. Während die Nachfrage nach 24-Stunden-Betreuung stabil geblieben sei, hätten einige Betreuerinnen durchaus überlegt, ob sie diese Tätigkeit unter den Vorzeichen der Pandemie fortsetzen wollten, wodurch sich das Betreuungsangebot verknappen könnte, so die Soziologin. „Allerdings halten manche Agenturen ein steigendes Interesse an der Arbeit in der Personenbetreuung angesichts der Wirtschaftskrisen in allen Ländern und ihren Folgen für den Arbeitsmarkt auch nicht für ausgeschlossen.“
Soziale Isolation
Was die soziale Situation der Betreuungskräfte betrifft, haben sich laut Michael Leiblfinger durch die Pandemie manche Problematiken verschärft. „Es wurde uns von vermehrter Vereinsamung der Betreuungskräfte berichtet, wobei deren Isolation kein neues Thema ist.“
Zudem seien Pandemiemaßnahmen, wie etwa die Testung von Betreuungskräften, erst sehr spät umgesetzt worden. „Vor allem in den ersten Monaten der Pandemie waren die Testmöglichkeiten weder in Österreich noch in den Herkunftsländern vergleichbar zu heute ausgebaut. Beim Grenzübertritt braucht man aber ein negatives Testergebnis. Somit mussten vielfach kostenpflichtige Testmöglichkeiten in Anspruch genommen werden und diese Testkosten haben zuerst die Betreuungskräfte oder die Betreuten übernommen. Später wurde eine auch rückwirkend mögliche Erstattung der Testkosten bekanntgegeben. Bei dieser Kostenrückerstattung gab es dann nicht nur Unterschiede zwischen den Bundesländern, zum Teil wurde ein Ansuchen überhaupt erst Monate nach der Bekanntgabe der Refundierung ermöglicht. Gleiches gilt auch bei der Bereitstellung von Schutzausrüstung. Obwohl seit Anfang Oktober 2020 durch eine Gesetzesänderung auch Betreuungskräften beispielsweise FFP2- Masken kostenlos zur Verfügung gestellt werden hätten sollen, gibt es auch ein halbes Jahr später noch Probleme bei der Bereitstellung.“
Auch die Selbstständigkeit der Betreuungskräfte zeige sich als Problem, da sie — wie andere Selbstständige auch — erst ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit Krankengeld bekämen. Zudem könne bei Absonderung nach einem positiven Testergebnis in der Praxis kein Verdienstentgang in Anspruch genommen werden, so Leiblfinger. „Es ist vorgesehen, dass ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer die Richtigkeit der selbst vorzunehmenden Berechnung des Verdienstentganges bestätigen. Viele Betreuerinnen haben keinen Steuerberater, auch weil sie in einem Jahr üblicherweise unter der Steuerfreigrenze von 11.000 Euro verdienen.“
Gerade das Selbstständigen-Modell, das hierzulande immer wieder in der Kritik steht, wird in Österreichs Nachbarländern überraschend positiv beurteilt. Diese Sichtweise hält allerdings einer vertieften Betrachtung kaum stand.
Vorbild Österreich?
Die Betreuungskräfte werden meist „von Agenturen vermittelt, die darüber hinaus auch weitere Leistungen für Haushalte und Betreuerinnen anbieten, zum Beispiel die Organisation der An-und Abreisen der Betreuungskräfte, administrative Aufgaben wie Gewerbean- und -abmeldungen oder Qualitätsvisiten“, sagt Veronika Prieler. In der Schweiz hingegen seien die Betreuerinnen im Anstellungsverhältnis tätig — entweder direkt im Haushalt der zu betreuenden Person oder bei einer Agentur, die sie an den Haushalt verleihe. In Deutschland würden unterschiedliche Modelle praktiziert, „darunter vor allem die Entsendung von Betreuungskräften, aber auch Anstellungs- oder Selbstständigenmodelle, wobei alle Varianten rechtliche Graubereiche aufweisen“.
Projektmitarbeiterin Veronika Prieler: „Alle Varianten weisen rechtliche Graubereiche auf.“

Foto: New Art Studio Barbara Klaczak
Den Graubereichen entspricht auch die Datenlage. Während in Österreich die Personenbetreuerinnen registriert und zahlenmäßig erfassbar sind (Anfang 2020 waren es 62.000), konnten die deutschen und schweizerischen Partner des Forschungsprojekts in ihren Ländern nur die Zahl der Agenturen ausmachen (rund 400 in Deutschland, rund 60 — bei deutlich restriktiveren Anmeldekriterien — in der deutschsprachigen Schweiz). „Beide Länder führen keine Statistik zu Betreuungskräften, wobei Schätzungen für Deutschland von bis zu einer halben Million Betreuerinnen ausgehen“, sagt Michael Leiblfinger.
Selbstständigkeits-Modell
Für Aulenbacher ist das österreichische Modell dennoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Allerdings habe das deutsche Modell der Entsendung von Betreuungskräften zu Konditionen des Entsendelandes (primär Polen) den gravierenden Nachteil, „dass arbeits- und sozialrechtliche und -politische Regulierungen in Deutschland nur bedingt gelten oder greifen“, was von den deutschen Projektpartnern aufgezeigt worden sei. Die schweizerischen Forscher wiederum hätten darauf hingewiesen, dass Anstellungsverhältnisse im Bereich der Live-in-Betreuung nicht nur möglich, sondern alltägliche Praxis sein könnten, allerdings zu vollkommen anderen Bedingungen als in Österreich. „Das Angestelltenmodell — wenngleich kaum Praxis und aus Kostengründen oftmals für unrealistisch gehalten — ist aus der Diskussion nicht verschwunden“, sagt die Soziologin. „Vorausgesetzt ist allerdings, dass sich entsprechende Beschäftigungsmodelle und -formen in Haushalten, bei Wohlfahrtsträgern oder bei anderen Trägern, zum Beispiel auch Agenturen, schaffen lassen.“
In Österreich jedenfalls begünstige das Selbstständigenmodell ausbeuterische Praktiken, da die Personenbetreuerinnen vergleichsweise schwache Verhandlungspositionen gegenüber Agenturen wie Betreuten und Angehörigen innehätten. Dies betreffe vor allem die Arbeitsbedingungen, die sich weit unterhalb der in anderen Betreuungs- und Pflegebereichen geltenden Standards bewegten. „Es ist die Frage, aus welcher Perspektive das österreichische Modell betrachtet wird“, so die Soziologin. In Deutschland und der Schweiz werde es nicht von den wissenschaftlichen Experten als Vorreitermodell gesehen, sondern vor allem von den Vermittlungsagenturen und Verbänden, die Lobbyarbeit machten. Die Gründe dafür, das österreichische Modell in Deutschland zu propagieren, seien zum einen dessen Legalisierung; zum anderen gelte es als kostengünstiger für die Betreuten und ihre Angehörigen sowie auch für den Sozialstaat. „Das ist allerdings ein verklärter Blick nach Österreich, der übersieht, dass das Selbstständigenmodell nach anderthalb Jahrzehnten Erfahrung damit nach wie vor umstritten ist“, so Aulenbacher.
Gemeinsamkeiten der Modelle
Die oft prekäre Arbeits- und Lebenssituation der Betreuungskräfte sei den Live-in-Modellen in allen drei Ländern gemeinsam, sagt Veronika Prieler. „Die Arbeitszeiten sind lang, Pausenmöglichkeiten häufig rar, die Löhne vergleichsweise gering; Betreuerinnen müssen diverse Tätigkeiten übernehmen, die von Haushaltsarbeit bis hin zu pflegerischen Aufgaben reichen; oft gibt es Konflikte über das alltägliche Zusammenleben, zum Beispiel was wann und wie gekocht werden soll. Viele Betreuerinnen haben kaum Möglichkeit, den Haushalt zu verlassen, um sich zum Beispiel mit Freunden zu treffen, weil es keine Ersatzbetreuung gibt und sie daher rund um die Uhr für die Betreuten verantwortlich sind.“
Ebenso für alle drei Länder kennzeichnend sei die zentrale Rolle von Agenturen und auch die mediale Kritik, der diese ausgesetzt seien. „Vorgeworfen wird ihnen unter anderem, Betreuungskräfte und Betreute beziehungsweise ihre Angehörigen durch unlautere Geschäftspraktiken finanziell zu schädigen und in Abhängigkeit zu halten. Auch in unseren Interviews waren diese unter dem Schlagwort der sogenannten schwarzen Schafe immer wieder Thema“, so Prieler. Gleichzeitig seien Agenturen in den Untersuchungen auch als Akteure sichtbar geworden, die aktiv an der Weiterentwicklung der Live-in-Betreuung beteiligt seien, was zu Verbesserungen für Betreuungskräfte wie Betreute führen könne.
Trotz aller Schattenseiten werde — auch dies eine Gemeinsamkeit — in allen drei Ländern die Live-in-Betreuung in weiten Teil der Bevölkerung als gute Lösung gesehen. Wegen unterschiedlicher-rechtlicher Rahmenbedingungen sei kaum eine Lösung von einem Land auf ein anderes übertragbar, sodass man übernational kaum von Best-Practice-Beispielen sprechen könne.
Soziologin Brigitte Aulenbacher, JKU: „Das Selbstständigenmodell begünstigt ausbeuterische Praktiken.“

Foto: privat
Chance Pflegereform
Für Österreich sehen die Forscher Potenzial für Verbesserungen in der angekündigten Pflegereform, da diese erstens die Maßgabe „Häuslich vor mobil vor stationär“ festhalte und zweitens auf die Reform des gesamten Betreuungs- und Pflegemixes abziele. „Beides zusammengenommen ist eine Chance“, sagt Brigitte Aulenbacher. „In Österreich ist, was in unserer Untersuchung immer wieder Thema ist, der Wunsch stark, im Alter zu Hause zu leben und auch zu sterben, wobei sich eine Aufgeschlossenheit für neue Wohn- und Lebensformen zu zeigen beginnt.
Mittel- und langfristig gelte es daher, eine wohnortnahe Betreuungs- und Pflegeinfrastruktur aufzubauen, die sich durch eine gute Kombination von Wohnformen, Betreuungsnetzwerken, mobilen Diensten und stationären Einrichtungen auszeichne. Inwieweit und in welchen Formen die Live-in-Betreuung in einer solchen Infrastrukturpolitik Raum habe oder durch Live-out-Modelle ersetzt werden könne, sei eine offene Frage. Als zentrale kurzfristige Maßnahme könnte für Aulenbacher die Verkoppelung staatlicher Förderung mit der Ausgestaltung der Live-in-Betreuung aussichtsreich sein, um Mindeststandards guter Sorge und guter Arbeit einzuführen. „Die Herausforderung besteht dabei jedoch im Status quo: Die Personenbetreuung als selbstständiges Gewerbe, wie sie in Österreich in erster Linie betrieben wird, entzieht sich vor allem arbeitspolitischen Regulierungen, was auch ihre sozialpolitische Regulierung von vornherein einschränkt.“
Notes
1 Die Ergebnisse der Untersuchung wurden Mitte April im Beltz-Verlag unter dem Titel Gute Sorge ohne gute Arbeit? veröffentlicht. Das Buch, das von Aulenbacher sowie ihren deutschen und schweizerischen Projektpartnern herausgegeben wurde, zeigt, wie transnationale Live-in-Betreuung in den drei Ländern ausgestaltet ist.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Pichler, E. Verklärter Blick nach Österreich. ÖKZ 62, 14–16 (2021). https://doi.org/10.1007/s43830-021-0038-2
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s43830-021-0038-2