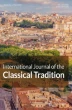Avoid common mistakes on your manuscript.
Daniel Wendt untersucht in seiner 2017 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn eingereichten und für den Druck leicht überarbeiteten Dissertationsschrift die Funktionalisierung antiker obszöner Literatur im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts. Dieser geht er in den Disziplinen der Literaturkritik, der Philologie sowie der Sprach- und Geschichtstheorie nach. Den Begriff der Obszönität definiert er allerdings nicht, da er für seine Untersuchung eine rezeptionsästhetische Herangehensweise wählt. Mit Aristophanes, Catull, Ovid, Petron und Martial konzentriert er sich dabei auf Autoren, die im Zuge der ‘Repression der ars erotica’ (S. 13) wiederholt als obszön betrachtet würden.
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln, an die sich ein in Primärtexte und Forschungsliteratur unterteiltes Literaturverzeichnis und zwei Indices (Index locorum und Index nominum) anschließen.
In dem einleitenden ersten Kapitel (‘Einleitung: Das obszöne Paradox – Methodologische Prämissen’) erläutert Wendt neben Forschungsstand und methodologischen Prämissen seine Themenwahl. Gegenstand der Untersuchung sind ‘Texte, die den Umstand der Obszönität der Texte der Antike thematisieren’ (S. 38). Dabei greift er auf ein weit gefasstes Corpus aus literarischen, juristischen, wissenschaftlichen Texten, Briefen, Editionen wie auch Übersetzungen samt Anmerkungen zurück. Den Beginn seines Untersuchungszeitraums legt er auf die beiden Prozesse gegen den Dichter Théophile de Viau, in welchen er eine Zäsur ‘im Hinblick auf literarische Obszönität (und den Umgang damit)’ (S. 39) sieht. Sein Hauptaugenmerk jedoch gilt der Querelle des Anciens et des Modernes: Mit ihr habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden, in dessen Zuge die antike Literatur ihre Modellhaftigkeit verloren habe. Wendt versteht die Querelle als ‘Akt der Autonomie’ (S. 11–12), der sich besonders gut am Phänomen der Obszönität nachvollziehen lasse: ‘Das Prinzip der Obszönität ... entspricht dem ambivalenten Verhältnis zur Antike, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Identität und Alterität, das im 17. Jahrhundert im Zuge der Herausbildung der Moderne entsteht’ (S. 16). In Anlehnung an Habermas’ Charakterisierung der Moderne sieht Wendt die obszöne Literatur der Antike als deren Negativfolie; ‘Die Antike wird ... im Zuge des Prozesses der Herausbildung der Moderne als “abjekt” konstruiert: Der lateinische Begriff abiectus ... verweist auf den Akt der Distanzierung und umfasst drei Aspekte ... 1. das Abgestoßene und Verachtete (repulsum, contemptum, turpe) ... , 2. das Kunst- und Wertlose (proiectum, incomptum, vile) ... , 3. Das Entlegene, Unverständliche und Verlorene (remotum, obscurum, perditum) … .’ (S. 15–16). En passant erläutert Wendt damit auch den Titel seiner Arbeit.
Im zweiten Kapitel (‘Moderne Obszönität und antike Texte’), das Wendt selbst als ‘historisches Präludium’ (S. 40) bezeichnet, illustriert er am Beispiel der Prozesse gegen Theóphile de Viau Faktoren, aus denen Obszönität im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts zum Problem werde: Als 1622 der Gedichtband Le Parnasse satyrique de ce temps erschien, wurde Théophile wegen seines Gedichts Phylis, tout est … outu, angeklagt. In diesem wird ‘vor der Folie eines Beichtgesprächs … von Sexualakten mit der angesprochenen Phylis und den Folgen der offenbar daraus resultierenden Ansteckung mit der Syphilis (verrolle) gesprochen’ (S. 91). Zum Verhängnis geworden seien Théophile erstens veränderte Vorstellungen von Autorschaft, denn der ‘Anklage liegt ein juristischer, repräsentativer Autorenbegriff zugrunde im Sinne einer für ihre Sprachhandlungen verantwortbaren namentlichen Person’ (S. 111). Zweitens ‘eine Verengung der moralischen Verantwortung auf den Autor und eine Entlastung und Entwertung der Funktion des Lesers’ (S. 114). Drittens die semantische Verengung des Begriffs des Obszönen auf das Körperliche, was der Moralisierung des Obszönen Vorschub leiste und die Voraussetzung für ‘die ästhetischen, moralischen und historischen Diskurse’ (S. 51) bilde, denen Wendt in den folgenden drei Kapiteln nachgeht.
In Kapitel 3 (‘Pathogen Antike: Obszönität und Assumption’) untersucht Wendt das ‘Konzept des dégoût als Reaktionsmodus auf das Obszöne’ (S. 119). Der Begriff des Dégout sei u. a. von Descartes verwendet worden, um eine ‘Überschreitung des richtigen Maßes’ (S. 121) zu kritisieren. Im Konzept des Dégout sieht Wendt folglich eine moralische und soziale Distinktions- sowie rhetorische Ablehungsstrategie, die der französischen Oberschicht ‘zur Selbstbestätigung der eigenen moralischen Überlegenheit’ (S. 163) diene. Dégout werde dabei nicht nur als Distinktinionsmerkamal zwischen Zeitgenossen (homme de cour ⟷ homme de goût; französische Oberschicht ⟷ niederes Volk), sondern auch zwischen antiker und zeitgenössischer Poetik und Gesellschaft funktionalisiert. In den Poetiken, die im 17. Jahrhundert verfasst würden, erfolge eine ‘Sozialhierarchisierung der Literatur’ (S. 148), die ‘um eine zeitliche Perspektive ergänzt’ (S. 159) werde. Diesen historisierenden Poetiken sei ein ‘Fortschrittsgedanke’ (S. 145) eingeschrieben, hin zur ‘Verfeinerung der Sitten.’ (Ebd.) Schriftsteller würden als Erzieher des Volks betrachtet, Literatur werde als leçon publique konzipiert. Diese dürfe nur in positiven Exempla erfolgen, was Obszönität ausschließe. ‘Antike Obszönität wird ... nicht als erreur eines einzelnen Kunstwerks, sondern als dispositiver Effekt (défaut) einer ganzen Epoche gewertet, der in seiner historischen Entwicklung behoben wird’ (S. 148).
Als weitere Zahnräder im Prozess der Distanzierung betrachtet Wendt in Kapitel 4 (‘(Aus)gesuchte Antike: Obszönität und Ordnung’) ‘sprachphilosophische … Ordnungsbestrebungen’ (S. 165). Darunter fasst er die Bewertung des Verhältnisses zwischen französischer und lateinischer Sprache, die Neuordnung des literarischen Kanons sowie Praktiken des Edierens und Übersetzen. Gemein sei diesen Bestrebungen die Fokussierung auf verba. Als Exemplum der honnêteté und sprachlicher purificateur sei der König Garant dafür, dass obszöne Wörter nicht verwendet würden. Die Idee der sprachliche Reinigung durch den König wirke sich auf die Konstruktion der Sprachgeschichte aus: In dem Bestreben, Französisch als Wissenschaftssprache zu etablieren, werde das Französische als ‘keusche Tochter des klassischen Latein’ (S. 138) präsentiert, wobei in der zeitgenössischen Argumentation nur die belle latinité zur Zeit des Augustus als Vergleichspunkt gelte. Der Vergleich mit ‘eine[r] klassische[n] Antike ist … weiterhin notwendig, da eine Argumentation, die durch die kulturelle Hegemonie Frankreichs auch die politische Vorherrschaft der Franzosen als legitime Nachfolger der Römer zu etablieren sucht, andernfalls ins Leere laufen würde’ (S. 180). Übersetzer lateinischer Werke sähen sich ‘im Dienst der königlichen Effekte der purification’ (S. 169). In den Übersetzungen macht Wendt drei Strategien im Umgang mit obszönen Stellen aus: Entweder würden sie ausgelassen, in zweisprachigen Ausgaben dem Originaltext als verharmlosende Übersetzungen oder Paraphrasen gegenübergestellt oder ans Textende gestellt, ‘sodass en passant als Gegenbild des honnête homme eine Bibliothek der obszönen Literatur der Antike entsteht’ (S. 193).
Im fünften Kapitel (‘Entfernte Antike: Obszönität und Geschichte’) untersucht Wendt die Funktionalisierung der obszönen Literatur der Antike in Geschichtsbildern der Aufklärung. Die Antike werde an den Anfang einer ‘Perfektionsentwicklung’ (S. 228) gesetzt; ihre Historisierung diene der ‘Erzeugung und Fundierung der Gegenwart’ (S. 224), zu welcher sie als das ‘Andere’ erscheine. Diese Einschätzung basiere im Wesentlichen auf der Obszönität der Antike, die mit dem zeitgenössischen Barbarendiskurs verbunden werde. Damit einher gehe eine ethnologisch motivierte Apologie der Obszönität ‘im Rahmen einer antiken Sittengeschichte’ (S. 277): Die Obszönität eines Textes ‘wird zum Charakteristikum einer ganzen Epoche. Das Obszöne ist, wie der Erfolg und die Kanonisierung der entsprechenden Autoren belegen, für das zeitgenössische Publikum nicht obszön. … Die Aufklärer [wiederum] stilisieren sich selbst als Motor des zivilisatorischen Fortschritts, des Austritts aus dem barbarischen Naturzustand. … Der Fortschritt bewirkt aber zugleich … ein permanentes Obsolet-Werden des Status quo. Dies betrifft nicht nur die antiken Werke selbst, sondern auch die Beschäftigung … mit der Antike zum Zweck der Bildung ist selbst zu einer historisch obsoleten Tätigkeit geworden’ (S. 252–3). Eine Gegenströmung formiert sich durch Anne Dacier, die in ihren Übersetzungen antiker Werke das Interesse an antiker obszöner Literatur zu einem ‘Elitismus’ (S. 258) umdeutet.
Im abschließenden sechsten Kapitel (‘Schlussbetrachtung: Vitalität. Die obszöne Literatur und ihre Leser’) resümiert Wendt, die obszöne Antike werde ‘als Knotenpunkt der untersuchten Diskurse (Interdiskurse) zum Kollektivsymbol der Moderne’ (S. 279). In der Beschäftigung mit ihr und ihrer Rezeption sieht er einen ‘Möglichkeitshorizont’ (S. 282), der das Abgleiten einer Beschäftigung mit Antike in ‘blindes Effektbegehren’ oder in ‘Verlustangst’ (ebd.) ihr somit Vitalität gewähre.
Neben einigen Redundanzen hinsichtlich der Leitfragen (Kapitel 1) und der Rolle der Jesuiten im Prozess der Zensur (Kapitel 4) müssen insbesondere Wendts Umgang mit den Schlüsselbegriffen sowie der Argumentationsaufbau angemahnt werden: Des Öfteren nimmt er entweder in der Zusammenfassung oder der Einleitung eines Kapitels die Ergebnisse der jeweils erst folgenden Analyse vorweg. Schlüsselbegriffe versäumt er fast immer zu definieren: Begriffe wie Barbaren, Fortschritt, Identität, sauvage, Zivilisation/Zivilisierung, nutzt er, ohne sie zu problematisieren. Antike, antike Literatur, obszöne Antike, obszöne Literatur der Antike verwendet er häufig synonym und erweckt so selbst den Eindruck, ‘Antike’ zu homogenisieren – ein Vorgehen, das er in Kapitel 4 kritisiert. Davon abgesehen legt Wendt eine anspruchsvolle und durchdachte Studie vor, der eine breite, aufgeschlossene Rezeption zu wünschen ist. Ihre Stärken liegen in den eindrucksvollen Text- und Gedichtanalysen, mittels derer er die Funktionalisierung obszönen Sprechens und obszöner (antiker) Literatur als soziale Distinktionsstrategie sowohl in antiken griechischen und römischen Gesellschaften als auch in der französischen Oberschicht während des 17. und 18. Jahrhunderts überzeugend aufzeigt.
Funding
Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Additional information
Publisher's Note
Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
Rights and permissions
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
About this article
Cite this article
Brücker, F. Daniel Wendt, Abjekte Antike. Die Obszönität antiker Literatur im Frankreich der Frühen Neuzeit, (Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 2. Reihe, Band 163), Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020, 334 S., inkl. 6 s/w Abbildungen, ISBN 978-3-8253-4724-6, 52€.. Int class trad 30, 338–341 (2023). https://doi.org/10.1007/s12138-023-00642-0
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s12138-023-00642-0