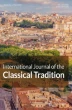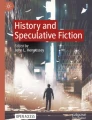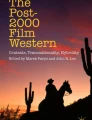Abstract
Joel and Ethan Coen’s film, O Brother Where Art Thou? (2000), which claims to be “based upon ‘The Odyssey’ by Homer”, does not only aim at a broader audience, but also at recipients who are far more familiar with Homer's epic than the average viewer. Although the plot is set in depressionera Mississippi, the movie shows obvious parallels to the Odyssey, generally in describing the adventures of a man returning home to regain his wife and status and more specifically in details of plot, characters, and structure. A significant feature of the movie is that of merging references to unrelated episodes of the Odyssey and of combining references to the Odyssey with reminiscences of other models in a single scene. The authors employ subtle techniques of reference not only to produce a humorous travesty of the Odyssey, but also to reflect implicitly on aspects of continuity and change in history and human life.
Similar content being viewed by others
References
Einen Überblick über diesen Strang der Filmgeschichte bietet G. A. Smith, Epic Films. Cast, credit and commentary on over 225 historical spectacle movies, Jefferson, NC/London: McFarland 1991; s. auch J. Solomon, The Ancient World in the Cinema. Revised and expanded edition, New Haven/London: Yale University Press 2001.
Dazu M. Junkelmann, Hollywoods Traum vom Rom. „Gladiator” und die Tradition des Monumental-films, Mainz: Von Zabern 2004 (Kulturgeschichte der antiken Welt 94), 177–193. Zu Gladiator s. auch M. M. Winkler (Hg.), Gladiator: Film and History, Malden, MA/Oxford/Victoria: Blackford Publishers 2004.
Gleiches gilt im Prinzip für Oliver Stones Alexander (2004), desen Publikumserfolg freilich weit hinter den von Gladiator und Troy gesetzten Maßstäben zurückblieb. Ein von Regisseur Baz Luhrmann angekündigtes, gleichfalls Alexander dem Großen gewidmetes Filmepos wird allem Anschein nach nicht realisiert werden.
Die wesentlichen Produktionsdaten bei P. Körte/G. Seeßlen (Hgg.), Joel & Ethan Coen, Berlin: Bertz 22000, (Film 2) 304. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf das Drehbuch (E. Coen/J. Coen, O Brother, Where Art Thou?, London/New York: Faber 2000; im Folgenden kurz: Coen/Coen) und auf die DVD-Edition (Columbia Tristar Home Entertainment 2000). Bei Abweichungen wird der Wortlaut der Filmfassung zitiert, zur besseren Orientierung unter Verweis auf die Seitenzahl des Drehbuchs.
Ein Kritiker sprach von „a series of bright ideas wondering why they all had been invited to the same film” (R. Ebert, Chicago Sun Times, 29.12.2000, http://rogerebert. suntimes.com/apps/pbcs.dll/ article?AID=/20001229/REVIEWS/12290301/1023), ein anderer vermisste „the driving force of a compelling idea” (C. Ulbrich, „A Man of Qualities. The Coen Brothers Return to Film Noir”, Bull Magazine, 05.12.2001, www.bullmag.com/view.php?ai=12).—Die Resonanz beim Publikum war beachtlich: Die Datenbank Lumiere der Europäischen Audiovisuellen Informations-stelle (www.obs.coe.int) nennt für die Jahre 2000 bis 2003 ca. 8,4 Mio. Besucher in den USA und knapp 4,5 Mio. in Europa. Damit gehört O Brother, Where Art Thou? unter den 1.117 für das Produktionsjahr 2000 verzeichneten Filmen zu den 50 erfolgreichsten (zum Vergleich: Ridley Scotts Gladiator hatte im gleichen Zeitraum in den USA ca 34,1 Mio. Zuschauer, in Europa ca. 31 Mio.).
Coen/Coen 3=Od. 1,1f. in der Übersetzung von Robert Fitzgerald (Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday 1961 u. ö.; dort Verse 1–3).—Der Untertitel der deutschen Verleihfassung („Eine Mississippi-Odyssee”) hat keine Entsprechung im Original.
Vgl. G. Danek, „Die Odyssee der Coen-Brüder. Zitatebenen in O Brother, Where Art Thou?” (in: M. Korenjak/K. Töchterle [Hgg.]: Pontes II. Antike im Film, Innsbruck u. a.: Studien Verlag 2002 [Comparanda: Literaturwissenschaftliche Studien zu Antike und Moderne 5], 84–94 [im Folgenden kurz: Danek]), 86; P. Flensted-Jensen „Something Old, Something New, Something Borrowed. The Odyssey and O Brother, Where Art Thou?” (Classica et Mediaevalia 53, 2002, 13–30 [im Folgenden kurz: Flensted-Jensen]), 14.
G. Seeßlen, „O Brother, Where Art Thou?” (in: Körte/Seeßlen [wie Anm. 4], 209–228), 218.
Vgl. Danek und Flensted-Jensen passim sowie F. Werner, „Die Muse singt den Blues. Joel und Ethan Coens Südstaaten-Odyssee O Brother, Where Art Thou?”, in: W. Erhart/S. Nieberle (Hgg.), Odysseen 2001. Fahrten—Passagen—Wanderungen, München: Fink 2003, 173–188 [im Folgenden kurz: Werner].
Vgl. Flensted-Jensen 29.
K. Jackson, „Unchained Melodies” (Sight and Sound, Oktober 2000, 38f.), 38.
Vgl. Danek 88–91 (Zitate: 91).
Danek 93.
Danek 92; vgl. ders. 91: „Wenn überhaupt, so ist Homers Odyssee nur als der Archetypus eines zeitlosen mythischen Erzählmusters präsent, das mühelos auch in zahllosen Bildern der gesamten Filmgeschichte wiederentdeckt werden kann.”
Danek bezieht sich auf Filmkritiken und auf Internet-Chatrooms.
Vgl. Flensted-Jensen 15; Danek 88f.; Werner 178f.
Eine Einstellung in der Schlussszene von Sullivan's Travels zeigt die fiktive Romanvorlage für Sullivans Projekt: Der Name des Verfassers, „Sinclair Beckstein”, verweist auf zwei bedeutende Kritiker sozialer Missstände in der amerikanischen Gesellschaft ihrer Zeit, Upton Sinclair (1878–1968) und John Steinbeck (1902–1968).
O Brother, Where Art Thou? spielt 1937, Sullivan's Travels 1941. Wichtige Zitate sind die Szene am Beginn von O Brother, Where Art Thou?, in der die Protagonisten auf einen fahrenden Güterzug aufzuspringen versuchen, und die Episode, in der eine Gruppe von Kettensträflingen eine Filmvorführung besucht (zur Verarbeitung dieser Schlüsselszene von Sullivan's Travels s. u. S. 584f.).
Das verhindern schon sein nostalgisch verklärter Blick auf die Epoche und seine Tendenz, aus der Darstellung sozialer Realität pittoreskes und komisches Kapital zu schlagen (etwas anders Danek 89: der Film lasse „hinter der Oberfläche der burlesken Komik eine bedrückende Realität erahnen”). Aktualisierbare satirisch-kritische Züge sind allenfalls in der Charakterisierung von um die Wählergunst buhlenden Politikern und von Rassisten auszumachen.
Erst in der zweiten Filmhälfte erfahren Pete, Delmar und der Zuschauer die Wahrheit: Ulysses wurde verurteilt, wei er ohne Zulassung als Rechtsanwalt praktiziert hat.
Od. 1,66: ὃς πɛρὶ μέὲν νόονἐστὶ.—Zitate aus Homers Odyssee stützen sich auf die Ausgabe von T. W. Allen (Oxford: Clarendon 21917 u. ö.).
Als Pete zu Beginn der Flucht die Führungsrolle des Ulysses in Frage stellt („Who elected you leader a this outfit?”), antwortet dieser: „Well, Pete, I just figured it should be the one with capacity for abstract thought” (Coen/Coen 6f.).
Pete charakterisiert Ulysses treffend als „a know-it-all that can't keep his trap shut” (Coen/Coen 35).
Seine „Listen” dienen dazu, Geldmittel für die Flucht zu beschaffen: Bei Petes Vetter Wash entwendet er eine goldene Uhr. Als der blinde Inhaber des Tonstudios den vier Gefährten ein Honorar von zehn Dollar pro Mann verspricht, entgegnet er (Coen/Coen 29): „Okay sir, but Mert and Aloysius'll have to scratch Xes—only four of us can write.”—Zwei Szenen erinnern überdies an den Οὔτις-Trick des Odysseus (Od. 9,364–367), allerdings ohne dessen sprachliche Raffinesse zu erreichen: Auf die Frage des Studioinhabers, ob die Band „Negro songs” singe, lügt Ulysses: „Sir, we are Negroes” (Coen/Coen 28). Als sich später ein Berater des Gouverneurs O'Daniel nach den „Soggy Bottom Boys” erkundigt, sagt der Studioinhaber: „Oh I remember 'em, colored fellas I believe…” (Coen/Coen 45).
Als die Polizei die Gefährten in Washs Scheune umstellt hat und damit droht das Gebäude anzuzünden, konstatiert Ulysses wiederholt, was nur zu offensichtlich ist: „Damn! We're in a tight spot!” (Coen/Coen 13f.). Seine Idee, das Problem auf dem Verhandlungsweg zu lösen („Maybe we can talk this thing out!” Coen/Coen 15), ist angesichts der Situation von absurder Komik. Im Boxkampf gegen Pennys Verlobten unterliegt er schmählich. Mut und Tatkraft beweist er allein bei Tommys Befreiung aus den Fängen des Ku Klux Klan.
Danek 90 vermutet hinter diesem running gag eine Anspielung auf „den pomadigen Kirk Douglas in der Rolle des Hollywood-Odysseus” (gemeint ist Mario Camerinis Ulisse, Italien/USA 1955).—Eine Szene in einem Gemischtwarenladen (vgl. Coen/Coen 18) verdeutlicht, wie peinlich Ulysses auf die Wahrung seines falschen Selbstbildes bedacht ist: Die von ihm entrüstet zurückgewiesene Pomade der Marke Fop („Geck”) beschreibt seinen Charakter sehr viel treffender als die von ihm bevorzugte Marke Dapper Dan („Der nette/gewandte Dan”).
So bezeichnet ihn eine der Töchter (Coen/Coen 68). Ähnlich wie die homerischen Freier Penelope Gaben überreichen (Od. 18,291–303), hat Waldrip Penny einen wertvollen Ring geschenkt (vgl. Coen/Coen 68), und Ulysses kann buchstäblich riechen, dass sich der Rivale an seinem Besitz vergriffen hat (vgl. Coen/Coen 71): „You been using my hair treatment?” Die Prügelei zwischen Ulysses und Waldrip ist hingegen nicht am Kampf des Odysseus mit den Freiern orientiert (so Flensted-Jensen 21f.), sondern zitiert den Faustkampf mit dem Bettler Iros (vgl. Danek 86).
Dass sich die „Soggy Bottom Boys” für den Auftritt mit langen Bärten maskieren, entspricht der von Athene vorgenommenen Verwandlung des Odysseus in einen alten Bettler (Od. 13,429–438).
Folgerichtig ist es nicht der Unhold, sondern der Held, der hintenüber fallen und seine Mahlzeit wieder von sich geben muss: Nachdem ihn ein Hieb auf den Rücken geworfen hat, speit Ulysses in hohem Bogen Maiskörner aus (vgl. Od. 9,371–374).
Eine zusätzliche Pointe liegt darin, dass der «Kyklop» Teague trotz der überraschenden Peripetie von einem Requisit getroffen wird, das dem mächtigen glühenden Holzpfahl der Odyssee (vgl. Od. 9,375–381) in mancher Hinsicht ähnlicher ist als die Fahnenstange.—Die Blendung des Polyphem wird später erneut zitiert: Als Homer Stokes bei dem Konzertabend das Publikum damit verärgert, dass er den Auftritt der «Soggy Bottom Boys» zu unterbinden versucht, stürmt eine Gruppe von Männern in den Saal, die einen Balken in ihren erhobenen Händen tragen. Sie nähern sich Stokes im Laufschritt, so dass sich das vordere Ende des Balkens genau auf sein Gesicht zubewegt—und heben den protestierenden Politiker dann auf den Balken, um ihn aus dem Saal zu tragen.
Die zweite Odyssee-Hälfte beansprucht nur etwa ein Siebentel der ca. 40 Handlungstage (vgl. J. Latacz, Homer. Der erste Dichter des Abendlands, München/Zürich: Artemis 21989, 176; I. J. F. de Jong, A Narratological Commentary on the Odyssey, Cambridge, UK, New York: Cambridge University Press 2001, 587f.; zu Detailproblemen J. D. Olson, Blood and Iron. Stories and storytelling in Homer's Odyssey, Leiden/New York/Köln: Brill 1995 [Mnemosyne, Bibliotheca classica Batava. Supplementum 148], 91–119).
Die in der ersten Filmhälfte erzählte Zeit lässt sich wie folgt bestimmen: Sechs Mal ist es Nacht (auf Washs Farm; nach der Schallplattenaufnahme; nach dem Bankraub; zwei Mal in der Montage-Sequenz; nach dem Picknick mit «Big Dan» Teague); eine weitere Nacht wird angedeutet, wenn am ersten Fluchttag die Draisine mit dem blinden Seher und den Gefährten in den Sonenuntergang rollt. Andere Zeitangaben weichen geringfügig davon ab (wohl als Folge von Continuity-Fehlern): Pete sagt am Tag der Begegnung mit den Baptisten, es sei der 17. (Juli), und das Tal mit dem vermeintlichen Schatz werde am 21. geflutet (vgl. Coen/Coen 19); gemäß der Tag-Nacht-Gliederung der Erzählung erfolgt jedoch erst am 23. die Flutung des Tals. Die Tageszeitung, die man in der Montage-Sequenz sieht und die vom Erfolg der «Soggy Bottom Boys» kündet (vgl. Coen/Coen 46f.), trägt als Datum den 13. Juli 1937, obwohl nach der eben erwähnten Äußerung Petes die Schallplattenaufnahme erst am 17. Juli stattfindet.
Erster Tag: Ankunft in Ithaca, Begegnung mit Penny, Kinobesuch; in der Nacht: Petes Befreiung, Tommys Rettung, Konzertveranstaltung; zweiter Tag: Suche nach dem Ehering (der Gang zur Waldhütte entspricht dem Gang des Odysseus zum πουδένδρɛος ἀγρός des Laertes; vgl. Od. 23,359f.).
Dazu de Jong (wie Anm. 31) 589f.
Vgl. Od. 1,215f.
Dass der Film die Kalypso-Episode nicht rezipiert, dürfte ähnliche Gründe haben: Penelope ist treu, Odysseus (wenn auch widerwillig) untreu; bei Penny und Ulysses ist es umgekehrt (vgl. Flensted-Jensen 27).
Vgl. Flensted-Jensen 25.
Die «Irrfahrten»-Hälfte enthält vier Szenen, in denen die Gefährten um ein Lagerfeuer versammelt sind. Insgesamt zeigt der Film jedoch kaum Ansätze, die für die homerische Epik charakteristischen Elemente der Formel und der typischen Szene zu adaptieren (die von Werner 175 aufgestellte Behauptung, Ulysses bediene sich «formulaischer Wendungen», bleibt ohne Belege).
Vgl. Coen/Coen 46.
O'Daniel war ab 1925 sales manager in der Firma Burrus Mills and Elevator in Fort Worth (Texas), für deren Produkte er ab 1930 zusammen mit der Band «The Light Crust Doughboys» in regelmäßigen Radiosendungen warb. 1935 gründete er die W. Lee O'Daniel Flour Company und setzte seine Werbestrategie mit der Band «Hillbilly Boys» fort. Von 1938 bis 1941 war er Gouverneur des Staates Texas, von 1941 bis 1949 US-Senator (vgl. G. N. Green, Art. «O'Daniel, Wilbert Lee», The Handbook of Texas Online, www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/ view/OO/fo'4.html; Current Biography 8, 1947, 480–482).
Der als Lester Joseph Gillis in Chicago geborene Nelson verübte u. a. zahlreiche Raubüberfälle. 1931 inhaftiert, konnte er 1932 nach Kalifornien fliehen, wo er kurze Zeit für den Gangsterboss Joe Parente tätig war. Seit jener Zeit nannte er sich George Nelson (den Spitznamen «Babyface» verdankt er Parente). 1934 wurde er bei Chicago von Polizisten erschossen. Vgl. J. R. Nash, Bloodletters and Badmen. A narrative encyclopedia of American criminals from the pilgrims to the present, New York: M. Evans and Co. 1995, 465–467; J. Geringer, «Baby Face Nelson. Childlike mug, psychopathic soul», www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/outlaws/nelson/1.html.
Beide Johnsons (nicht miteinander verwandt) stammen aus Mississippi. Auf den älteren verweist die Filmfigur durch ihren Namen, auf den jüngeren durch historische Details: Die Schallplattenaufnahmen Robert Johnsons Stammen aus den Jahren 1936 (San Antonio, Texas) und 1937 (Dallas, Texas); bei diesen Gelegenheiten kreuzten auch die von O'Daniel gegründeten Bands seinen Weg. Vgl. P. Guralnick, Robert Johnson. Crossroads, St. Andrä-Wördern: Hannibal 1995 (Bibliothek der populären Musik) (zuerst engl.: Searching for Robert Johnson, New York: Dutton 1989); Robert Johnson, The Complete Recordings, Columbia/Legacy 1996 (CD-Edition mit umfangreicher Dokumentation). Die Schallplattenaufnahmen des historischen Tommy Johnson fanden einige Jahre früher statt (1928 und 1930); vgl. D. Evans, Tommy Johnson, London: Studio Vista 1971, 45–68. In der Literatur zu O Brother, Where Art Thou? wird lediglich auf Robert Johnson verwiesen (Danek 88; Flensted-Jensen 27; Seeßlen 213; Werner 179).
Vgl. Guralnick (wie Anm. 42) 23–25; Evans (wie Anm. 42) 22f.; A. Lomax, The Land Where the Blues Began, London/New York: Pantheon Books 1993, 13–15; G. Oakley, The Devil's Music. A history of the blues, London: British Broadcasting Corp. 21983 (Ariel Books), 141.
Vgl. Flensted-Jensen 27f. (Zitat: 28); Werner 179.—Die Episode mit George Nelson ist um das Motiv des Rinderfrevels bereichert: Während einer Verfolgungsjagd schießt der Gangster nicht nur auf Polizeiwagen, sondern auch auf eine Kuhherde am Straßenrand («I hate cows worse than coppers!», Coen/Coen 38). Die panischen Tiere versperren den Verfolgern· den Weg, so dass der «Rinderfrevel» zunächst nicht das verderben, sondern die Rettung bringt (vgl. Danek 93). Als Nelson gegen Ende des Films abgeführt wird, folgt dem Zug der Schaulustigen ein Mann mit einer Kuh, und eine Stimme aus der Menge beschimpft Nelson als «cow-killer» (nicht im Drehbuch; vgl. Coen/Coen 100). Werner 176f. weist darauf hin, dass die von Nelson in wahnwitziger Euphorie beschriebene Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl (vgl. Coen/Coen 100) der Bestrafung des Rinderfrevels durch einen Blitzstrahl des Zeus entspricht.
Vgl. H. G. Adkins, The Historical Geography of Extinct Towns in Mississippi, Diss. Univ. of Tennessee 1972, 21 (Abb. 2) und 22 mit Anm. 42.
Vgl. K. Stann/D. Marshall/J. T. Edge, Deep South, Hawthorn, Vic., Australia: Lonely Planet 1998, 323.
Dazu etwa W. Marg, Gnomon 42, 1970, 225–237 (Rez. von H.-H. Wolf/A. Wolf, Der Weg des Odysseus. Tunis—Malta—Italien in den Augen Homers, Tübingen: Wasmuth 1968 [Die grossen Rätsel der Vergangenheit 1]). Grundsätzliches zur Irrfahrten-Geographie: U. Hölscher, Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman, München: C. H. Beck 1988, 141–144.
So Danek 93, Flensted-Jensen 17f., Werner 175f.; vgl. u. S. 587f.
Was der blinde Seher nicht erwähnt: Der Verfolger Poseiden hat seine Entsprechung in der unheimlichen Figur des Sheriffs Cooley, der einer metaphysischen Ebene anzugehören scheint. Die Beschreibung, die Tommy Johnson vom Teufel gibt, trifft auf ihn zu («He's white—as white as you folks, with empty eyes an' a big hollow voice. He loves to travel around with a mean old hound», vgl. Coen/Coen 27), und als sich die Gefährten bei der letzten Begegnung mit ihm auf das Gesetz berufen, antwortet er verächtlich (Coen/Coen 104): «The law. Well the law is a human institution.» Vgl. Werner 185; Flensted-Jensen 22.
Zur Funktion solcher Vorwegnahmen s. de Jong (wie Anm. 31) zu Od. 1,16–18.
Vgl. Danek 86f.
Auch damit steht der Film (aber wohl unbewusst) in antiker Tradition: Die Technik der Kontamination ist ein Hauptmerkmal vergilischer Homer-Rezeption; vgl. G. N. Knauer, Die Aeneis und Homer. Studien zur poetischen Technik Vergils mit Listen der Homerzitate in der Aeneis, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1964 (Hypomnemata 7), 332–345; ders., «Vergil and Homer», in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt/Rise and Decline of the Roman World (ANRW) II 31.2, Hg. W. Haase, Berlin-New York: Walter de Gruyter 1981, 870–918.
Zumal wenn Delmar die Frauen als «sigh-reens» (Coen/Coen 51) bezeichnet. Dies ist die einzige stelle, an der eine Figur (ironischerweise der naive Delmar) zumindest über eine Andeutung auktorialen Wissens verfügt.
In der Verführungsszene, noch vor Petes (vemeintlicher) Verwandlung in eine Kröte, umfasst eine der «Sirenen» in einer zärtlichen Geste Delmars Kinn und Wangen, so dass sein Mund die Form eines Schweinerüssels annimmt.
Die «Sirenen» waschen Wäsche wie Nausikaa. Dass der angeschlagene Ulysses nach der Verführung mit dem Ausruf «My hair!» (nich im Drehbuch, vgl. Coen/Coen 50f.) aus dem Schlaf fährt, erinnert an den kläglichen Zustand, in dem Odysseus auf Scheria erwacht und sich den Phaiakentöchtern zeigt.
Vgl. Danek 85f.; Werner 176.
«Schweineschinder»; vgl. Werner 176.
Auch ein Schwein fehlt nicht: Bei der Flucht aus der brennenden Scheune rettet Delmar ein kleines Schwein aus den Flammen.
Gleich nach der Ankunft des Odysseus schlachtet Eumaios zwei Ferkel und setzt sie dem Fremden vor (Od. 14,72–80; Werner 176 verweist auf die Bewirtungsszene Od. 14,414–426).
Auch in der Odyssee ist ausdrücklich vermerkt, dass die untreue Gattin fortging; vgl. Od. 8,362f.
Vgl. Latacz (wie Anm. 31) 182–185 (Zitat: 184).
Hier ist besonders auf Od. 6,226–231 zu verweisen: Unmittelbar nach seiner Begegnung mit Nausikaa wäscht und salbt sich Odysseus; seine Frisur wird von Athene „wiederhergestellt” (ähnlich Od. 23,157f.).
Danek 93 hingegen sieht in der Situation eine Anspielung auf „Odysseus zwischen Skylla und Charybdis”.
Dieser Diebstahl ist nicht nur die Inversion der Gastgeschenke, die Odysseus von Scheria mitnimmt, sondern setzt überdies—in ebenfalls invertierter Form—eine in der Phaiakis angedeutete Möglichkeit in Realität um: Nachdem Arete Odysseus eine Truhe für seine Geschenke gegeben hat (Od. 8,438–441), weist sie ihn an, diese gut zu verschließen, damit niemand etwas von den Gaben entwende (Od. 8,443–445). Zu diesem Vorverweis auf die Landung des Odysseus in Ithaka und zur Bedeutung der Phaiaken-Geschenke innerhalb der Ithaka-Handlung s. de Jong (wie Anm. 31) zu Od. 8,442–448 bzw. zu 13,120–124.
Vgl. Flensted-Jensen 18; Danek 87; Werner 176.
So Danek 87, der diese Rezeption des Lotophagen-Abenteuers als „Paraphrase des Schlagworts von der ‘Religion als Opium für das Volk’” (ebd.) interpretiert.
Coen/Coen 25. Eine Kongruenz zwischen den Lotophagen und den Baptisten ist auch darin zu erkennen, dass beide Gruppen den Nostos ohne böse Absichten retardieren (vgl. Od. 9,92f.).
Ulysses kommentiert den Anblick der Prozession hochnäsig (Coen/Coen 23): „I guess hard times flush the chumps. Everybody's lookin' for answers (…).” Delmar stürzt sich jedoch sofort ins Wasser, und Pete lässt sich von Ulysses' Einwänden („Pete, don't be ignorant…”, Coen/Coen 24) nicht daran hindern, ihm zu folgen.
Vgl. Od. 9,39–54. 154–164.
Als die chain gang, in der Sullivan seine Strafe verbüßt, in einer ländlichen Kirchengemeinde eine Filmvorführung besuchen darf, amüsiert sich der eigentlich verzweifelte Protagonist köstlich über einen Disney-Trickfilm und erkennt zu seiner Verwunderung, welche Bedeutung belanglose Unterhaltung für Menschen in hoffnungsloser Lage haben kann. Vgl. Danek 89.
Die Flexibilität der Coen'schen Odyssee-Rezeption zeigt sich auch darin, dass der hier dem homerischen Elpenor entsprechende Pete an anderer Stelle eher an den gegen Odysseus aufbegehrenden Eurylochos erinnert: Mit Coen/Coen 6f. (zit. o. Anm. 22) und 89 („Wait a minute—who elected you leader a this outfit? Since we been followin' your lead we got nothin' but trouble!”) vgl. Od. 10,429–437 und 12,278–293; dazu Danek 90; Werner 174 (dessen Vermutung, Elpenor habe für die Figur Delmars Pate gestanden, allerdings nicht überzeugt).
Flensted-Jensen 22 vermutet wenig plausibel, die Nekyia sei in der Ku Klux Klan-Szene rezipiert.
In dem Restaurant, in dem Ulysses und Delmar den Bibelverkäufer kennenlernen, sieht man im Hintergrund eine Homer-Büste (einem verbreiteten Portrait-Typ nachempfunden; vgl. K. Schefold, Die Bildnisse der antiken Redner, Dichter und Denker, Basel: Schwabe 1943, 142–145). Der blinde Inhaber des Tonstudios, in dem Ulysses und seine Gefährten den Song I Am a Man of Constant Sorrow aufnehmen (der wie die Odyssee einen Leidgeprüften besingt), erinnert an die Vorstellung vom blinden Sänger Homer; durch den Song werden die „Soggy Bottom Boys” berühmt, wie Odysseus durch Homer bekannt wurde (vgl. Flensted-Jensen 22f. und Danek 93, der die Homer-Büste irrtümlich in das Tonstudio versetzt). Dass der Herausforderer des Gouverneurs mit Vornamen Homer heißt, scheint eher der Irreführung zu dienen; Danek 94 sieht eine Beziehung darin, dass sich Stokes schließlich als „the only man in our great state who ain't a music luvva” (Coen/Coen 97) erweist.
Besonders in der Sprache des Ulysses (vgl. Werner 175 Anm. 5), wo Ausdrücke griechischer oder lateinischer Provenienz oft komische Stilbrüche erzeugen: Bei Landstreichern erkundigt er sich, ob sie „trained in the metallurgic arts” (Coen/Coen 6) seien, zu Wash sagt er (13): „I guess it'd be the acme of foolishness to inquire if you had a hairnet.” Weitere Beispiele (Sprecher ist Ulysses, wenn nicht anders angegeben): „consensus” (7), „impedimenta” (10), „Ay-More Fiedellis” (20; so liest Pete die Gravur amore fidelis auf Washs Taschenuhr), „odor” (25), „obtuse” (35), „fornicating” (52); „conversational hiatus” (57; Teague), „bona fide” (68; Ulysses' Töchter), „pater familias”, „succubus” (72), „pab-you-lum” (82; Pete meint „pabulum”); „refugium” (101). Auch einfallsreiche Epitheta finden Verwendung: Pete bezeichnet Wash, auf das Pferdefleischgericht anspielend, als „hoss-eatin' sonofabitch” (14), Delmar spricht von Bankiers als „foreclosin' sonofaguns” (33), Nelson nennt seine Verfolger „miserable salaried sonsabitches” (39).
Vgl. Coen/Coen 65: „(…) the little man has admonished me to grasp the broom a ree-form and sweep this state clean!”
In der Radiosendung, die während der Szene in Washs Wohnstube im Hintergrund läuft (vgl. Coen/Coen 13).
Vgl. seine Hetzrede in der Ku Klux Klan-Versammlung (Coen/Coen 84).—Werner 183 Anm. 25 weist auf die Ironie hin, die darin liegt, dass die Sprache des Rassisten Stokes „gänzlich von der afro-amerikanischen Kultur durchdrungen ist”.
Vgl. W. L. Welch/L. B. S. Burt, From Tinfoil to Stereo. The acoustic years of the recording industry. 1877–1929, Gainesville, FL u. a.: University Press of Florida 1994, 102 und 113. Das Markenzeichen basiert auf Arbeiten des englischen Malers Francis Barraud (1856–1924).
Zit. o., S. 581.
Würde Ulysses die Odyssee kennen, könnte er sich hier sogar auf das Zeichen der Kuh auf dem Scheunendach berufen: Die Prophezeiung des Blinden und ihre Erfüllung entsprechen dem von Teiresias prophezeiten Worfschaufel-Zeichen (Od. 11,119–137), an dem Odysseus das Ende seiner Mühsal erkennen soll und von dem er Penelope berichtet (Od. 23,248–284). Vgl. Danek 85 Anm. 4; anders Flensted-Jensen 18, die im Kuh-Orakel einen Bezug zur Warnung vor dem Rinderfrevel erkennt.
Dies verheißt Teiresias in seinem Worfschaufel-Orakel dem Odysseus (Od. 11,134–136; vgl. Od. 23,281–283).
Zur hiermit angedeuteten zirkulären Konzeption s. Werner 187f.
Ulysses hat ohne Zulassung als Rechtsanwalt praktiziert (vgl. o. Anm. 20); während der Konzertveranstaltung verärgert er Penny mit der Ankündigung eines ähnlichen Betruges (Coen/Coen 91): “I got big plans! (…) I'm gonna be a dentist! I know this guy who'll print me up a license!” Als Penny der Heirat zugestimmt hat und Ulysses vorschlägt, den Ring zu verwenden, den Waldrip ihr geschenkt hat, äußert sie Zweifel an seinem Sinneswandel (“We ain't gettin' married with his ring! You said you'd changed!”, Coen/Coen 99) und macht die Beschaffung des alten Eheringes zur Bedingung.
Bezeichnenderweise spazieren Ulysses und Penny in dieser Szene an einer Reklametafel vorbei, die “Power & Light” preist, also ebenfalls auf das anbrechende neue Zeitalter verweist.
Additional information
Für Anregungen und Kritik danke ich Gerhard Binder, Ulrich Hamm, Thomas Paulsen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars „Antike im Film” (Bochum, Sommer-Semester 2004).
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Heckel, H. Zurück in die Zukunft via Ithaca, Mississippi: Technik und funktion der Homer-rezeption in O Brother, Where Art Thou? . Int class trad 11, 571–589 (2005). https://doi.org/10.1007/s12138-005-0019-y
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s12138-005-0019-y