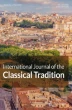Abstract
No other ancient author used Lucretius as intensively as the Christian Lactantius did. This has been widely examined for Lactantius' prose writings. But also in his elegy De ave Phoenice, the first Christian poem following classical poetic tradition, we find Lucretius' influence, especially in the epilogue (Phoen. 161–170), where the bird Phoenix appears as an allegory of the redeemed man. Here Lactantius converts Lucretius' famous equation (1, 1–3) ‘Venus=pleasure=living nature’ into its opposite: For Phoenix, death=pleasure =Venus, as he ‘gains eternal life by the good of death.’
Similar content being viewed by others
|o
Die folgende, gegenüber der bei der 4. ISCT-Tagung in Tübingen am 29.7.1998 gebotenen längere Fassung gibt überarbeitet einen Vortrag bei den 18. Metageitnia (Symposion der Klassischen Philologen der Universitäten Basel, Bern, Freiburg/Br., Freiburg/Ue., Konstanz, Mülhausen, Straßburg, Tübingen, Zürich) in Basel am 25.1.1997 wieder. Für technische Hilfe danke ich Gesine Bechtloff, M.A.
Über ihn A. Wlosok, Handbuch der lateinischen Literatur der Antike (HLL) § 570=Bd. 5, München 1989, 375–404; knapp mit wenigen neueren Literaturangaben mein Artikel in Der Neue Pauly, Bd. 6, Stuttgart 1999, 1043–1044, und ausfürlicher E. Heck—G. Schickler, in: Lactantius, Göttliche Unterweisungen in Kurzform, übers. v. E. H. u. G. S., München/Leipzig 2001, 11–29.
Tertullian, Minucius Felix, Cyprian, Commodian, Arnobius, Lactanz; vgl. die Beiträge zu diesen Autoren von H. Tränkle, A. Wlosok und mir in HLL 4 (München 1997) und 5 (ebd. ausfürlicher E. Heck—G. Schickler, in: Lactantius, Göttliche Unterweisungen in Kurzform, übers. v. E. H. u. G. S., München/Leipzig 2001, 11–29. 1989).
L. Caeli Firmiani Lactanti Opera omnia, edd. S. Brandt—G. Laubmann (nur mort. pers.), Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) 19 (Wien 1890; Neudr. New York 1965); 27,1 (Wien 1893; Neudr. New York 1965), 27,2 (Wien 1897; Neudr. New York 1965). Zu neueren Editionen s. den Index zum Thesaurus linguae Latinae (TLL), 2. Aufl. Leipzig 1990, 139 und E. Heck, Gnomon 64, 1992, 594 Anm. 1; dazugekommen ist Lact. epit. edd. E. Heck—A. Wlosok, Stuttgart/Leipzig 1994.
S. Brandt, “Lactantius und Lucretius”, Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 143, 1891, 225–259.
O. Seel, Eine römische Weltgeschichte, Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft 39, Nürnberg 1972, 12 “Aneignungsprozeß heidnischer Literatur durch christliche Autoren”; vgl. K. Büchner, “P. Vergilius Maro”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE) 8 A (1955/58) 1021–1486, hier 1463 “haben sich die Christen Vergil völlig angeeignet”. Meine Verwendung des nicht unumstrittenen Begriffs ‘Aneignung’ (zuerst in: MH ΘEOMAXEIN oder: Die Bestrafung des Gottesverächters. Untersuchungen zu Bekämpfung und Aneignung römischer religio bei Tertullian, Cyprian und Lactanz, Studien zur klassischen Philologie 24, Frankfurt/M./Bern 1987) ist angeregt durch den Titel von A. Wlosoks unten Anm. 49 zu nennender Arbeit.
K. Ziegler, “Der Tod des Lucretius”, Hermes 71, 1936, 421–440.
E. Heck, “Lactanz und die Klassiker. Zu Theorie und Praxis der Verwendung heidnischer Literatur in christlicher Apologetik bei Lactanz”, Philologus 132, 1988, 160–179.
Lact. inst. 7,27,6 aus Lucr. 6,24–28; dazu Heck, “Lactanz und die Klassiker”, 175–179 mit früherer Literatur.
V. Buchheit, “Cicero inspiratus—Vergilius propheta?”, Hermes 118, 1990, 357–371, hier 358 Anm. 9, warf mir vor, ich hätte den “Sachverhalt auf den Kopf gestellt”, er mußte dazu freilich Dinge in den Lactanztext hineinlesen, die nicht dastehen (so, “daß Laktanz…Lukrez in den Zeugenstand treten und bekennen läßt, daß er dem falschen Heilsbringer aufgesessen ist”). Buchheits hier und andernorts, auch gegen andere Mitforscher (A. Wlosok, P.G. van der Nat), gezeigter ‘Fundamentalismus’ ist wissenschaftlicher Diskussion so wenig zugänglich wie seine an ein ‘Revanchefoul’ auf dem Fußballplatz erinnernde ‘Wertung’ meiner Rezension der Dissertation seines Schülers A. Bender (365 Anm. 42); diskutabel ist nur Buchheits (358. 364 f.) Kritik meiner Unterbewertung des paene vor diuina uoce Lact. inst. 6,8,6 von Cicero. A. Goulon, “Lactance et les classiques”, Vita Latina 133, 1994, 29–36, hier 35 m. Anm. 15 hat sich knapp gegen Buchheit in meinem Sinne geäußert.—Als Repertorium aller ‘Ketzereien’ von A. Wlosok, mir und anderen sowie aller ‘rechtgläubigen’ Beiträge Buchheits zu Lactanz nützlich V. Buchheit, “Laktanz und seine testimonia veritatis”, Hermes 130, 2002, 306–315.
Zu seinem Leben und Werk Wlosok, HLL 5, 374–402.
Dazu Wlosok, HLL 5, 398–401; s. auch unten Anm. 16, 26 und 59.
S. Brandt, “Zum Phoenix des Lactantius”, Rheinisches Museum N.F., 47, 1892, 390–403.
Hier. uir. ill. 80,2 (ed. A. Ceresa-Gastaldo, 1988), ‘Oδoιπoρικóv de Africa usque Nicomediam hexametris scriptum uersibus.
M. Walla, Der Vogel Phoenix in der antiken Literatur und der Dichtung des Laktanz, Diss. phil. Wien 1969.
A. Wlosok, “Die Anfänge christlicher Poesie lateinischer Sprache: Laktanzens Gedicht über den Vogel Phoenix” (1982), in: A. W., Res humanae—res divinae. Kleine Schriften, hrsg. von E. Heck—E. A. Schmidt, Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, N.F., 2. Reihe, Bd. 84, Heidelberg 1990, 250–278 (im Anhang vollständiger Text und antike Zeugnisse); dies., “Originalität, Kreativität und Epigonentum in der spätrömischen Literatur” (1983), in: A. W., Res humanae—res divinae, 233–249, hier 240–246. Diesen Arbeiten Antonie Wlosoks, die ich seit 1979 begleiten durfte, verdanken meine Darlegungen Entscheidendes, ebenso späteren Gesprächen mit ihr.
Dazu unten S. 514–516.
Commodians Dichtungen sind früher (zwischen 250 und 260), aber antiklassisch. Vgl. E. Heck, HLL 4, 628–634, hier 633 f. 635 f.; demnächst ausführlicher “Commodianus”, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt/Rise and Decline of the Roman World (ANRW) II 27.
W. Richter, “Zwei spätantike Gedichte über den Vogel Phoenix”, Rheinisches Museum N.F. 136, 1993, 62–90.—H. Walter, der den Aufsatz zum Druck gab, hat Richters Andenken keinen guten Dienst erwiesen; A. Wlosoks Beitrag von 1982 (oben Anm. 16), den er am Ende (92 Anm. 52) nennt, hat er nicht verstanden oder nicht gelesen. Walter macht auch kaum kenntlich, was von ihm als Herausgeber hinzugefügt ist—nur Anm. 52 bezeichnet er als eigenen Zusatz, obwohl auch Anm. 1 und 2 von ihm stammen—und hat offenbar Richters Literaturangaben und-auswertung nicht überprüft (falsch z.B. 78 mit Anm. 20—Brandt hat den Phoenix nie krypto-, sondern nur vorchristlich gedeutet; Richter schreibt bei Walla 132–134 falsch ab—, 79 oben—Krüger beließ Commodian im 3. Band der Literaturgeschichte, datierte ihn aber spät).
Claud. carm. min. 27 (ed. J. B. Hall, Leipzig 1985).
Richter, passim, bes. 62 f.; 80 f. Seinem Streben, mit der Autorschaft des Lactanz “das einzige äußere Argument für die Datierung” der Phoenix-Elegie (62) zugunsten “innerer Argumente” (62) oder “qualitativer Kriterien” (80) zu beseitigen, opfert Richter mit dem völligen Bestreiten der Existenz römischer Dichtung im 3. Jh. (68 f.; zu korrigieren nach Wlosok, Res humanae—res divinae, 235 f.; 238, die Lactanz mit Nemesian einem klassizistischen Neuanfang ab 280 zuordnet, wobei sie Commodian, den Richter durch Spätdatierung eliminiert, übergeht; vgl. oben Anm. 18) sogar eigenes besseres literaturgeschichtliches Wissen—der Kommentator von Vergils Georgica kannte doch Nemesian?
Wlosok, HLL 5, 400, wo weitere Literatur.
Richter 83–86; z.B. ist Phoen. 110 nec cuiquam implumem pascere cura subest (“und niemandem untersteht die Sorge für die Ernährung des Federlosen”), wo Richter 81 Anm. 32 subit lesen will, durch Ov. ars 1,396 notitiae suberit semper amica tuae (“Deine Freundin wird immer deinem Wissen von ihr unterliegen”) gedeckt; v. 78 soll nach Richter 83 se tamen ipsa creat (“sich indes schafft er selber”) nur ein “logisch unkorrekt” an nam perit, ut uiuat (“denn er geht zugrunde, um zu leben”) angehängter Versfüller des “Nachahmers” sein, aber perit und se creat stehen einander gegenüber. Zur Liste 86 Anm. 40 (wo man einen Staatsanwalt zu hören meint: “Nachweise … mögen beckmesserisch klingen, aber die Härte des Urteils verlangt sie”) dies: Die Rüge zu 7 f. ignoriert wie die Paraphrase 64 “völlig eben, bis auf einen Berg”, daß es sich um eine die Berge dieser Erde überragende Hochebene handelt; 32 unica, sed uiuit morte refecta sua (“einzig, lebt aber, durch seinen eigenen Tod wiedererschaffen”) ist sed durchaus adversativ—der eine Phoenix ist nicht, wie man unica zunächst versteht, das zeitweise oder ewig vorhandene einzige Exemplar, sondern er bleibt als der eine ewig durch regelmäßige Erneuerung im Tode-, zudem gibt es bei Lactanz kopulativ-steigerndes sed (so epit. 22,8; s. Heck—Wlosok, Ausg. und “Zum Text der Epitome divinarum institutionum des Laktanz”, Wiener Studien 109, 1996, 145–170, hier 153).—Leider sind Richters Rügen nicht schon durch die kommentierte Ausgabe von M.C. Fitzpatrick (Diss. Philadelphia 1933) und die Erläuterungen bei Walla 148–183 erledigt; ein allseitiger Kommentar zum Phoenix ist Desiderat; s. unten Anm. 55.
Richter 69; 71 (dazu dies: immortalitas ist bei Lactanz als Bestimmung des Menschen zentral—vgl. Brandts Sachindex unter den CSEL 27,2, 315 b genannten Lemmata, bes. bonum ebd. 287 a-, nur paßt es nicht in Distichen); 80–82 u.ö. Zur Biographie des Lactanz, in der Richter 75; 77 f. keinen Ort für den Phoenix findet, nennt er 77 Anm. 25 (und benutzt mit Fehlern) nur J. Stevenson, “The life and literary activity of Lactantius”, Studia Patristica 1 (=Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 63, Berlin 1957), 661–677, und das ist seit A. Wlosoks Arbeiten 1960/61 (s. Wlosok, Res humanae—res divinae 9 Nrn. 5 u. 6; vgl. ebd. 213 Anm. 45) veraltet; nach 1975 (vgl. Richter 75 Anm. 23) über Lactanz zu schreiben, ohne Wlosok zu benutzen (nur Walter nennt sie Anm. 52), ist ein Kunstfehler.
C. Schäublin, “Zur ‘Alcestis Barcinonensis’”, Museum Helveticum 41, 1987, 174–181, hier 180 f.
Wlosok, HLL 5, 398–401; nachzutragen: Bryce (unten Anm. 51); Wlosok, “Wie der Phoenix singt”, in: Musik und Dichtung. Festschrift V. Pöschl, hrsg. von M. von Albrecht—W. Schubert, Frankfurt/M./Bern 1990, 209–222; J. Fontaine, “Un ‘paradis’ encore bien classique: le prélude du poème De aue Phoenice (v. 1–29)”, in: Hommage à R. Braun, hrsg. von J. Granarolo—M. Biraud, Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice 56, Paris 1990, II 177–192; Richter (oben Anm. 19).
Ausführlich Wlosok, Res humanae—res divinae 258–261.
Unten S. 517–522.
Dazu umfassend mit Abbildungen R. van den Broek, The myth of the Phoenix according to classical and early Christian tradition, Etudes préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain 24, Leiden 1971; Überblicke bei Walla 51–118; Wlosok, Res humanae—res divinae, 254–258; im Anhang 274–278 antike Zeugnisse, u.a. Herodot 2,73; Ezechiel, ’Eξαγωγή = Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF) I2 128 (edd. B. Snell—R. Kannicht, Göttingen 1986, 288–301), 248–269 (hierzu vgl. Wlosok, “Wie der Phoenix singt” [oben, Anm. 26], 210–212, wo Anm. 2 die heute maßgebende Literatur); Ov. met. 15,391–497; Plin. nat. 10,2.
Wlosok, Res humanae—res divinae, 245; 261, auch zur Kombination konkurrierender Motive.
Dazu Wlosok, Res humanae—res divinae, 241 f. (mit Dokumentation); 257 f.; im Anhang 274 Tert. resurr. 13,1–3; 277 f. I Clem. 25,1–26.1.
Wlosok, Res humanae—res divinae, 245 f., ausführlich 261–267.
Lact. inst. 2,12,15–19. epit. 22,2–4 (mit anderen Parallelen; s. unsere Ausg.); vgl E. Heck, Die dualistischen Zusätze und die Kaiseranreden bei Lactantius, Abhandlunge der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 1972,2, Heidelberg 1972, 106–111.
Lact. opif. 19, 8–10; inst. 7,5,1–6,2; vgl. A. Wlosok, “Römischer Religions-und Gottesbegriff in heidnischer und christlicher Zeit” (1970), in: A. W., Res humanae—res divinae, 15–34, hier 30–34 mit ihrer schönen Übersetzung der lactanzischen ‘Telosformel’ oder (so Wlosok) ‘heilsgeschichtlichen Summa’ inst. 7, 6.1.
Wlosok, Res humanae—res divinae, 243 mit Anm. 44; 265. Die wegen der syntaktischen Rubrizierung verstreuten Belege TLL III 1842, 18–23. 61–66. 1843, 41 f. (anders 1841, 65 Claud. carm. min. 27,94, von Lact. abhängig). Zugrunde liegen Luc. 23,46 (vgl. Ioh. 10,17 ego ponam animam meam); 1. Petr. 4,19.
Dazu Wlosok, Res humanae—res divinae, 244 f.; 268 u.ö.
J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l'occident chrétien. Esquisse d'une histoire de la poésie latine chrétienne du Ille au Vle siècle, Paris 1981, 56 erwägt, ob der Phoenix “la manifestation d'un prudent crypto-christianisme” und “pendant la grande persécution” verfaßt sei (66 bevorzugt er die Datierung auf 326; s. unten Anm. 51). Das schließt die ebenda herausgestellte von Lact. inst. 1,11,22–31 vertretene allegorische Mythendeutung nicht aus; dazu unten S. 516, Anm. 48.
J. Fontaine, Aspects et problèmes de la prose d'art latine au III e siècle, Lezioni “Augusto Rostagni” 4, Turin 1968, 99‐121 passim (daher übernimmt Wlosok, Res humannae—res divinae, 245 mit Anm. 49 den Terminus); 149; dagegen Heck, HLL 4 (1997), 516 (Lit. 4) zu Minucius Felix.
Fontaine, Aspects et problèmes, 98 (Überschrift); 119 u.ö.; 151 “le cryptochristianisme de Minucius Félix” gegenüber Cyprian.
So Fontaine, Aspects et problèmes, 158; 159 u.ö.; Cyprian als ‘styliste chrétien’ ebd. 149 (Überschrift) u.ö. Diese Deklarierung gewinnt Fontaine 161 aus Cypr. ad Donat. 2 (ähnlich Wlosok, HLL 4, 555; vgl. dies., ebd. 438; s. aber unten Anm. 43); dort ist der dem abgelehnten Prunk weltlicher Rhetorik gegenübergestellte, der Verkündigung von Gottes Wort (ad diuinam indulgentiam praedicandam) angemessene Stil als lauter und schlicht (uocis pura sinceritas [“reine Lauterkeit des Wortes”]; rudi ueritate simplicia [“einfach in unverbildeter Wahrheit”]), aber eben nicht als ‘christlich’ bezeichnet, woran nichts ändert, daß er bei Christen Nachfolger fand.
Fontaine, Aspects et problèmes, 121; etwas anders 111; 119; dasselbe von Cyprian ebd. 152.
Zu diesem von J. Schrijnen und seinen Schülern, bes. C. Mohrmann, seit 1932 inaugurierten Phantom kurz-in einer guten Skizze des Einflusses der Christen auf die lateinische Sprache-J.B. Hofmann-A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, Handbuch der Altertumswissenschaft 2. Abt., 2. T., 2. Bd., München 1965, 44* f. mit Literatur; mit Recht ablehnend K. Thraede, “Untersuchungen zum Ursprung und zur Geschichte der christlichen Poesie I”, Jahrbuch für Antike und Christentum 4, 1961, 109 Anm. 7a; vgl. Heck, HLL 4, 634 (Lit. 8), zu einem lexikalischen Beispiel Heck, Die Bestrafung des Gottesverächters (oben Anm. 6) 50 Anm. 29.
Vgl. Wlosok, HLL 4, 437 f. Wenn sie hier Cyprians “Stil der erbaulichen geistlichen Rede” (vgl. H. von Campenhausen, Lateinische Kirchenväter, Stuttgart 1960, 47; ebd. 55 meint “christlich” den Inhalt) “spezifisch christlich” nennt, möchte ich ihr nicht folgen. Daß E. Norden, Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, 4. Aufl. Leipzig 1918/25=5. Aufl. Darmstadt 1958, II 615–624 Cyprian (618–621) und Augustin unter der Überschrift “Der Stil der Predigt in Afrika” behandelt, entspricht Cypr. ad Donat. 2 (oben Anm. 40); sein Urteil (621), daß “der manierierte Schwulst der sophistischen Prosa von der spezifisch christlichen Beredsamkeit ausgeschlossen wurde”, legitimiert m.E. noch nicht den Terminus ‘christlicher Stil’.
Dazu Wlosok, HLL 5, 382–385; vgl. dies., Res humanae—res divinae, 448.
Lact. opif. 20,1 haec ad te, Demetriane, interim paucis et fortasse obscurius quam decuit pro rerum ac temporis necessitate peroraui; vgl. 1,1.
Lact. opif 1,7 ille conluctator et aduersarius noster scis quam sit astutus et idem saepe uiolentus, sicuti nunc uidemus (“unser bekannter Widersacher und Gegner, du weißt, wie verschlagen der ist und zugleich oft gewalttätig, wie wir zur Zeit erleben”) … 9 memento et ueri parentis tui et in qua ciuitate nomen dederis et cuius ordinis fueris; intellegis profecto quid loquar (“Besinne dich sowohl auf deinen wahren Vater als auch darauf, in welcher Bürgergemeinde du dich hast registrieren lassen und Angehöriger welchen Truppenteils du geworden bist; du verstehst doch wohl, was ich sagen will”).
Die Oratio ad sanctorum coetum (ed. I. Heikel, Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte [GCS] 7=Eusebius, Opera 1, 1902), deren Autorschaft ich 1972 (Die dualistischen Zusätze 141 Anm. 17) skeptisch beurteil habe, scheint mir nach A. Wlosoks unten Anm. 49 zu nennender Arbeit doch von Constantin zu stammen, kann dann aber frühestens auf 325 datiert werden (dazu Wlosok, Res humanae—res divinae, 444 mit Anm. 16).
Lact. inst. 1,11,23–25 (epit. 11,1), bes. 24 cum poetae officium in eo sit, ut ea quae uere gesta sunt in alias species obliquis figuris cum decore aliquo conuersa traducat (“da die Aufgabe des Dichters darin besteht, daß er das, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, durch Figuren anderer Bedeutung mit einer Art Schmuck umwandelt und so in andere Bilder überführt”). Dazu Wlosok, Res humanae—res divinae, 253; 454 u.ö. (s. Stellenregister).
Constantin, Or. ad sanct. coet. 19–21; dazu A. Wlosok, “Zwei Beispiele frühchristlicher ‘Vergilrezeption’: Polemik (Lact. div.inst. 5,10) und Usurpation (Or. const. 19–21)” (1983), in: A.W., Res humanae—res divinae, 437–459, hier 444–453; zur Vermittlung der allegorischen Dichtungskonzeption durch Lactanz ebd. 453–455.
Wlosok, Res humanae—res divinae, 246; vgl. 444.
Dazu Wlosok, Res humanae—res divinae, 242 mit Anm. 40; HLL 5, 400, hier mit Recht abgelehnt die vom Medaillon RIC VII 279 (ed. P.M. Bruun, London 1966, 328) angeregte Datierung auf Constantins Vicennalien 326 durch J. Fontaine, Gnomon 45, 1973, 210 (Rezension von Walla [ob. Anm. 15]); Naissance de la poésie, 66; ebenso verfehlt J. Bryce, “Lactantius' De ave Phoenice and the religious policy of Constantine the Great”, in: Studia Patristica 19 (Leuven 1989), 13–19.
Lact. opif. 20,3 inst. 5,4,1–8; dazu Heck, “Lactanz und die Klassiker”, 163 f.; 167–171; A. Wlosok, “Zur lateinischen Apologetik der constantinischen Zeit” (1989), in: A.W., Res humanae—res divinae, 217–232, hier 221–223.
Wlosok, Res humanae—res divinae, 222 f.; 269; 434 Anm. 38.
Lact. inst. 6,21,4–9-im Rahmen der aurium uoluptas (6,21,1; vgl. 5,1,10–14 zur Rhetorik)-, hier 6,21,9 si uoluptas est audire cantus et carmina, dei laudes canere et audire iucundum sit (“wenn es Lust ist, Gesang und Lieder zu hören, so soll es vergnüglich sein, Loblieder auf Gott zu singen und zu hören”).
Vgl. den Similienapparat bei Brandt, CSEL 27,1, 137–147, die kommentierte Ausgabe von Fitzpatrick (ob., Anm. 23) Diss. Philadelphia 1933) und die Erläuterungen bei Walla 148–183 erledigt; ein allseitiger Kommentar zum Phoenix ist Desiderat; s. unten Anm. 55 und die Erläuterungen bei Walla 148–183. Auch für die dichterischen Quellen oder Vorbilder gilt (s. oben Anm. 23), daß ein umfassender Kommentar zum Phoenix—auf der Grundlage von und in überprüfender Auseinandersetzung mit A. Wlosoks Deutung des Gedichts-Desiderat ist.
Dazu Wlosok, Res humanae—res divinae, 263; vgl. Fitzpatrick z. St.
Lact. inst. 1,1,22; dazu Heck, “Lactanz und die Klassiker”, 168 mit Anm. 52 (Literatur).
Lactanz beachtet mit den auch bei Ovid vorkommenden Ausnahmen Regeln wie zweisilbigen Pentameterschluß (7 Ausnahmen: 42 exoriens; 74 purpureum; 98 in cineres; 104 in speciem; 106 exuuiis; 114 effigiem; 150 usque hominum) und zwei-oder dreisilbigen Hexameterschluß (Ausnahme: 137 hyacinthos; 169 ipsa est ist zweisilbig; Fitzpatricks Spondiacus 163 femina seu <sexu seu> masculus est seu neutrum-s. unten Anm. 61—ist Lactanz schon aus Klanggründen nicht zuzumuten).
Der z.T. unsichere Text nach Brandt, CSEL 27,1, 146 f. (wie bei Wlosok, Res humanae—res divinae, 274; vgl. dort 270 Anm. 8 und 274 Anm. 13 und 14). Die seltene Ausgabe von Fitzpatrick ([ob., Anm. 23] Diss. Philadelphia 1933) und die Erläuterungen bei Walla 148–183 erledigt; ein allseitiger Kommentar zum Phoenix ist Desiderat; s. unten Anm. 55. vorhanden in der Bibliothek des Thesaurus linguae Latinae München; für eine Kopie hatte ich Peter Flury zu danken, dem 2001 zu früh verstorbenen Generalredaktor des Thesaurus) wurde herangezogen. Weitere Ausgaben und Arbeitsmittel bei Wlosok, HLL 5, 398 (Lit. 14).
Überliefert ist filisque uolucrum; s. Brandt z. St., der die obenstehende Konjektur von Isaac Vossius (zit. nach Brandt) mit Zweifeln übernimmt. Fitzpatrick gewinnt ihr phonetisch den Hss. sehr nahestehendes felixque uolucrum, das sie nicht kommentiert, anscheinend aus Claud. carm. min. 27,101 o felix heresque tui, was Lact. Phoen. 164 felix (kann das bei Lactanz hier zweimal—und 161 als Vokativ mit partitivem Genitiv—gestanden haben?) und 167 heres aufnimmt.
Überliefert ist femina seu masculus est seu neutrum; Heilungsversuche bei Brandt z.St., dessen obenstehende Lösung (mit plausibler Erklärung des Fehlers masculus statt mas) ich wie Walla 180 für die bisher beste halte. Indiskutabel ist Fitzpatricks von ihr nicht kommentierter Spondiacus femina seu <sexu seu> masculus est seu neutrum; vgl. oben Anm. 58.
So sicher richtig Brandt mit E. Baehrens, “Zu des Lactantius Phœnix”, Rheinisches Museum N.F. 29, 1874, 201.
Wlosok, Res humanae—res divinae, 266 f.; vgl. 243.
Z. B. Lact. inst. 1,5,24 aus Cic. leg. 1,22 und nat. deor. 2,77; inst. 1,5,12 aus Verg. georg. 4,221–224 (vgl. schon Min. Fel. 19,2).
Richtig Walla 158 mit Verweis auf Lact. inst. 2,8,21.
Lact. inst. 1,8,3–6; epit. 6,2–4.
Lact. inst. 4,8,3–5.
Das ist freilich nur im Epilog möglich; in einer Übersetzung der Verse 1–160 muß ‘Phoenix’ wie ‘Vogel’ männlich bleiben (wie bis zum Ende in der Übersetzung von H. Kraft, Die Kirchenväter bis zum Konzil von Nicäa, Sammlung Dieterich 312, Bremen 1966, 462–467); zum zwischen Femininum—so auch Lactanz—und Masculinum—so auch Claudian-schwankenden Genus in den antiken Zeugnissen Walla 158 (nichts dazu Fitzpatrick 67 zu Phoen. 32 unica; in ihrer englischen Übersetzung ist Phoenix mit weiblichen Pronomina verbunden).
S. unten S. 522.
S. Brandt, “Zum Phoenix des Lactantius,” (ob. Anm. 13),, 396, freilich nur als kleine Konzession in seiner Ablehnung der Autorschaft des Christen Lactanz, die ihn 400 f. darauf führt, den Phoenix dem noch nicht bekehrten Lactanz zuzuschreiben.
Tert. resurr. 13,2 qui semetipsum libenter funerans renouat, natali fine decedens atque succedens, iterum phoenix ubi nemo iam, iterum ipse qui non iam, alius idem (“der sich selber freiwillig bestattend erneuert, sich aus dem durch Geburt gegebenen Bereich entrückend und darin nachrückend, nochmals Phoenix, wo keiner mehr, nochmals er selber, der nicht mehr, ein anderer und doch derselbe”); vgl. Walla 163.
Manches mag angeregt sein durch die Gleichnisse Tert. resurr. 12,1–4 (dazu E. Ahlborn, “Naturvorgänge als Auferstehungsgleichnis bei Seneca, Tertullian und Minucius Felix”, Wiener Studien 103, 1990, 123–137), z.B. 12,2 vom Tag heres sibimet existens; das müßte genauer untersucht werden. Zu 167 ipsa sibi proles und pater vgl. Lact. inst. 4,8,5 von Gott Hermes … dicit eum αύτoπάτoρα et αύτoμήτoρα (“Hermes sagt, er sei selbstväterlich und selbstmütterlich”); zu der Stelle s. A. Löw, Hermes Trismegistos als Zeuge der Wahrheit, Berlin /Wien 2002, 204.
Die Formel mors=uita findet sich nachantik auf dem Grabmal Rudolfs von Schwaben (Gegenkönig Heinrichs IV., 1077–1080) im Merseburger Dom: rex hoc Rodulfus patrum pro lege peremptus plorandus merito conditur in tumulo. rex illi similis, si regnet tempore pacis, consilio gladio non fuit a Karolo. qua uicere sui, ruit hic sacra uictima belli. mors sibi uita fuit, ecclesiae cecidit. In diesem Grabe, das ihm zusteht, ist König Rudolf, für das Gesetz der Väter dahingerafft, um den man weinen muß, beigesetzt. Einen König, der ihm ähnlich wäre, wenn er in Friedenszeit herreschte, im Gebrauch vom Einsicht und Schwert, hat es seit Karl [dem Großen] nicht gegeben. Wo seine Anhänger siegten [in der Schlacht bei Weißenfels], stürzte er als heiliges Opfer des Krieges. Ihm war der Tod Leben, für seine Kirche fiel er. Für eine Transscription der in situ schwer lesbaren Inschrift danke ich Dr. Joachim Pröhl, Leipzig. Zur Inschrift B. Hinz, Das Grabdenkmal Rudolfs von Schwaben, Frankfurt/M. 1996, 35–40; er geht nur auf uictima im martyrologischen Kontext, nicht auf mors … uita ein.
Dazu Wlosok, Res humanae-res divinae, 266.
Bes. inst. 6,21,11. 22,3 mortis est fabricatrix uoluptas (“Des Todes Verfertigerin ist die Lust”). 7,5,23–24. 9,15. 10,10. 12,15 und im Epilog 7,27,7 mors uoluptatis inlecebris adoperta (“der durch die Lockungen der Lust verhüllte Tod”) (nach dem auf Christus umgestellten Epikurelogium des Lucrez; s. unten S. 522).—Lexikalische Daten zu Lactanz erhebe ich aus Brandts auf Datenträger gespeichertem Text; s. Heck-Wlosok, “Zum Text der Epitome” (ob., Anm. 23), 147 Anm. 12; Heck, Gnomon 57, 1985, 146 Anm. 4.
Walla 183; Wlosok, Res humanae-res divinae, 267.
S. oben S. 519 mit Anm. 70., 390–403.
Dementsprechend übersetzt Kraft 466 f. Verse 164 f.: “selig ist er, weil er das Bündnis der Venus nicht pflegt. Tod ist für ihn Liebe, allein im Tod liegt seine Lust”, womit aber die unten darzustellende Pointe verlorengeht.
Lact. opif. 12,15 quam mirabile institutum dei, quod ad conseruationem generum singulorum duos sexus maris ac feminae machinatus est, quibus inter se per uoluptatis inlecebram copulatis subsiciua suboles pararetur, ne genus omne uiuentium condicio mortalitatis extingueret (“Welch wundervolle Einrichtung Gottes, daß er zur Erhaltung der einzelnen Gattungen die beiden Geschlechter von Mann und Weib in Tätigkeit setzte, damit durch deren Vereinigung miteinander mittels Lockung der Lust nachwachsende Nachkommenschaft geschaffen wurde, auf daß nicht die gegebene Lage der Sterblichkeit alle Art von Lebendigen auslöschte”). Vgl. inst. 1,8,5–6. 6,19,6. epit. 6,2.
Bezeichnenderweise während eines Seminars im Sommer 1996, nachdem ich die Stelle seit 1978 wohl zwanzigmal still gelesen hatte—die Lucrezverse habe ich seit Friedrich Klingners Münchner Kolleg im Winter 1957/58 im Ohr. Daß lautes Lesen und Lesenlassen, also Hören lateinischer Texte ihr Verständnis fördert, ist eine leider zu oft ignorierte Binsenweisheit; in Schule und Universität—auch in Prüfungen-sollten lateinische Texte nur übersetzt und besprochen werden, wenn sie auch laut gelesen werden, und Lernende wie Lehrende sollten dazu angehalten werden oder sich dazu anhalten, das auch, wo immer möglich, bei eigener Arbeit an Texten zu tun.
Lact. inst. 3,17,42 (im kritischen Referat der Lehre Epikurs) uoluptatem esse maximum bonum …mortem non esse metuendam forti uiro (“Die Lust sei das höchste Gut … ein tapferer Mann müsse den Tod nicht fürchten”).
Dieses Schlagwort läßt sich gewinnen aus Lucr. 1,21 quae quoniam rerum naturam sola gubernas (“die du ja allein die Schöpfung der seienden Dinge steuerst”) und der Anrede 1,1 Aeneadum genetrix (vgl. C. Bailey, komm. Ausg. Oxford 1947, II 589 f.); auf die vieltraktierte Frage der Funktion des lucrezischen Venus-Elogiums 1,1–43 und die darin zu erkennenden Spannungen —der Epikureer bittet Venus nicht nur um Unterstützung beim Abfassen eines Werkes de rerum natura (24–28), sondern auch um Einwirken auf Mars mit dem Ziel des Friedens für den politisch tätigen Adressaten Memmius (29–40)-kann ich hier natürlich nicht eingehen.
Lucr. 3,830 nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum (“Nichts also geht uns der Tod an und betrifft uns kein bißchen”).
So Lact. inst. 3,17,42 (s. oben Anm. 81) (im kritischen Referat der Lehre Epikurs) uoluptatem esse maximum bonum … mortem non esse metuendam forti uiro (“Die Lust sei das höchste Gut … ein tapferer Mann müsse den Tod nicht fürchten”).
S. oben S. 510 mit Anm. 8–10; Lact. inst. 7,27,6 zitiert Lucr. 6,24–28.
Lucr. 2,991 f.; es handelt sich um das letzte Klassikerzitat in opif.; inst. 7,27,6 ist das Lucrezzitat das vorletzte Klassikerzitat im Epilog, danach nur noch 7,27,16 ohne Autornennung als Schmuckzitat Verg. Aen. 4,336; vgl. Heck, “Lactanz und die Klassiker”, 178 f. mit Anm. 108.
Heck, “Lactanz und die Klassiker”, 179 mit Anm. 108; vgl. oben Anm. 8.
Verg. georg. 2,490–492 felix qui potuit rerum cognoscere causas/atque metus omnis et inexorabile fatum/subiecit pedibus strepitumque Acherontis auari (“Glücklich der, der vermochte, die Ursachen der seienden Dinge zu erkennen, und alle Arten der Furcht und das unerbittliche Geschick unter seine Füße warf und das Lärmen des habgierigen Acheron”).
Oben S. 517.
S. Brandt, “Lactantius und Lucretius,” (ob., Anm. 5),, 231.
M. de Polignac, Antilucretius sive de deo et natura libri novem, Paris 1747. Neue Edition der Bücher 1, 5 und 9 von P.M.M. Geurts, Anti-Lucretius of Over God en de Natuur, Assen 1968, mit ausführlicher Einleitung 193–226. Zu Polignac im Rahmen der Wirkungsgeschichte des Lucrez schon W. Schmid, “Lukrez und der Wandel seines Bildes”, Antike und Abendland 2, 1946, 193–219, hier 197 (überarbeitete Fassung abgedr. in: Römische Philosophie, hrsg. von G. Maurach, Wege der Forschung 193, Darmstadt 1976, 37–83, hier 44), und neuerdings E. Flammarion, “L'Anti-Lucretius sive de Deo et natura libri novem de Polignac,” in: Présence de Lucrèce: Actes du colloque tenu à Tours (3–5 décembre 1998), hrsg. von R. Poignault, Tours 1999, 361–379.
S. oben S. 511 mit Anm. 13 und 519 mit Anm. 70.
Zitiert auch bei Schmid 197 (=Römische Philosophie 44).
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Heck, E. Nochmals: Lactantius und Lucretius. Antilucrezisches im Epilog des lactanzischen Phoenix-Gedichts?. Int class trad 9, 509–523 (2003). https://doi.org/10.1007/s12138-003-0001-5
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s12138-003-0001-5