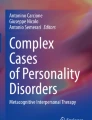Summary
Relationship as a framework for every psychotherapy is unquestionably seen as method, change agent and medium. Whereas originally the structure of the psyche was conceptualized "intrapsychic", nowadays more and more "relation-centered" concepts are developed. Relationship patterns are the central issue of psychotherapy. The author shows the difference between the intrapsychic and the interpersonal point of view by discussing the concepts of order of Hellinger and Scheler. He argues in favour of intrapsychic hierarchies of values (preferencies) instead of being focused on relationship patterns.
Zusammenfassung
Beziehung wird als Rahmen jeglicher Psychotherapie gesehen und gilt inzwischen mit unhinterfragbarer Selbstverständlichkeit als Methode, Wirkprinzip und Medium. Während ursprünglich die Struktur der Psyche "intrapsychisch" konzeptualisiert wurde, werden in jüngerer Zeit immer mehr "beziehungszentrische" Konzepte entwickelt. Beziehungsmuster werden zum zentralen Gegenstand der Psychotherapie. Der Autor arbeitet am Beispiel der Ordnungsbegriffe von Hellinger und Scheler die Differenz zwischen der intrapsychischen und der interpersonellen Sichtweise heraus und plädiert statt einer Fixierung auf Beziehungsmuster für eine Orientierung an intrapsychischen Werterangordnungen.
Similar content being viewed by others
Literatur
Albani C, et al (2003) Beziehungsmuster und Beziehungskonflikte. Psychotherapeut 48 (6): 388–402
Ambühl H, Strauß B (Hrsg) (1999) Therapieziele. Hogrefe, Göttingen
Beebe B, Lachmann FM (2004) Säuglingsforschung und die Psychotherapie Erwachsener. Wie interaktive Prozesse entstehen und zu Veränderungen führen. Klett Cotta, Stuttgart
Behr M, Hölldampf D, Hüsson D (Hrsg) (2009) Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Personzentrierte Methoden und interaktionelle Behandlungskonzepte. Hogrefe, Göttingen
Bettighofer S (1998) Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozeß. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln
Beutel ME (2002) Neurowissenschaften und Psychotherapie. Neuere Entwicklungen, Methoden und Ergebnisse. Psychotherapeut 47 (1): 1–10
Bittner G (1992) Person oder "psychischer Apparat"? Überlegungen zu einer paradigmatischen Neuorientierung der Psychoanalyse und psychoanalytischen Pädagogik. In: Fröhlich V, Göppel R (Hrsg) Sehen, Einfühlen, Verstehen. Psychoanalytisch orientierte Zugänge zu pädagogischen Handlungsfeldern. Königshausen & Neumann, Würzburg
Clarkin JF, Yeomans FE, Kernberg OF (Hrsg) (2001) Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeit. Manual zur Transference-Focused Psychotherapy (TFP). Schattauer, Stuttgart New York
Dahlbender RW, et al (2001) Meisterung konflikthafter Beziehungsmuster im Verlaufe einer psychodynamischen Fokaltherapie . Psychother Psychosom med Psychol 51: 176–185
Fazekas T (2004) Der Mensch braucht Beziehung. Über universale Grundbedürfnisse unter ständiger Berücksichtigung der Psychotherapie . Lang, Frankfurt
Fein ML (1992) Analyzing psychotherapy. A social role interpretation. Praeger, New York
Finke J (1999) Beziehung und Intervention. Interaktionsmuster, Behandlungskonzepte und Gesprächstechnik in der Psychotherapie. Thieme, Stuttgart
Fuchs T (2004) Nonverbale Kommunikation: Phänomenologische, entwicklungspsychologische und therapeutische Aspekte . In: Lang H (Hrsg) Was ist Psychotherapie und wodurch wirkt sie. Königshausen & Neumann, Würzburg
Grawe K (2004) Neuropsychotherapie. Hogrefe , Göttingen
Hellinger B (1994) Ordnungen der Liebe. Ein Kurs-Buch. Carl Auer, Heidelberg
Jones EE (2001) Interaktion und Veränderung in Langzeittherapien. In: Stuhr/Leuzinger-Bohleber/Beutel (Hrsg) Langzeit-Psychotherapie: Perspektiven für Therapeuten und Wissenschaftler. Kohlhammer, Stuttgart
Kottje-Birnbacher L, Birnbacher D (1999) Ethische Aspekte bei der Setzung von Therapiezielen. In: Ambühl/Strauß (Hrsg) Therapieziele. Hogrefe, Göttingen, S 15–31
Merten J (2001) Beziehungsregulation in Psychotherapien . Maladaptive Beziehungsmuster und der therapeutische Prozeß . Kohlhammer, Stuttgart
Norcross JC (ed) (2002) Psychotherapy relationships that work: therapist contributions and responsiveness to patient needs. Oxford University Press, New York
Sander A (2001) Max Scheler zur Einführung. Junius, Hamburg
Scheler M (2000) Grammatik der Gefühle. Das Emotionale als Grundlage der Ethik. Dt. Taschenbuch, München
Schmidt-Traub S (2003) Therapeutische Beziehung – ein Überblick. Psychotherapeutische Praxis 3: 111–129
Schulte D (1996) Therapieplanung. Hogrefe, Göttingen
Strauß B (2002) Störungsspezifische versus Allgemeine Therapie aus der Sicht der Psychotherapieforschung . In: Mattke D, et al (Hrsg) Störungsspezifische Konzepte und Behandlung in der Psychosomatik. VAS, Frankfurt
Strupp HH, Binder JL (1991) Kurzpsychotherapie. Klett-Cotta, Stuttgart
Stuhr U, Leuzinger-Bohleber M, Beutel ME (Hrsg) (2001) Langzeit-Psychotherapie. Perspektiven für Therapeuten und Wissenschaftler. Kohlhammer, Stuttgart
Weber G (Hrsg) (1993) Zweierlei Glück. Die systemische Psychotherapie Bert Hellingers. Carl Auer Systeme, Heidelberg
Wöller W, Kruse J (Hrsg) (2001) Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfaden. Schattauer, Stuttgart
Yalom ID (2000) Existenzielle Psychotherapie. EHP, Köln
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
About this article
Cite this article
Köth, A. Beziehungsmuster und Werterangordnungen. Psychotherapie Forum 17, 101–107 (2009). https://doi.org/10.1007/s00729-009-0293-2
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s00729-009-0293-2