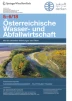Avoid common mistakes on your manuscript.
Über mehrere Generationen haben österreichische Dammbauexperten umfangreiche Erfahrungen für die Planung und zum Bau unterschiedlichster Dammkonstruktionen gemacht sowie spezielle Lösungen erarbeitet und erfolgreich umgesetzt. Den hohen Sicherheitsanforderungen entsprechend, haben regelmäßige behördliche und betreibereigene Überprüfungen von Bestandanlagen einen hohen Stellenwert, stellen eine besondere Herausforderung dar und bilden eine entscheidende Säule für einen sicheren Betrieb von Anlagen und Dämmen. Zudem konnten österreichische Dammbauexperten auch bei zahlreichen Projekten im Ausland erfolgreich tätig werden.
Das vorliegende Themenheft mit dem Schwerpunkt „Dammbau“ in Österreich gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen der Dammbautechnik, laufende Bauvorhaben sowie Anpassungs- und Revitalisierungsmaßnahmen. Die Beiträge verschiedener Autor:innen umfassen Bauwerke mit unterschiedlichsten Funktionen, wie beispielsweise Stauanlagen für die Wasserspeicherung, den Hochwasserrückhalt und Hochwasserschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Verhaldung im Bergbau oder die Errichtung von Straßendämmen. Sowohl für die Planung, Errichtung als auch für einen dauerhaften Bestand bedarf es eines Zusammenwirkens interdisziplinärer Fachbereiche, des Einsatzes spezieller Technologien sowie einer regelmäßigen Überwachung.
Der Bedarf an Stauanlagen für die Energieerzeugung mit Höhen größer als 15 m und somit von „großen Staudämmen“ setzte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mit dem Bau von etwa 20 Anlagen deutliche Akzente, der erst wieder nach einer Unterbrechung von etwa 15 Jahren mit der Fertigstellung des 80 m hohen Dammes Kartell (2006) fortgesetzt wurde. Eine neue Herausforderung stellte der Baubeginn des Staudammes Kühtai dar, der nach einer sehr langen Genehmigungsphase in den Jahren 2021/2022 begonnen werden konnte. Neben dem Neubau ergaben sich in den letzten Jahrzehnten bei zahlreichen älteren Staudämmen sowie Speicherbecken Anpassungserfordernisse zum Stand der Technik an neuere, sicherheitsrelevante Bemessungsgrundlagen. Weitere Maßnahmen bezogen sich auf Revitalisierungen infolge von Alterungen, wie beispielsweise für Abdichtungselemente, etc. Als Beispiele werden der Damm Kühtai für einen Neubau und für durchgeführte oder laufende Revitalisierungen sowie Anpassungen an den Stand der Technik das Becken Latschau I, der Damm Feldsee mit der Untergrundabdichtung sowie der Damm Eberlaste beschrieben.
Durch die gestiegenen Erwartungen und Bedürfnisse des Wintersports und der Freizeitgestaltung, sind etwa in den letzten 2 Jahrzehnten sehr viele Dämme zur künstlichen Schneeerzeugung errichtet worden, wobei der überwiegende Teil durch verschweißte Kunststoffbahnen, seltener durch Asphaltbeton, abgedichtet wurde. Durch die zunehmenden Höhen und die immer komplexeren Dammstandorte sowie zur Definition eines einheitlichen Standes der Technik wurden neue Regelwerke entwickelt.
Die Errichtung von Hochwasserschutz- und Hochwasserrückhaltedämmen erreichte in den vergangenen Dekaden wieder eine zunehmende Bedeutung. Durch den Umstand, dass solche Anlagen, im Vergleich zu den reinen Staudämmen, einem unregelmäßigen Einstau ausgesetzt sind, erfordern sie eine sehr konsequente Planung, Bauüberwachung und Bauumsetzung. Der Ersteinstau und die volle Belastung in Folge von Hochwasserereignissen treten häufig erst nach mehreren Jahren ein und Interventionen bei Störungen sind zumeist nur eingeschränkt möglich. Als Beispiel wird stellvertretend die Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens Krems/Au mit den zahlreichen technischen Herausforderungen beschrieben.
Eine besondere technische Anforderung stellen Dämme dar, die als Schutzbauwerke gegen Naturgefahren, wie Steinschläge, Muren, Lawinen etc. dienen sollen und für die ein zunehmender Bedarf entstanden ist. Die Herausforderungen beziehen sich einerseits auf die zumeist schwierigen Geländeverhältnisse der Standorte und andererseits auf die Bemessung und Konstruktion solcher Schutzdämme. Durch Forschungen über mögliche Einwirkungen und Entwicklung abgestimmter, optimierter Bauverfahren haben solche Dammbauten in den letzten Jahren eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Naturgefahren übernommen.
Spezielle bodenmechanische und geotechnische Verhältnisse sind vielfach bei Dämmen zur Verhaldung von feinkörnigen Materialien aus Produktionsprozessen mit zumeist höheren Wassergehalten und mit geringeren Scherfestigkeiten sowie längerfristigen Konsolidierungsvorgängen zu bewältigen. Da in den meisten Fällen nicht ausreichend grobkörnige Materialien für zusätzliche Stabilisierungen zur Verfügung stehen, bedarf es spezieller Einbauverfahren und Überwachungen zur Gewährleistung der Standsicherheit von Verhaldungen. Ein Beitrag geht auf die Verhaldung schwieriger Materialien ein.
Andere fachliche Themen mit besonders sensiblen Untergrundverhältnissen bei Hochwasserschutzdämmen werden ebenso angesprochen wie ein mögliches Verflüssigungspotenzial solcher Böden und die Abdichtung von Dämmen und Untergrund mit der Auswahl und Eignung von Injektionsmaterialien.
Ein Beitrag befasst sich mit dem Hochwasser am Fluss Gail (2018) und dem Versagen von Hochwasserschutzlängsdämmen einfacher Bauart, die teilweise etwa hundert Jahre alt sind, durch Über- und Durch- sowie Unterströmung sowie andere Ursachen.
Zusammenfassend sei erwähnt, dass sowohl kleine als auch große Dammbauwerke für die permanente als auch periodische Wasserspeicherung und für den Hochwasserrückhalt einer regelmäßigen Überwachung und Beobachtung zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen (rechnerische Standsicherheit, Überström- und Erosionssicherheit) bedürfen. Die allgemein gültige Philosophie in Österreich zur Stand- und Betriebssicherheit von Talsperren und Staudämmen beruht auf dem „Drei-Säulen-Modell“ und betrachtet die Sicherheit von „Planung und Ausführung“, „Überwachung“ sowie „Vorkehrungen für Notfälle“ und führte dazu, dass keine Versagensfälle von Stau- und Hochwasserrückhaltedämmen zu verzeichnen waren. Für Dämme zum Schutz gegen Naturgefahren und zur Verhaldung gelten ähnlich strenge Anforderungen.
Meiner persönlichen Freude Ausdruck verleihend sei abschließend angemerkt, dass ich etwa 45 Jahre lang die Möglichkeit hatte, bei zahlreichen unterschiedlichen Dammbauwerken in Österreich im Zuge der Planung, Umsetzung und Überprüfung tätig zu sein. Weiters konnte ich in mehr als 20 Ländern und auf mehreren Kontinenten für den Dammbau arbeiten, dies verbunden mit der Hoffnung, dass mir diese Tätigkeit noch für weitere Jahre vergönnt ist.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Additional information
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Tschernutter, P. Dammbau. Österr Wasser- und Abfallw 75, 208–209 (2023). https://doi.org/10.1007/s00506-023-00955-z
Accepted:
Published:
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s00506-023-00955-z